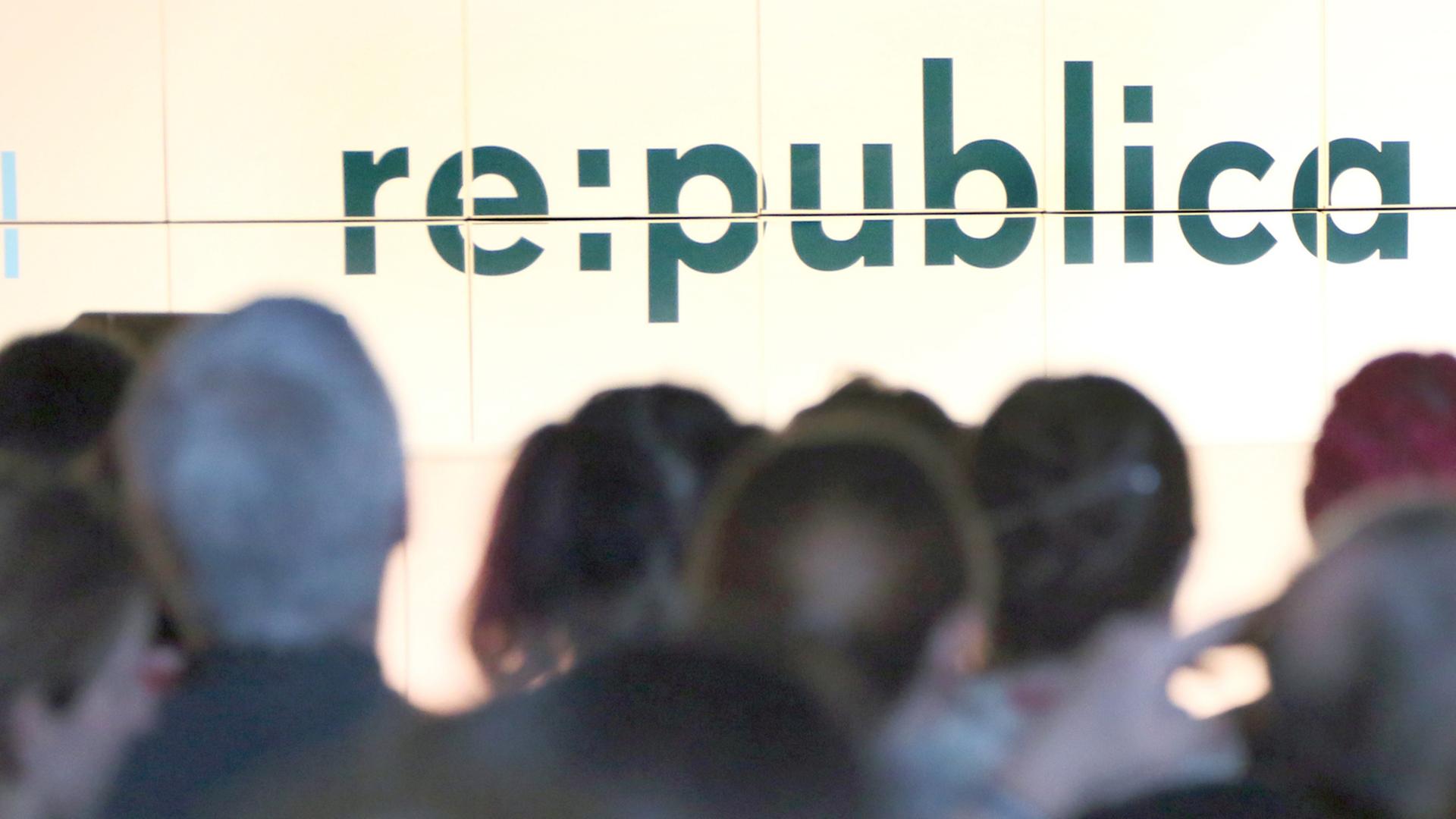Anfang der 90er-Jahre fuhr ich nach Abschluss meiner Lehre nach New York. Ich wollte die Stadt kennenlernen und David Letterman sehen. Die Show von David Letterman wird im Ed Sullivan Theater am Broadway aufgezeichnet. Für die Aufzeichnung war es schwer, an Karten zu kommen, vor allem musste man früh aufstehen und sehr lange Schlange stehen, was mich damals überforderte. Die Sendung, die wochentags gegen halb zwölf abends auf CBS ausgestrahlt wird, konnte ich mir damals auch nicht ansehen, weil mein Hotelzimmer keinen Fernseher hatte. Um David Letterman trotzdem sehen zu können, ging ich ins Museum for Television and Radio. Dort konnte man sich Sendungen aus dem Archiv bestellen und dann an einem eigenen Archiv-Bildschirm ansehen. Für normalsterbliche Mediennutzer war das damals eine der wenigen Möglichkeiten, ausgewählte, amerikanische Fernsehsendungen zeitversetzt anzuschauen.
Heute kann ich mir Sendungsausschnitte oder auch ganze Sendungen von David Letterman ansehen, ohne Berlin oder gar meine Wohnung zu verlassen. Dank des Internets kann ich mir eine riesige Auswahl amerikanischer Fernsehprogramme mit ein paar Klicks nach Hause holen. Aus dieser Sicht ist das Internet von heute eine moderne, für alle zugängliche Version des Museum for Television and Radio.
Kurz nach meiner New-York-Reise 1994 fing ich an zu studieren. Ich ahnte nicht, dass ich mir 20 Jahre später regelmäßig über das Internet amerikanische Fernsehsendungen auf meinem Laptop oder Fernseher ansehen würde. Wahrscheinlich ahnte das damals noch niemand, es galt 1994 bereits als Sensation, dass man mit den beiden gerade veröffentlichten Webbrowsern NCSA-Mosaic und Netscape Navigator erstmals Bild und Text komfortabel zusammen über das Internet übertragen und anzeigen konnte.
Am Anfang war das Internet ungeheuer kompliziert
Eigentlich war ich an die Universität gekommen, um Architektur zu studieren. Doch bereits im ersten Semester steckte ich meine ganze Energie in den Versuch, Zugang zum Internet zu kriegen. An der Universität konnte man das an ein paar vernetzten Rechnern bereits. Ich beantragte dort zuerst ein E-Mailkonto auf dem gerade erst neu eingerichteten E-Mailserver für Studenten und einen Modemzugang für meinen Rechner zuhause. Von zuhause ins Internet zu gelangen, war damals ungeheuer kompliziert. Neben einem Computer brauchte man einen Telefonanschluss, ein Modem, einen TCP/IP-Stack, der dem Computer die Sprache des Internets beibrachte, und ein bisschen Glück, um unter der Einwahlnummer im Rechenzentrum Anschluss zu finden, weil nur eine begrenzte Anzahl an Einwahlstellen zur Verfügung stand. Bekam man eine Verbindung zum Rechenzentrum, fing das Modem für ein paar Sekunden an zu singen und wenn es verstummte und leise in die Telefonleitung sang, war man drin im Internet.
Mit der richtigen Software konnte man sich dann im Internet bewegen oder entlang hangeln oder eben "browsen". Diese Browser waren noch relativ neu, gemessen daran, dass das Internet 1994 alles andere als neu war. Unter der bunten WWW-Oberfläche, die der Browser darstellte, lagen noch viele andere, ältere Schichten und Protokolle. Newsgruppen, Chaträume, Server, die man per "Telnet" oder "SSH" betreten konnte und dort Dateibäume erkunden, Dateien lesen oder schreiben oder Nachrichten an andere Benutzer hinterlassen konnte. Das alles erforderte entweder Kenntnisse im Umgang mit der sogenannten Unix Kommandozeile oder Spezialsoftware.
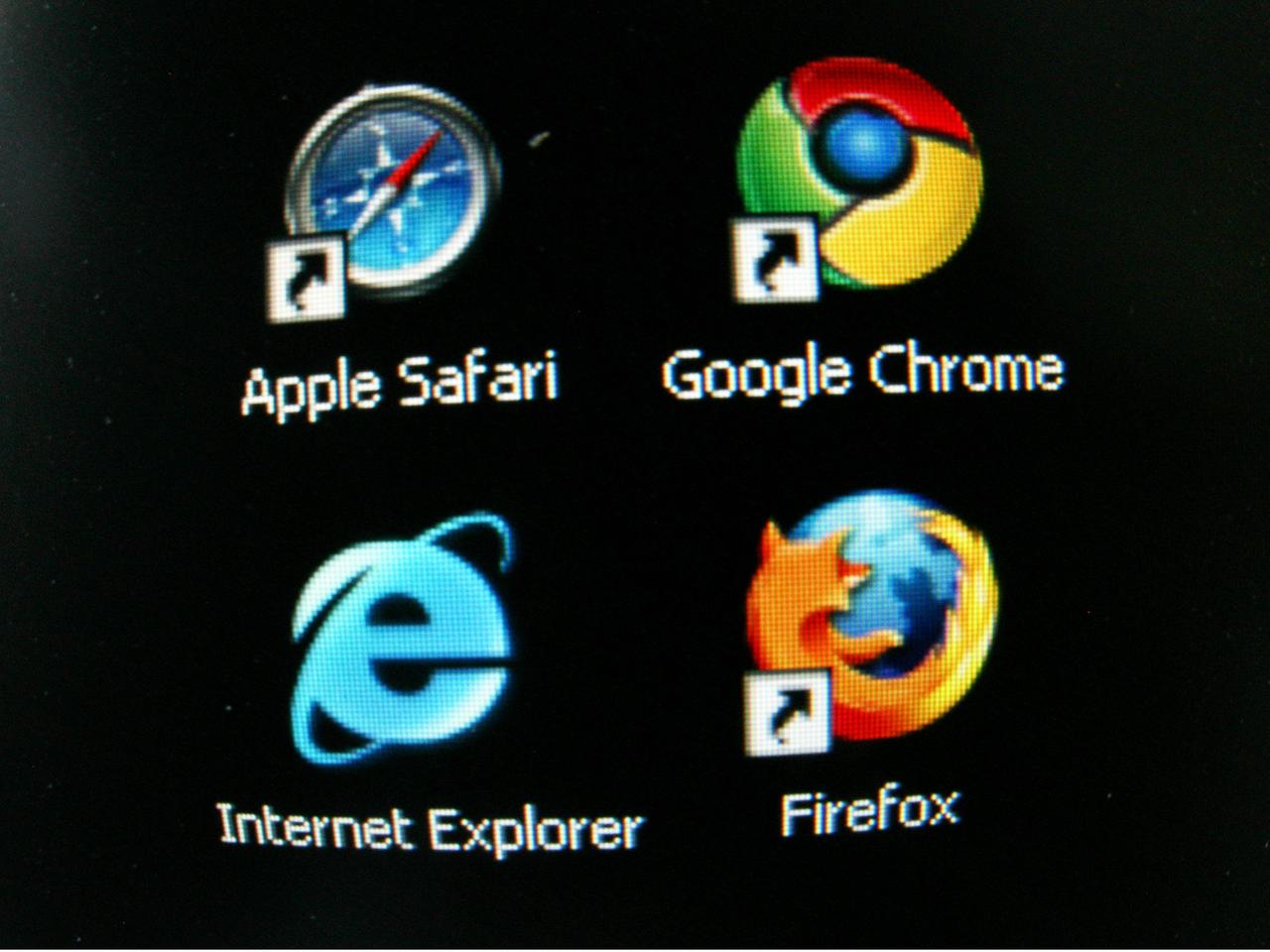
Als ich es irgendwann einmal nach intensivem Kommandozeilenstudium schaffte, einen dieser Chaträume im sogenannten Internet Relay Chat (IRC) zu betreten, hatte ich mein erstes Aha-Erlebnis: Ich tippte "hallo" und als Antwort erschienen auf meinem Bildschirm die Worte:
"Hallo Felix!"
Das war das erste Mal, dass aus meinem Computer etwas herauskam, das ich nicht selbst vorher eingegeben hatte. Es war das erste Mal, dass ich erkannte, dass man sich im Internet nicht nur mit Computern verbindet, sondern auch - und vor allem - mit anderen Menschen. Diese Verbindung war eigentümlich direkt und körperlos - aber eben nicht virtuell, sondern echt.
Das analoge Leben ist mit dem digitalen verwoben
Mich fasziniert diese besondere Art der Kommunikation mit anderen, fremden Menschen, die auf das Minimum, auf reine Sprache reduziert war, bis heute. Ohne Stimme, Mimik oder Gestik - nur die Buchstaben auf dem Bildschirm - blieb der Rest der Fantasie überlassen.
In den letzten 20 Jahren habe ich einen großen Teil meines Lebens im Internet verbracht. Ich bin immer wieder erstaunt über die wundersamen Dinge und Menschen, die man dort entdeckt und kennenlernt. Mein analoges Leben ist dicht verwoben mit meiner digitalen Existenz und ich kenne nicht wenige Menschen, die Freunde und Lebensgefährten im oder um das Internet herum gefunden haben. Das Internet ist Teil meines Lebens, so wie New York City Teil meines Lebens wäre, wohnte ich in New York.
Ich gebe zu, dass meine Begeisterung für das Internet zu großen Teilen von Euphorie und Technik-Optimismus getrieben ist; eine Art Fernweh nach dem Neuen, dem Unerforschten und Unentdeckten. In den letzten Jahren allerdings haben viele der frühen Wegbereiter angefangen, das Netz grundsätzlich infrage zu stellen. Sascha Lobo stellte Anfang 2014 in der FAZ fest, dass das Internet "kaputt" sei. Er schob relativierend hinterher, dass aber "die Idee der digitalen Vernetzung" nach wie vor sehr lebendig sei.
Anfang dieses Jahres stellte der ehemalige Internetunternehmer und Autor Andrew Keen sein neues Buch vor, in dem er erklärt, warum das Internet "gescheitert" sei - und wie wir es "retten" könnten.
Was ist passiert, dass nach Dekaden ungeheuer dynamischer Entwicklung und unzähligen Erfolgsstorys, die das Internet schrieb, plötzlich von Internetsympathisanten so grundsätzliche Konstruktionsfehler eben dieses Internets entdeckt werden?
Keine Chance, dem Internet zu entkommen
Bevor ich der Frage nachgehe, was Lobo, Keen und viele andere dazu bewogen haben mag, das Netz als "defekt" zu bezeichnen, möchte ich den Blick noch mal auf die Entwicklung der letzten 20 Jahre richten. Auch wenn das Internet sehr viel älter als 20 Jahre ist, hat es sich in den letzten Jahren vor allem durch die Erfindung des World Wide Webs und des Browsers zu einem Medium entwickelt, das - wie Peter Glaser es einmal ausdrückte - sogar "ältere Damen mit Hut nach zehn Minuten bedienen konnten".
Das Netz ist in fast alle Lebensbereiche vorgedrungen, wir können darin nicht nur Fernsehsendungen aus aller Welt sehen, sondern auch Waschmaschinen und Kinokarten bestellen, Briefmarken ausdrucken, Bücher auf Lesegeräte laden oder Flugtickets buchen. Ohne das Internet kann man an der Welt kaum noch teilnehmen. Selbst wenn man versucht, sich dem Internet zu verweigern, entkommt man ihm nicht: Telefonate werden, ob man das will oder nicht, über Internetleitungen geroutet, kaum eine Bank nimmt noch Papierüberweisungen an. Der Blogger und Journalist Michael Seemann sagt dazu:
"Es gibt kein analoges Leben mehr im Digitalen. Wer Teil der Welt ist, wird Teil des Internets sein."
Einer der Erfolgsfaktoren beim Siegeszug des Internets ist Komfort. Obwohl immer größere Mengen an Daten gesammelt und gespeichert werden, lassen sich die passenden Informationen immer leichter finden. Der Autor David Weinberger erklärt eines der Grundprinzipien der Internet Ökonomie wie folgt: Um dem Informationsoverkill zu entgehen und die Datenfluten zu kanalisieren, brauchen wir noch mehr Daten. Auch wenn sich das zunächst paradox anhört: Durch kluge Verknüpfung und ausgefeilte Suchanfragen können wir immer besser Daten mit anderen Daten verknüpfen und ihnen immer passgenauere Antworten und Fakten entlocken. Dank dieser gigantischen Datenerhebung können Suchmaschinen antizipieren, was wir suchen, finden wir in sozialen Netzwerken unsere Freunde und Bekannten wieder, sehen passgenaue, oft günstige kommerzielle Angebote oder finden unseren Weg in fremden Städten.
Jede Informationsbeschaffung wird beschleunigt
Als ich kürzlich wieder mal in New York war, stand mir zum ersten mal eine permanente Internetverbindung zur Verfügung. Bei meinen vorherigen New-York Besuchen bin ich fast nie Bus gefahren, weil ich ohne fremde Hilfe auf den Stadt- und Busfahrplänen nicht ausmachen konnte, wie und wo die Busse genau fahren. Mit einem internetfähigen Telefon war das hingegen ganz einfach. Ich ließ das Internet, in diesem Fall Google-Maps, wissen, wo ich hinwollte, und das Telefon schlug mir verschiedene Wege mit genauen Umsteigeanweisungen und Ankunftszeiten vor. Der Preis für diesen Komfort waren meine Standort- und Bewegungsdaten, die ich an Google, den Telefonanbieter AT&T und möglicherweise an die NSA weitergab. Gegen meine Standortdaten konnte ich auch kostenlose und maßgeschneiderte Restaurantempfehlungen bekommen. Mit der Foursquare-App konnte ich mir jederzeit Restaurants mit moderaten Preisen anzeigen lassen, die von anderen Foursquare-Benutzern empfohlen und kategorisiert wurden. Die Qualität der Empfehlungen oder der Wegbeschreibungen erklärt sich vor allem durch das Sammeln gigantischer Datenmengen. Aus der Aggregation von Bewegungsdaten tausender seiner Nutzer kann Google Verkehrsstörungen erkennen oder Empfehlungen ableiten. Foursquare, dessen gesamte Ortsdatenbank durch freiwillige Nutzer erstellt und gepflegt wird, kann mir gezielt Empfehlungen meiner Freunde und Bekannten geben oder besonders beliebte Orte aus den Bewegungsdaten seiner Nutzer extrahieren.
Natürlich habe ich auch meine Flüge und Hotels per Internet gefunden und gebucht, meine Verabredungen mit Freunden per E-Mail oder Facebook organisiert und die halbe Reise in Echtzeit für Freunde, Bekannte und interessierte Fremde per Instagram oder Facebook dokumentiert.
Neben dem Komfort bei der Orientierung, dem Konsum oder der Kommunikation beschleunigt das Internet auch jede Informationsbeschaffung. Bei früheren New-York-Besuchen musste ich mich noch mit mehreren Kilo Papier und ausreichend Geduld ausstatten, um Restaurantempfehlungen, Kinoprogramme oder Wegbeschreibungen zu bekommen. Dieses Jahr reichte ein relativ günstiger Hochleistungscomputer in Telefonform und ein paar Berührungen des Bildschirms. Auch Tickets für David Lettermans Show kann man Online bestellen.
Natürlich weiß ich, dass dieser Zuwachs an Komfort und die Beschleunigung und Verbesserung der Informationsbeschaffung mit einem Preis verbunden ist. Wenn ich ein Taxi mit der MyTaxi-App bestelle, helfe ich, Taxizentralen überflüssig zu machen, jedes eBook, das ich kaufe, trägt dazu bei, das Geschäftsmodell des Buchhandels infrage zu stellen, jeder Zeitungs- oder Blog-Artikel, den ich am Bildschirm lese, trägt zur Reduzierung von Printanzeigenbudgets bei. Jede Suchanfrage, jeder Klick, den ich tätige, hinterlässt Datenspuren, die von Dritten kommerziell ausgewertet werden oder von Geheimdiensten aufgelesen und gesammelt werden können.

Das Internet ist nicht das, wofür es gehalten wurde
Sascha Lobos resignierte Aussage, dass das Internet "kaputt" sei, hängt genau hiermit zusammen. Einst glaubte er, das Internet sei "das perfekte Medium der Demokratie und der Selbstbefreiung". Angesichts der durch Edward Snowden bekanntgewordenen Totalüberwachung des Internets musste er feststellen, das Internet sei nicht das, wofür er es gehalten habe. Da sei er wohl naiv gewesen.
Ich möchte mir diese Naivität gerne bewahren, die Sascha Lobo mit Verbitterung getauscht hat. Auch ich war letztes Jahr überrascht vom Umfang und Ausmaß der Überwachung des Internets, unter anderem durch westliche Geheimdienste. Und obwohl ich die schrankenlose Ausspähung von Menschen durch die Geheimdienste westlicher Staaten empörend und demokratiefeindlich finde, ist sie auf den zweiten Blick folgerichtig. Denn das Internet hat uns nicht gesteigerten Komfort und Geschwindigkeit bei der Informationsbeschaffung und Kommunikation ermöglicht, sondern vor allem einen radikalen Kontrollverlust gebracht.
Bisher betraf dieser Kontrollverlust vor allem etablierte Institutionen. Weder die Unterhaltungsindustrie, noch das Militär oder die Geheimdienste haben es im Internetzeitalter geschafft, ihre Daten unter Kontrolle zu halten. Auch 15 Jahre nach dem Aufkommen der ersten (illegalen) Musiktauschbörse Napster kämpft die Unterhaltungsindustrie weiterhin erfolglos gegen das massenhafte Kopieren ihrer Angebote und Waren im Internet. Weder durch repressive, noch durch technische Maßnahmen ist es der Unterhaltungsindustrie gelungen, die Kontrolle über ihre Inhalte zurückzuerlangen. Ebenso ergeht es staatlichen Institutionen und etlichen privaten Unternehmen, die immer wieder die Kontrolle über ihre teils geheimen Daten verlieren. Es sind die gleichen Mechanismen und Prozesse, die einerseits dazu geführt haben, dass die NSA geheime Daten nicht schützen konnte, mit denen sich andererseits Geheimdienste im Digitalzeitalter aller Daten bemächtigen: Vertrauensmissbrauch, Ausnutzung technischer Lücken, unzureichende Sicherheitsmaßnahmen und die unendlich große Kapazität der Kopiermaschine Internet.
Wir müssen für die Möglichkeiten kämpfen
"Die positiven Versprechungen des Internets, Demokratisierung, soziale Vernetzung, ein digitaler Freigarten der Bildung und Kultur" waren "ohnehin immer nur Möglichkeiten", so Sascha Lobo frustriert und wütend in der FAZ.
Ich glaube, diese Versprechen sind nach wie vor Möglichkeiten. Möglichkeiten, für die wir kämpfen können und müssen, auch unter widrigen Umständen oder in einer Welt, in der die bösen Mächte die gleichen, oder mächtigeren Werkzeuge als wir zur Verfügung haben. Die enttäuschten Hoffnungen sind auch das Thema von Andrew Keen, meinem Lieblingsinternetkritiker. Er ist schneidend intelligent und wie Sascha Lobo oder Jaron Lanier auch im Internet sozialisiert. Keen beklagt nicht nur den gigantischen Überwachungsapparat, der das Internet überschattet, sondern sieht das Internet vor allem als einen Tummelplatz von Idioten, die Anderen das Leben schwer machen und eine Atmosphäre von Intoleranz und Aggressivität schaffen. Das Internet zerstört laut Keen nicht nur unsere Freiheit, sondern auch unsere Kultur und Arbeitsplätze. Riesige, monopolistische Konzerne zögen uns Daten, Zeit, Freiheit und Geld aus den Taschen und machten einige wenige "weiße Männer" - wie er sich ausdrückt - unfassbar reich.
Ich gehe davon aus, dass Keens Analyse richtig ist, glaube aber, dass er die falschen Schlüsse daraus zieht. Ganz falsch klingt für mich der deutsche Titel seines neuen Buchs: "Das digitale Debakel: Warum das Internet gescheitert ist - und wie wir es retten können".
"Ich denke: Das Internet ist nicht gescheitert, wir haben nur noch nicht die richtigen Strategien entwickelt, damit umzugehen."
Es stimmt, das Internet macht die Schattenseiten unserer Gesellschaft sichtbar. Hasserfüllte Leserbriefe, die uns früher womöglich verborgen blieben, landen nun nicht mehr im Papierkorb, sondern teils ungefiltert in Kommentarspalten oder direkt auf Blogs, Twitter oder Facebook in aller Öffentlichkeit. Aber nur weil eine neue Technologie sichtbar macht, wie viel Hass und Intoleranz tatsächlich in unserer Gesellschaft stecken, ist die Technologie noch lange nicht "gescheitert", im Gegenteil. Nehmen wir mal Keens "Idioten": Das Internet als ein gigantisches Mikroskop macht ihre Aktionen gleichermaßen sichtbar. Je mehr Idioten merken, dass sie nicht die einzigen Idioten sind, desto schlagkräftiger und lauter werden sie. Und dennoch hat jede Aktion auch immer eine Reaktion zur Folge. Auch "Nicht Idioten" können vernetzte Systeme nutzen und auch selbst Empörungsstürme und Solidaritätswellen lostreten, Missbrauch, Belästigung und Drohungen öffentlich machen - und Solidarität mobilisieren.
Probleme in der vernetzten Gesellschaft
Die Probleme des Internets, die Keen analysiert hat, sind auch nicht internet exklusiv. Die Schattenseiten der Welt existieren so wie in der analogen auch in der digitalen Welt - auch wenn sie, wie gesagt, digital mitunter deutlicher sichtbar sind. In beiden Welten, die eigentlich eine sind, müssen wir an ihrer Lösung arbeiten.
Die Arbeit an diesen Problemen und der Kampf um Freiheit und Gleichberechtigung im Internet ist nicht leicht und wird in Zukunft wahrscheinlich auch nicht leichter. Aber wann in der Weltgeschichte war der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit jemals leicht? Als die positiven Verheißungen des Internets erstmals 1996 vom amerikanischen Musiker und Bürgerrechtler John Perry Barlow in der "Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace", einem pathetischen Manifest, formuliert wurden, erweckte er den Eindruck, dass Unabhängigkeit einfach nur erklärt werden müsse. Gerechtigkeit, Freiheit und Brüderlichkeit würden sich dann selbst organisieren. Diese Utopie des gelobten "Cyberspace" kann man als gescheitert ansehen.

Überzogene Erwartungen an ein System, die nicht erfüllt wurden - das lässt nur eingeschränkt Rückschlüsse auf den tatsächlichen Zustand des Systems zu. Auch im Cyberspace gilt das, was Michael Seemann sagt: "Technologie determiniert weder die gesellschaftlichen Strukturen noch unser Handeln. Sie eröffnet einen Korridor der Handlungsspielräume, den es politisch auszugestalten gilt. Technologie macht bestimmte Strategien effektiver und verurteilt andere auf lange Sicht zum Scheitern."
Seemanns Buch "Das neue Spiel" bietet eine Analyse der Probleme, mit denen wir uns als vernetzte Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Es stimmt in der Faktenanalyse überein mit Sascha Lobo oder Andrew Keen. Jedoch sind Seemanns Schlussfolgerungen sehr viel unaufgeregter und vor allen Dingen recht pragmatisch. Das macht sein Buch zu einem lehrreichen Lesevergnügen. Der Verzicht auf "Wehleidigkeit", wie Gert Scobel in 3sat lobte, und auch der Verzicht auf einen übergeigten Buchtitel werden sich hoffentlich auch für den Buchmarkt lohnen. Denn erfahrungsgemäß haben Autoren oder Verlage, die eine grundsätzlich pessimistische Haltung zur Internetthematik auf der Titelseite ihrer Bücher ankündigen, momentan bessere Chancen auf Bestsellerlisten zu gelangen oder Buchpreise zu erhalten.
Nur keine Panikmache
Skepsis gegenüber neuen Technologien ist den Deutschen nicht fremd. Nicht nur die Enthüllungen von Edward Snowden und die Erkenntnis, dass beinahe alle großen Internet-Konzerne freiwillig oder unfreiwillig Kundendaten an Geheimdienste abgegeben haben oder nicht ausreichend gesichert haben, setzt sich im kollektiven Internet-Skepsis Gedächnis fest. Auch der Diebstahl von unzähligen digitalen privaten Fotos von Prominenten im Sommer 2014 sowie der Hackerangriff auf Sony Pictures im November 2014, bei dem Terrabyte-weise Daten entwendet und veröffentlicht wurden, unter anderem die Versicherungsnummern und E-Mails einfacher Angestellter, zeigen den postulierten digitalen Kontrollverlust.
Unter diesem Kontrollverlust leiden wir alle - ganz gleich ob wir im Internet sparsam mit dem Weitergeben unserer Daten sind oder nicht. Auch Menschen, die das Internet gar nicht bewusst nutzen, können ohne Weiteres die Kontrolle über ihre Daten verlieren, zum Beispiel wenn sie ein Konto bei einer Bank haben, Fotos mit ihrem Smartphone aufnehmen oder in einer Firma arbeiten, die das Angriffsziel von verbrecherischen Hackern oder Geheimdiensten wird.
Was ist zu tun, wenn die Krise des Internets da ist? Wenn kluge Menschen feststellen, dass das Internet "kaputt" oder "gescheitert" sei, Arbeitsplätze vernichtet werden, Kultur und Demokratie gefährdet sind, wenige weiße und rücksichtslose Unternehmer unfassbar reich würden, an vielen Orten im Netz ein rassistisches oder sexistisches Klima herrsche, Narzissmus und Verfall der Jugend gleichermaßen Vorschub geleistet werde?
Erstmal das Gleiche, was man auch in der analogen Welt jedem Teilnehmer empfehlen würde: keine Panik. Und vor allem: keine Panikmache. Der zweite Punkt ist sehr schwer durchzuhalten. Wir kennen das aus den Krisen der letzten Jahrhunderte in der analogen Welt: Wer am Überzeugendsten die Ängste und Vorurteile der Menschen schüren kann, erzielt die höchsten Popularitätswerte oder hohe Auflagen. Der Hauptgewinn erfolgreicher Panikmache ist oft ein Einzug ins Parlament.
Auch in der digitalen Welt lauern Gefahren
Als die Probleme der Industrialisierung im 19. Jahrhundert in der Gesellschaft zu gären begannen, wurde die Industrie angesichts von Ausbeutung und schreiendem Unrecht nicht als "gescheitert" angesehen. Vergleichbar mit den großen Internetkonzernen erfreute sich die Industrie des 19. und 20. Jahrhunderts bester Gesundheit und kapitalisierte den Markt. Im Zuge des Erfolgs bildeten sich Interessenvertretungen, die zum Beispiel als Gewerkschaften an der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen entscheidend mitwirkten.
Auch für das digitale Weltzeitalter gilt: Was wir tatsächlich brauchen, sind starke Interessenvertretungen. Um eine Interessenvertretung zu organisieren, benötigt man aber möglichst viele Menschen, die Interesse an einer Sache oder einem Problem haben. Menschen, die Interesse daran haben, die Welt, in der sie leben, zu verbessern.
So wie es in jeder Großstadt dunkle Ecken, Drogen, Rassismus oder schlecht gelaunte Busfahrer gibt, lauern auch in der digitalen Welt Gefahren, Unbekanntes und Abscheuliches. Alle Städte funktionieren, weil sich ausreichend viele Menschen für ein Leben in der Stadt interessieren und die Lebensbedingungen dort mitgestalten wollen.
Auch wenn Sascha Lobo einmal davor warnte, dass Metaphern, die das Internet beschreiben, stets weite Teile des (so komplexen) Internets ausblenden, möchte ich noch eine weitere Metapher anbringen: Wäre das Internet Amerika, würden wir Amerika wahrscheinlich gerade mal bis zum Mississippi besiedelt haben und auch die Gebiete bis zum Mississippi nur lückenhaft kartografiert haben.
Es geht uns nicht darum, das Neue kritiklos zu bejubeln
Was wir für die Besiedlung und Zivilisierung der riesigen Weiten des Internets brauchen, sind nicht nur Skeptiker und Warner, nicht nur Glücksritter und Goldsucher, sondern Architekten, Philosophen, Juristen, Mediatoren, Historiker, aber auch Idealisten und Optimisten, die Interesse an diesem riesigen, teilweise noch unzivilisierten Land haben.
Die digitale und die analoge Welt werden sich immer mehr verschränken. Es ist daher genauso wichtig, für die Gestaltung der digitalen Welt zu werben, wie vor den Gefahren und Risiken zu warnen, die in ihr lauern. Internetoptimismus muss nicht zwangsläufig naiv sein. Er kann auch sehr realistisch ausgeprägt sein. Nochmal Michael Seemann: "Die, die auf diese Weise leidenschaftslos auf die Disruption des Alten blicken, handeln sich schnell den Vorwurf ein, naive Internetutopisten zu sein, die nur das Gute im Neuen sehen wollen. Das stimmt nicht. Wenn wir sagen, dass wir das Neue als Neues anerkennen müssen, und aufhören, dem Alten hinterherzutrauern, tun wir das nicht aus Begeisterung für das Neue. Es geht uns nicht darum, das Neue kritiklos zu bejubeln - im Gegenteil. Es ist uns sogar besonders wichtig, die Gefahren, die das Neue Spiel mit sich bringt, herauszustellen. Die Warnung vor dem Untergang des Alten verstellt oft die Sicht auf die echten Herausforderungen. Für das Erkennen dieser neuen Gefahren brauchen wir eine ebenso ungetrübte Sicht wie für das der neuen Chancen."
Natürlich werden wir zahlreiche weitere Krisen und Gefährdungen von Recht und Freiheit im Internet erleben, es werden heftige Kämpfe zwischen mächtigen und weniger mächtigen Interessengruppen um Einfluss und Deutungshoheit zu beobachten sein - und vielleicht wird der Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit auch hin und wieder scheitern. Aber das Internet zu erkunden, im Internet für demokratische, gerechte und freiheitliche Strukturen zu kämpfen, Strategien gegen die unbestreitbar zahlreichen Gefahren zu entwickeln und sich dafür einzusetzen, hört sich für mich nach einer spannenderen Alternative an.