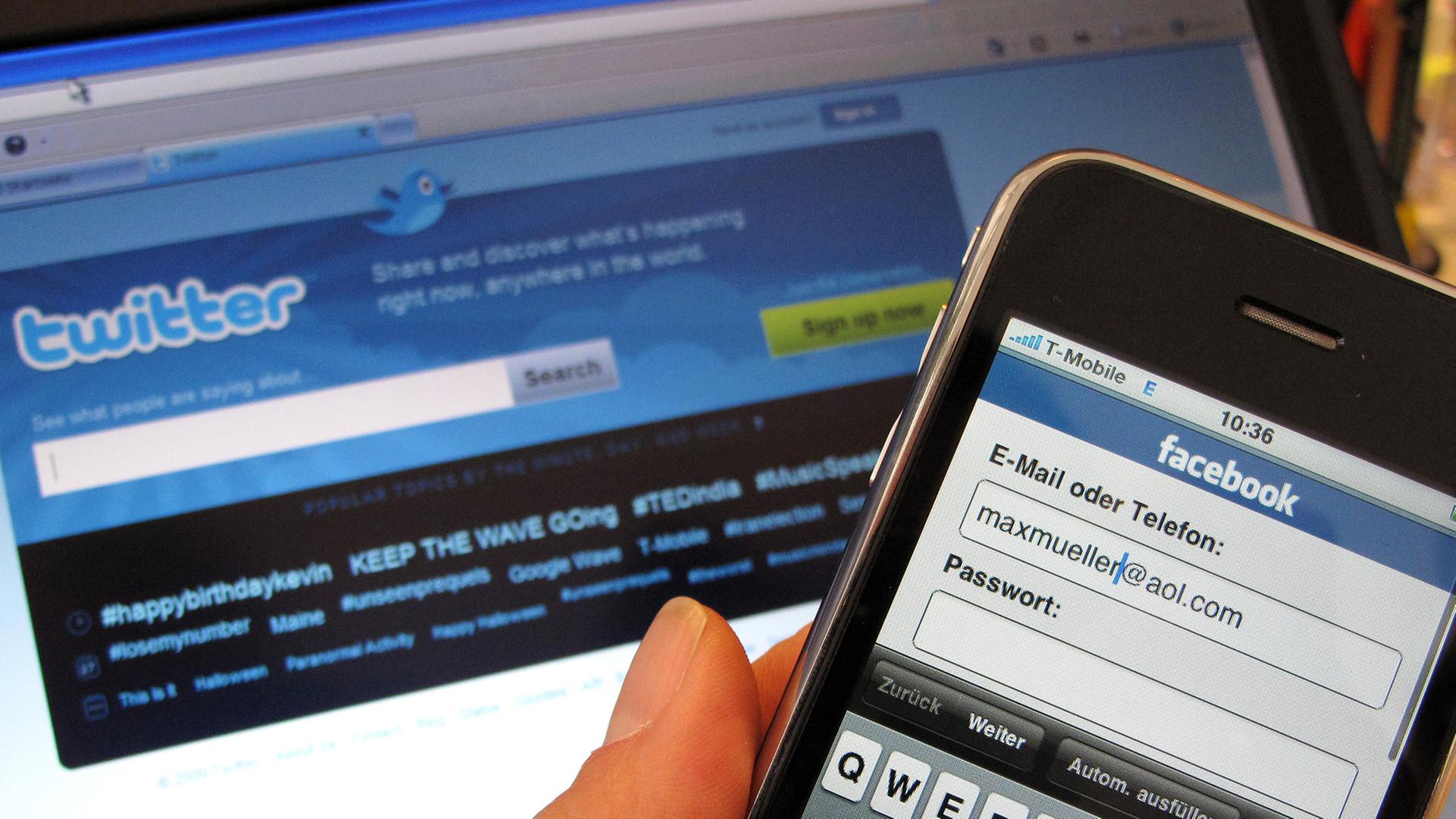
"Wir sind die 99 Prozent": Das war das Motto tausender Menschen, die sich ab Herbst 2011 zur Protestbewegung Occupy zusammen schlossen. Sie protestierten gegen soziale Ungleichheit, die sich seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise zuzuspitzen schien. Die Protestbewegung und ihre Slogans breiteten sich in weiten Teilen der Welt aus. Vehikel dieser Ausbreitung waren soziale Medien wie Facebook und Twitter, in denen Aktivisten unter anderem Videos ihrer Proteste posteten. So entstand eine neue globale soziale Bewegung.
"Ist das tatsächlich so?"
Prof. Dr. Marianne Kneuer lehrt Politikwissenschaften an der Universität Hildesheim.
"Denn eine globale soziale Bewegung würde ja bedeuten, dass sich die Aktivisten auf der ganzen Welt also nicht nur vernetzen. Sondern, dass sie eben auch ihre politischen Forderungen ihre politischen, also inhaltlich ausgerichteten Debatten, ihre Kritik an den Politikern und ihre Wünsche global ausdiskutieren und eine inhaltliche Debatte auf einer globalen Ebene stattfindet."
Empörung und Verunsicherung
Marianne Kneuer und ihr Team haben die Online-Kommunikation der sogenannten Empörungsbewegungen untersucht. Sie werteten dazu rund 1.200 Posts, also Mitteilungen von Aktivisten aus. Im Blick hatten sie dabei Protestler in fünf Ländern: die Occupy-Bewegung in Deutschland, Großbritannien und den USA sowie die Acampada in Portugal und Spanien. Der gemeinsame Nenner dieser Bewegungen ist, dass sie soziale Missstände nicht mehr akzeptieren wollten. Als Gründe dafür identifizierten sie unter anderem hohe Arbeitslosigkeit, Korruption und Banken-Spekulation. Die Posts der Aktivisten sind vor allem für Netzoptimisten ernüchternd, die glaubten, dass neue Medien der inhaltlichen politischen Auseinandersetzung neuen Schwung geben könnte.
"Unsere Vermutung ist, dass die sozialen Medien, also Facebook und Twitter, sehr stark benutzt worden sind um innerhalb dieser Occupy-Bewegung und der Acampada in Portugal und Spanien vor allen Dingen Empörung, Verunsicherung, auch Wut zu transportieren. Das heißt also eine sehr stark emotionale Komponente. Aber unsere Vermutung geht dann eben auch in die Richtung, dass diese Komponente stärker bedient worden ist als eben die inhaltliche Auseinandersetzung."
Eingängige Symbole und Slogans in englischer Sprache seien ein wesentliches Kennzeichen dieser Online-Kommunikation, sagt Doktor Saskia Richter, die zusammen mit Marianne Kneuer in Hildesheim forscht.
"Man kann sich diese weiße Maske angucken, die überall in der Occupy-Bewegung auftaucht. Oder auch 'we are the 99 percent', ein englischer Satz, der international gebraucht wird."
Diese im Gehalt eher einfachen Botschaften seien dann auch ein wesentlicher Grund dafür, dass diese Bewegungen so leicht entstehen und sich ausbreiten können.
"Weil es erstens international verstanden wird und zweitens Facebook und Twitter auch eine Kommunikationsmöglichkeit erst mal darstellen, einen Kanal darstellen, um diese internationale Kommunikation überhaupt möglich zu machen."
Niederschwellige Form der Beteiligung
Soziale Medien machen nicht nur den Protest einfacher, sondern auch die Forschung dazu, weil es einfacher als je zuvor ist, die Kommunikation der Gruppen auszuwerten. Saskia Richter und Marianne Kneuer nutzten für ihre Untersuchung die Struktur von Facebook und Twitter. Beide lassen unterschiedliche Formen des Umgangs mit Posts zu, bei Facebook heißen sie 'liking', 'sharing' und 'commenting'.
"Diese drei Stufen symbolisieren drei verschiedene Formen des Engagements, weil einen Beitrag einfach zu liken, also ein Kreuzchen zu machen, ein Häkchen zu machen oder den Button mal anzuklicken, ist natürlich eine sehr niederschwellige Form. Weil ich sehe zum Beispiel einen Text, ein Bild oder ein Video auf Facebook und dann klicke ich einfach auf den Button. Die Frage ist, ob das schon Partizipation ist. Denn ich sage einfach nur, 'das finde ich gut', 'das gefällt mir'."
Wer hingegen die Option des sharing wählt, sendet das, was gefällt weiter, beispielsweise an seine Freunde oder Arbeitskollegen. Das sei schon etwas mehr Engagement, meint Kneuer.
"Aber wirklich eine inhaltliche Auseinandersetzung kann natürlich nur passieren durch die Funktion des Kommentierens bei Facebook oder des Answerings bei Twitter. Und diese Form erfordert mehr Engagement, inhaltliche Auseinandersetzung von dem einzelnen Aktivisten oder der Aktivistin."
Diese Form der Kommunikation konnten die Forscher jedoch nur vergleichsweise selten aufspüren. Der überwiegende Teil der Interaktion sei das Liking gewesen. So scheinen die sozialen Medien - zumindest im Fall der untersuchten Bewegungen - kaum zur politisch-inhaltlichen Auseinandersetzung beizutragen. Gerade an der Occupy-Bewegung wurde das ja auch kritisiert. Sie habe eigentlich wenig mehr zu bieten, als einem generellen Gefühl des Unwohlseins Ausdruck zu verleihen. Allerdings sind gerade emotionale Botschaften gut geeignet, viele Menschen zu mobilisieren. Und das hat ganz offensichtlich geklappt.
Wie nachhaltig Bewegungen sind, die inhaltlich schwach aufgestellt sind, werde die Zukunft zeigen, meint Marianne Kneuer. Eins sei aber bereits klar:
"Dass dieser große Hype aus dem Jahre 2011 eben in der gleichen Form nicht mehr fortgesetzt worden ist. Was dann auch bestätigen würde, dass wir es mit starken Emotionalisierungsschüben zu tun haben in den sozialen Medien, wo dann eben tatsächlich global sehr schnell und sehr intensiv solche Eindrücke und Gefühle und Affekte eben transportiert werden können über die sozialen Medien. Was dann aber genauso schnell wieder auch abflacht, wie es eben gekommen ist."
"Keine langfristig angelegte Beteiligung"
Trotzdem wäre es verfehlt, aus der Online-Kommunikation generelle Rückschlüsse auf die Bewegungen zu ziehen. Denn die untersuchten Proteste haben natürlich auch immer einen wesentlichen Offline-Aspekt. Die Protestcamps im New Yorker Zuccotti Park oder auf der Puerta del Sol, einem Platz in Madrid, hat es ja tatsächlich geben. Hier versammelten sich tausende Menschen. Zwar sind die Aktivisten nicht mehr so sichtbar, ganz verschwunden seien sie aber auch nicht, sagt Kneuer.
"Es gibt weiterhin natürlich diese Bewegungen, die auch weiterhin natürlich in den sozialen Medien präsent sind. Wenn man sich jetzt Spanien und Portugal anschaut, kann man ganz gut sehen, dass ein Kern der Bewegung weiterhin politisch aktiv ist, dass die Parteien gegründet haben und weiter in die Politik wirken wollen. Das ist dann so ein Kern, der sich eben weiterhin mit dem Thema beschäftigt und sich politisch engagiert."
Dennoch spiegelt die Online-Kommunikation der Empörungsbewegungen auch einen generellen Trend wider. Politikwissenschaftler beobachten seit Jahren, dass sich die politische Beteiligung verändert.
"Es ist eben nicht mehr die Partizipation, die wir noch aus den 50er-, 60er-, 70er-Jahren kennen. Sondern es ist eine kurzfristige, problemorientierte, betroffenheitsorientierte und teilweise sehr intensive, nicht nachhaltig und langfristig angelegte Beteiligung. Aber man kann nicht sagen, dass die Bürger sich gar nicht beteiligen. Sie beteiligen sich anders."

