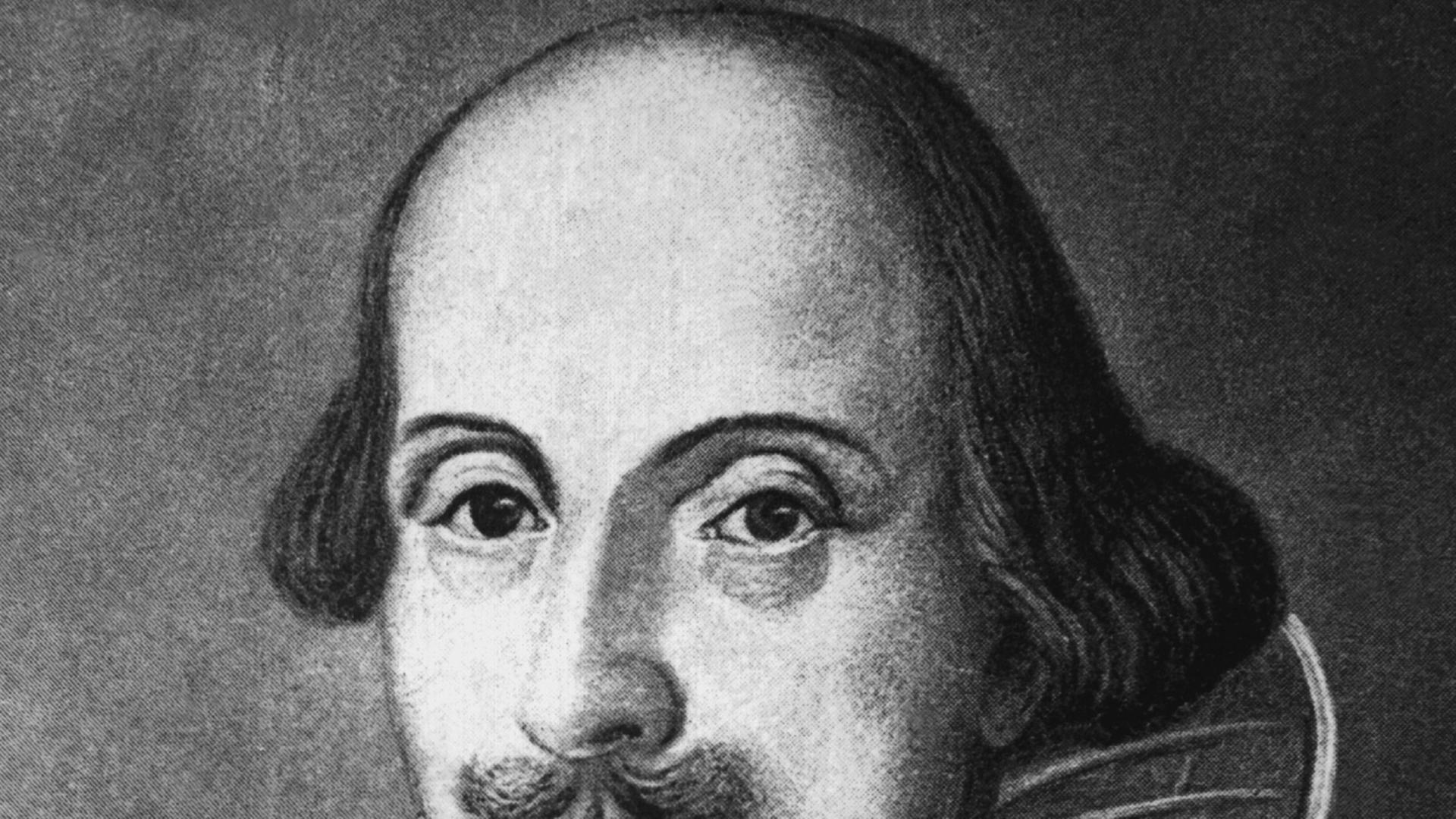
Tanya Lieske: Herr Günther, seit den 70er-Jahren übersetzen Sie William Shakespeares Gesamtwerk, 39 Bände sollen es werden. Sie sind in der Zielgeraden. Was wird das letzte Werk auf ihrem Tisch sein?
Frank Günther: Das letzte Werk werden Apokryphe Gedichte sein, die Shakespeare hinterlassen hat. Das am wenigsten Bekannte oder das Fragwürdigste kommt zuletzt. Aber es sind noch zweieinhalb Dramen und 154 Sonette, und wenn Sie sich überlegen, dass ich für ein Sonett zwei Tage brauche, was, wie ich finde eine faires Zeitmaß ist, bin ich bei 154 Sonetten, Urlaub, Weihnachten und Wochenenden abgezogen bei einem Jahr Arbeit. Es dauert also noch ein bisschen bis ich fertig bin.
Lieske: Wie haben Sie sich die Dramen eingeteilt, sind Sie chronologisch vorgegangen?
Günther: Nein, es waren zumeist Auftragsarbeiten, und so ging das ganz unchronologisch und ohne Plan, späte Stücke, frühe Stücke, mittlere Stücke, wie es halt gerade bestellt wurde, da war kein großes Konzept dahinter.
Lieske: Als Sie anfingen, in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, waren sie selbst noch am Theater. Was war denn der springende Moment, wann haben Sie sich für Shakespeare entzündet?
Günther: Nachdem ich das erste Stück übersetzt hatte, vorher nicht. Ich hatte nicht die geringste Absicht jemals eine Shakespeare-Vollübersetzung zu machen. Ich habe nebenbei, weil ich ganz gerne übersetze, neben dem Theater verschiedene Shakespeare-Zeitgenossen übersetzt, Ben Johnson usw. Die hatte ein Theaterverlag übernommen, wurden jedoch nie gespielt, es sind auch Stücke, die nicht wahnsinnig bedeutend sind. Dann meinte der Verlag aber ich sollte jetzt Shakespeare übersetzen, worauf ich meinte: "Obelix, tok tok tok", warum soll ich das können, wenn es doch so viele deutsche Dichter auch schont nicht gekonnt haben? Aber dann habe ich doch ein Stück übersetzt, das war ziemlich wie im Rausch, das erste Mal. Ich habe mich mehr gefürchtet, als dass ich da Spaß dran hatte, da bin ich durch das Stück durchgedonnert wie ein D-Zug, und das wurde dann die erste Übersetzung.
Lieske: Was war das erste Stück, und was war der Rausch, was ist da passiert?
Günther: Das erste Stück war "Viel Lärm um nichts", eine Komödie, in der sehr viel gekalauert wird, in der sehr viele dumme Witze gerissen werden. Das war ganz seltsam, weil ich in den ersten zwei Wochen, in denen ich das gemacht habe, alle Entscheidungen bis heute beibehalten habe. Zum Beispiel, dass ein Witz, der zu Shakespeares Zeiten witzig war, auch heute noch witzig sein muss. Das ist ein bisschen schwierig, denn mit Witzen ist es ein bisschen wie mit dem Kölner Karneval. Mainz, wie es singt und lacht von 1965 ist heute auch nicht mehr sehr komisch, und Witze von Shakespeare von vor 400 Jahren sind heute natürlich auch ein bisschen abgestanden. Aber dass das mal witzig war, dass das Pointen waren, die das Haus zum Brüllen gebracht haben, und dass diese Wirkungsästhetik heute in irgendeiner Wirkung wieder stattfinden muss, das ist mir sehr wichtig.
Lieske: Sie machen das ja jetzt seit mehr als 40 Jahren. Ich stelle mir vor, dass das auch 40 Jahre sind, in denen Sie tatsächlich in zwei Sprachen und möglicherweise auch in zwei Welten zuhause waren oder sind, ist das richtig?
Günther: Ja, Shakespeare ist seit 40 Jahren mein Tag- und Nachtgenosse, sozusagen mein Bettgenosse. Wenn ich abends die Schreibtischlampe ausmache, kann ich ihn leider nicht ausknipsen, vor allen Dingen, wenn ich gerade wieder an unübersetzbaren Sätzen gescheitert bin. Er begleitet mich also auch aufs Kopfkissen, und ich wache dann am nächsten Morgen mit ihm auf. Er ist also sozusagen mein Lebensgefährte, seit 40 Jahren.
Lieske: Das 16. Jahrhundert, in das Sie sich ja zurückbeamen, war eine Zeit großen Umbruchs. Sie beschreiben das sehr ausführlich, aber vielleicht noch mal in Kürze für unsere Hörer, was war damals los?
Günther: Es war eine sehr grobe und sehr grausame Zeit des ausgehenden Mittelalters, sie war überwölbt von einem absoluten christlichen Glauben in katholischer und protestantischer Fundamentalausführung. Es war eine Zeit des sich ausbildenden Absolutismus, der die königliche Macht verstärkte, es war eine Zeit des Faustrechts, von Willkürjustiz. Es war eine Zeit, in der das Durchschnittsalter 25 Jahre betrug, in den ärmeren Vierteln Londons konnte man mit 20 Jahren rechnen. Wer 40 war, für den begann das Alter. Als Shakespeare mit 52 Jahren starb, hatte er seine jüngeren Brüder schon um mehrere Jahre überlebt. Man konnte innerhalb kürzester Zeit an allen möglichen Krankheiten sterben, die Pest griff um sich. Zwei Monate nach Shakespeares Geburt brach die Pest in Stratford aus, die Chancen, dass er überlebt hat, waren gering. In den Theatern spielte er inmitten von 3000 Leuten. Theater mit solchen Menschenansammlungen waren Säuchenherde. Sie wurden geschlossen, wenn die Pest zu viele Tote forderte. Die Zeit war grausam, brutal und sehr spannend.
Lieske: Es ist eine Zeit gewesen, die auf uns heute einen fast magischen Eindruck macht. Hat das damit zu tun, dass unsere Welt heute so sauber, so berechenbar geworden ist, dass wir unsere Rente zahlen, ungefähr ausrechnen können wie lange wir leben werden, dass das Schicksal scheinbar verschwunden ist?
Günther: Wir erfinden uns ja ständig neue grausame Schicksale. Bei jedem neuen Lebensmittelskandal, bei dem in Eiern entfernte Giftstoffe gefunden werden, geht für uns die Welt unter. Von einer Zeit wie es das Elisabethanische Zeitalter war, das grausam, kurz, brutal, unangenehm war, geht sicherlich auch dadurch eine Faszination aus, weil es scheinbar so wesentlich war. Je "gepamperter" man ist, desto schlaffer und gleichgültiger wird ja eigentlich das Dasein, und die Zeit der großen Gestalten, der großen Gefühle sehen wir gerne in solchen Zeiten, in denen der Tot einem eigentlich täglich über die Schulter geschaut hat.
Lieske: Das war ja auch eine sehr besondere Sprache. Das Englisch, das sich damals ja formte, das noch nicht die Gestalt von heute hat. Auch das beschreiben sie sehr anschaulich. Eine vieldeutige, eine quecksilbrige, eine polymorphe Sprache. Was war das Besondere daran?
Günther: Das Besondere war, dass das Englische eigentlich gerade erst erfunden wurde. Seit beginn des 16. Jahrhunderts kam man auf die Idee, dass die Englische Sprache, die ja aus dem Alt-Englischen bestand, sowie aus den Französischen Einflüssen, Französisch war ja die Sprache seit William the Conquerer, dass dieses Englische, was sich herausbildete, eigentlich gar nicht so flexibel und so weich und formbar und ausdrucksfähig war wie die Festlandssprachen, die sich von dem Lateinischen und Griechischen ableiteten. Wenn man Lateinisch ins Englische übersetzen wollte, wenn man also von der Sprache der Gelehrten, der Kirche und der Bildung in die Volkssprache hineinwollte, bot die Englische Sprache gar keine Möglichkeiten. Also wurde das Englische umgeformt, man erfand unglaublich viele neue Worte im Laufe des 16. Jahrhunderts, der Wortschatz vergrößerte sich um fast 200 Prozent, weil für die dümmsten Alltagsgeschichten plötzlich gebildete Ausdrücke erfunden wurden, abgeleitet aus dem Griechischen zum Beispiel ein Begriff für Unkrautjäten. Es fand also ein großer Umbruch in der Sprache statt, Sprache wurde täglich neu erfunden, neu gebildet, im Gespräch zwischen den verschiedensten Schichten des Volkes. Es gab keine Regel, es gab kein Wörterbuch: Shakespeare besaß kein Wörterbuch, weil es eigentlich noch kein ausgeformtes Englisch gab.
Lieske: Dieses Sprachfaszinosum ist dann ja auch irgendwann in Deutschland eingeschlagen. Sie zitieren Goethe: "Die erste Seite, die ich in ihm las machte mich auf zeitlebens ihm eigen, und wie ich mit dem ersten Stücke fertig war, stund ich wie ein Blindgeborener, dem ein Wunderland das Gesicht in einem Augenblicke schenkt." Also viel "Ich" drin, es spricht wie immer Goethe, aber immerhin, der Großmeister ist beeindruckt. So geht es ja vielen Leuten, wenn man Shakespeare mal liest, gibt es so eine Zündung.
Günther: Was Goethe beeindruckt hat, war nicht nur die Sprache. Bis dahin gab es ja eine Regelliteratur in Deutschland, es gab den Literaturpapst Gottsched, der die Sprache nach Französischen Grundsätzen, der Einheit von Ort Zeit und Handlung geregelt hatte, der vorgeschrieben hatte, wie man Dichtung herstellt, also Bastelanweisungen, wie man Poesie zusammenrührt. Diese Regeln aus dem Französischen Dichtungskanon entnommen wurden als zunehmend beengend empfunden. Nun hatte Lessing diesen Shakespeare entdeckt, der der Regelsprengende war, der anscheinend keine Regeln kannte, der gegen Ort-Zeit-Handlungseinheiten radikal verstieß, der in seinen Stücken in der Zeit sprang, in den Orten sprang, der chaotisch war, der anarchisch war, und dieses Anarchische daran war das, was Goethe faszinierte, weil in diesem scheinbaren Anarchismus eine Befreiung lag von den beengten literarischen, politischen und sozialen Verhältnissen, die seine Zeit gekennzeichnet hatten. So wurde Shakespeare für ihn zu einem quasi-religiösen Erweckungserlebnis, das ihn zu solchen egomanischen Exzessen getrieben hat, wie diese Rede zum Shakespeare-Tag.
Lieske: Irgendwann wurde ja dann auch behauptet, der Shakespear'sche Geist sei eigentlich ein deutscher Geist, man sagte, er sei eigentlich nur durch Zufall auf dieser grauen Insel geboren worden, sei aber einer der Unseren. Wie kam es dazu und was ist davon zu halten?
Günther: Naja, das war in einem besonderen Moment der deutschen Geschichte möglich. Hundert Jahre vorher oder nachher wäre das vermutlich nicht möglich gewesen. Es war dieser Augenblick, wo das sich emanzipierende Bürgertum nach Befreiung und nach Selbstständigkeit drängte. Es gab ja zum Beispiel davor die Ständeklausel, das heißt, Tragödien durften nur von Adeligen handeln, weil nur adelige Menschen große Menschen waren und nur große Menschen können tragisch stürzen. Bürger haben nur kleine, lächerliche Themen, die haben keine Tragik, können auch nicht stürzen. Also sind Bürger nur das Thema in Komödien. Das emanzipierende Bürgertum hat natürlich auch sein Anrecht auf das tragische Erleben der Welt eingeklagt. In dieser Situation war nun plötzlich ein Autor, der Könige und Bettler, und Wahnsinnige und Verliebte, und Verrückte und Mörder alle zugleich in einer Szene auf die Bühne brachte, der keine Klassenschranken scheinbar kannte, obwohl Klassen natürlich vorhanden waren, der aber keine Berührungsängste in dem Sinne hatte, sondern ein Weltpanorama geschaffen hat, in dem alle ihren Platz hatten, und in dem alle im Widerspruch zueinander standen. Dies hatte eine unglaubliche Faszination, weil es etwas war, was es in Deutschland nicht gab, und dieses emanzipative Bemühen des Bürgertums vor der Französischen Revolution fand sich plötzlich in dem Helden Shakespeare wieder, in der Art wie er gedichtet und geschrieben hat.
Lieske: Er ragt also hinein in ein sich emanzipierendes Bürgertum, er war der Dichter zur Politik?
Günther: So wurde er zumindest empfunden. Ob er das war oder nicht steht dahin, aber das war wie er begriffen wurde, wie er eigentlich das Zustandekommen eines deutschen Nationalgefühls mitgefördert hat, oder eben dazu benutzt wurde, je nachdem wie man das sehen will.
Lieske: Sie beschreiben das sehr anschaulich in ihrem Buch "Unser Shakespeare". Auf zwei Punkte möchte ich noch einmal genauer eingehen: Das eine ist, dass man sehr jung starb, mit 40 oder 50 Jahren galt man eigentlich schon ein alter Mensch. Das Andere: Bis zu 80 Prozent Analphabeten lebten damals in Shakespeares Welt. Die Frage ist, für wen hat er damals Theater gemacht, und muss man sich das wie ein Trivialtheater vorstellen, war es Trivialliteratur?
Günther: Ja. Es hat wesentlich mehr Ähnlichkeit mit Andrew Lloyd Webbers "Cats", das in Theaterhallen in Vorstädten von kommerziellen Theaterunternehmern aufgebaut wird, als mit bürgerlichen Kulturtheatern, die ein deutsches Nationaltheater betrieben haben. Shakespeares Stücke dienten primär der Unterhaltung. Nachmittags, um zwei wurden die Fahnen hochgezogen, heute wird gespielt. Auf der Nordseite der Themse sahen die Leute: Die Fahne geht hoch. Die Handwerker und Lehrlinge ließen ihre Arbeit liegen und sind über die Themse in die Theater, um etwas Neues zu erfahren: Unterhaltung, Amüsement, Dramen, Komödien, Schlägereien, Wahnsinnsszenen, Mord und Totschlag, Schlächtereien, Splatter, was man wollte. Es war ein buntes Unterhaltungstheater, das die Leute anzog, das aber natürlich auch von ihrer eigenen Welt erzählt hat. Der Analphabetismus hat den Leuten ja nicht erlaubt, ihre eigene Geschichte zu kennen. Indem Shakespeare zum Beispiel die Geschichte der Rosenkriege, also englische Geschichte, fürs Theater aufbereitet hat. Das war natürlich wahnsinnig spannend, weil diese Erzählungen neu waren. Es traf sich Unterhaltungsbedürfnis und Erzählungen von fernen Welten: Francis Drake hatte die Welt umsegelt, die Spanische Armada war geschlagen worden. Die alten Grenzen wurden gesprengt, die Abenteurer zogen in neue Welten. Es waren neue Welten der Fantasie. Es waren neue Welten der Innenshow. Das Individuum war nicht abgeschlossen und fertig, sondern wurde wie in Hamlet als Werdendes begriffen. Es wurden Seelenlandschaften ausgebreitet, in denen die Abgründe des menschlichen Individuums gezeigt wurden. Lauter sehr spannende Themen, die aber immer im Bereich der Unterhaltung lagen.
Lieske: Showbusiness, Musical, Fantasy, all das klingt an, indem was sie sagen. Er hat ja nun mit Romeo und Julia auch ein Stück geschrieben, in dem wirklich fast noch Kinder eine Hauptrolle spielten. Mir hat man damals an der Universität gesagt, Shakespeare hätte das Phänomen der Pubertät gefunden oder erfunden oder entdeckt. Stimmt das so?
Günther: Romeo und Julia ist ja die berühmte Einstiegsdroge für Shakespeare, also für Kinder. Für Jugendliche denen gesagt wird: "Hier werden eure Probleme geschildert." Also "Boy meets girl, falls in love, und das Ganze geht furchtbar tragisch aus." Nun ist das ja nicht unbedingt für alle Zeiten das richtige Thema, also ich nehme mal an, dass der heutige Vierzehn- bis Fünfzehnjährige eher peinlich berührt ist, wenn er Romeo und Julia lesen muss, weil der dort praktizierte Romantizismus nicht mehr unbedingt die eigene Lebenswirklichkeit schildern muss. Was aber an diesem Stück so faszinierend ist, ist dass es von so vielen Arten der Liebe erzählt. Nicht nur von der romantischen, sondern das Stück Romeo und Julia hat die meisten Verbalsauereien im ganzen Shakespeare-Kanon. Man hat es nachgezählt, nirgendwo wird so deftig rumgeferkelt, sprachlich rumgehurt, wie in Romeo und Julia. Die große Tragödie ist zur Hälfte des Stückes eigentlich ein Schenkelklopfer. Man lacht sich also eigentlich scheckig, über Absurditäten, über Verbalpornografie, und gleichzeitig ist es aber auch die große Liebestragödie. Diese große Liebestragödie, die große Liebe, wird aber auch auf vielfältige Arten erzählt. Sie wird auf die Art des Kitsches erzählt, nämlich mit den Kitschfloskeln der petrarkistischen Liebeslyrik. Aber da, wo von petrarkistischer Liebeslyrik geredet wird, wird immer festgestellt, dass das gar nicht die wahre Liebe ist. Die wahre Liebe äußert sich ganz anders, also direkt, persönlich. In den verschiedenen Sprachformen, die dieses Stück hat, gibt es vielfältige Splitter, die von den vielfältigen Formen erzählen, die Lieben annehmen kann. Von der deftig pornografischen, bis zur verkitschten, bis zum tatsächlich großen existenziellen Erlebnis. Eine Vielfalt von Liebeserfahrungen, die selbstverständlich für alle Zeiten eine gewisse Gültigkeit hat, auch wenn man sich durch die scheinbar historischen Verkleidungen der Oberfläche erst mal ein bisschen durcharbeiten muss.
Lieske: Das klingt jetzt fast schon so wie ein postmoderner Angang, den er damals gemacht hat. Er hat alles zitiert, was an Auffassungen zur Liebe da war.
Günther: Das ist immer das Verblüffende an Shakespeare, dass er eben nicht nur eine Geschichte erzählt hat, er erzählt sie nicht nur aus einem Blickwinkel, wie das heute oft gemacht wird. Shakespeares Besonderheit ist dieser Multi-Perspektivismus, eine Geschichte wird immer wieder erzählt in einem Stück, aber in den vielfältigsten Formen, gebrochen, gespiegelt, reflektiert, und nimmt die unterschiedlichsten Aussagen an.
Lieske: Romeo und Julia als Einstiegsdroge, was meinen Sie könnte denn dann folgen für den jungen Shakespeare-Fan?
Günther: Naja, in der Schule folgt dann meistens Macbeth, es wird dann als Einstiegsdroge in die Tragödien gegeben. Macbeth hat den großen Vorteil, dass es sehr kurz ist, gut und böse sind relativ klar erkennbar, der eine ist der Mörder und der andere ist der Ermordete. Das lässt sich also scheinbar leicht überschauen. Das sieht aber nur am Anfang so aus, denn, was das Seltsame an diesem Stück ist, ist, dass Hexen auftreten. Es treten metaphysische Mächte auf, die sich in dem Stück ausbreiten. Heute glauben wir nicht mehr an metaphysische Kräfte, wie gehen wir nun aber mit den Hexen eigentlich um? Wie kann das sein, dass ein numinoses Schicksal in der Luft ist und die Handlungen der Menschen beeinflusst? Wenn man dann anfängt darüber nachzudenken, dann wird die Einstiegsdroge Macbeth, die auf den ersten Blick so säuberlich und einfach aussieht, von Schritt zu Schritt komplizierter. Das Stück wirft zu allen möglichen Themen fragen auf: Die merkwürdigsten Dinge wie Schicksal, numinose Mächte, wo ist ein Mensch verantwortlich für das was er tut und wofür kann er nichts mehr ausrichten, und so weiter. Das Stück wirft all diese Fragen auf, die man auf den ersten Blick so in der Schuld gar nicht sieht.
Lieske: Es gibt ja die Shakespeare Übersetzung von Schlegel, der ihm einen romantischen Duktus gegeben hat. Ihrer ist heutiger, aber trotzdem rhythmisch.
Günther: Wenn es so klingt, freut mich. So sehr anders rhythmisch als das Original ist es gar nicht. Ich versuche, mich an die Sprachgestalt des Originals so weit wie möglich heranzuarbeiten. Das bedeutet natürlich, dass es nicht nur um den Inhalt eines Satzes geht, welcher meist recht überschaubar ist. Es geht vielmehr um das Phänomen der Form eines Satzes, dass die Form mehr erzählt, als das es der reine semantische Inhalt eines Satzes tut. Zu der formalen Gestalt eines Textes gehören Dinge wie zum Beispiel der Blankvers, wie das Metrum und die Rhythmen, über denen dann die Melodie eines Satzes schwebt und fliegt. Wichtig ist auch, dass dies alles eine Direktheit hat, die sofort nachvollzogen werden kann. Dass man dem Text gleich sofort folgen kann, ist das heiße Bemühen, mit dem ich mich den Texten widme.
Lieske: Wenn man sich den Shakespeare heute aneignen will, gibt es ja jede Menge Literatur auf dem Markt. Drei Werke habe ich sie gebeten zu begutachten, zu empfehlen, oder eben auch nicht. Ich beginne mal mit Bill Brysons, "Shakespeare, wie ich ihn sehe", im Goldmann Verlag erschienen. Man sieht Shakespeare vorne mit einer Sonnenbrille auf dem Cover. Es mutet ja etwas heutig an, ein bisschen fetzig. Was ist von dieser Biografie zu halten?
Günther: Das Titelbild muss man nicht so ernst nehmen, das ist so ein bisschen mit der Wurst nach der Speckseite geschmissen. Der Text ist aber sehr lustig und sehr schön. Bill Bryson ist ein Amerikaner, der in England lebt, und hat sich auf die Suche nach Shakespeares Biografie gemacht, und danach was man von ihm wirklich weiß. Auf der Suche, von dem was man wirklich weiß, ist das Buch relativ dünn geworden, weil er festgestellt hat, dass man ja doch eher sehr wenig von ihm weiß, und so schreibt er mehr von seiner Suche nach Shakespeares Biografie und wo sie immer endet, nämlich dass ihm immer einer sagt: „Tja, aber ob das wirklich so ist, wissen wir nicht."
Lieske: Nun, sie haben ja gesagt, je dünner, desto seriöser ist die Shakespeare-Biografie. Das erfüllt Bryson ja in jedem Fall.
Günther: Ja, absolut.
Lieske: Mary und Charles Lamb waren zwei Geschwister, die in London einen literarischen Salon hatten. Sie gehören zum Umfeld der englischen Romantik, und haben 1807 eine Nacherzählung Shakespeares, damals für Kinder veröffentlicht. Dies wurde jetzt übersetzt und ist im Aufbau-Verlag erschienen unter dem Titel: „Shakespeare für Eilige".
Günther: Diese alten Erzählungen sind von 1807, und haben den Nachteil, dass sie Shakespeares Erzählungen märchenhaft wiedergeben. Sie erzählen sie eigentlich für Kinder. Das heißt, sie sind gereinigte Erzählungen, denen alle Ecken und Kanten, die Shakespeares Erzählungen eigentlich aufregend machen, fehlen. Ob das für Eilige das Richtige ist, weiß ich nicht, sie erfahren Shakespeares Stücke nur aus dem Munde eines Märchenerzählers.
Lieske: An der dritten Stelle ist Neil MacGregor, er ist der Direktor des British Museums und hat nun die deutsche Ausgabe "Shakespeares ruhelose Welt" veröffentlicht. Das ist sehr interessant, denn er erzählt die Zeit nun wieder anhand von Gegenständen, man sieht einen Degen, eine Gabel, einen Kelch. Was hat er vor, was tut er?
Günther: Das ist ein sehr schönes Buch. Er nimmt Gegenstände, die aus dem Shakespeare-Bereich stammen. Zum Beispiel findet er eine Gabel in den Grundmauern des Rose-Theaters. Diese Gabel war fein gearbeitet, sie war zweizinkig, und gehörte ersichtlich einem Adeligen. Dass sie einem Adeligen gehörte, weiß man deswegen, weil nur Adelige Gabeln besaßen. Die Gabel war nämlich eine neue Erfindung: Bis dahin aß man nur mit den Händen oder mit den Messern, in Shakespeares Zeiten. Als die Gabel erfunden wurde, wurde sie zu einem preziösen Gegenstand, den ein Adeliger hatte, und man begann plötzlich damit preziös das Essen aufzuspießen. Das war ganz was Neues, ganz was Modisches, ganz was Eitles. Der Adelige, der seine Gabel im Theater verloren hatte, wird sicherlich sehr traurig gewesen sein, dass das teure Teil weg war. Und so erzählt Neil MacGregor mithilfe dieser Gegenstände von den vielen verschiedenen Eigenheiten dieser Epoche.
Lieske: Shakespeare wird fast so oft zitiert wie die Bibel, was wäre denn ihr liebster Shakespeare-Slogan?
Günther: Ich habe 60.000 Blankverse mit Shakespeare-Slogans übersetzt, welcher ist mein Lieblingsslogan? Sagen wir den von einer ganz seltsamen Figur aus dem Stück „Maß für Maß". Es ist eine Figur, die drei Zeilen Text hat, der Betreffende ist ein Mörder und Räuber, er ist zum Tode verurteilt und wird gleich hingerichtet. Man sagt über ihn: "Wer ist das denn, was ist das denn für einer?", und da sagt einer den seltsamen Satz: "Es ist ein Mensch, achtlos vor dem, was war, ist oder kommt."
Lieske: Auf das uns das nicht passiere. Vielen Dank, Frank Günther, ihr Werk "Unser Shakespeare", erschienen im DTV-Verlag.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Bücherliste:
Frank Günther: "Unser Shakespeare". dtv Verlag
Bill Bryson: "Shakespeare wie ich ihn sehe". Goldmann Verlag
Mary und Charles Lamb: "Shakespeare Geschichten – die besten 20 Stücke neu erzählt. Aufbau TB
Neil Mac Gregor: "Shakespeares ruhelose Welt". C.H.Beck
Frank Günther: "Unser Shakespeare". dtv Verlag
Bill Bryson: "Shakespeare wie ich ihn sehe". Goldmann Verlag
Mary und Charles Lamb: "Shakespeare Geschichten – die besten 20 Stücke neu erzählt. Aufbau TB
Neil Mac Gregor: "Shakespeares ruhelose Welt". C.H.Beck



