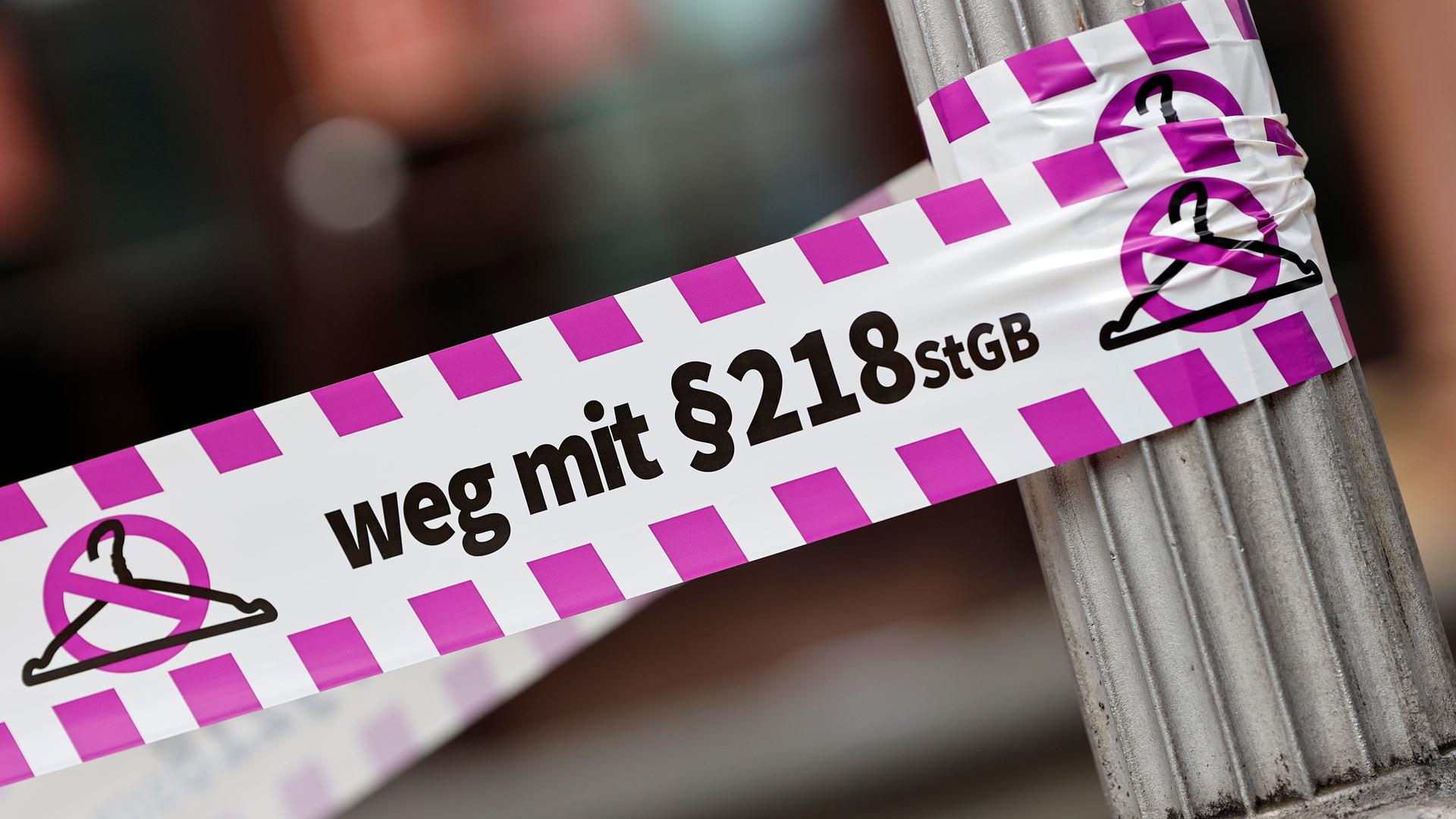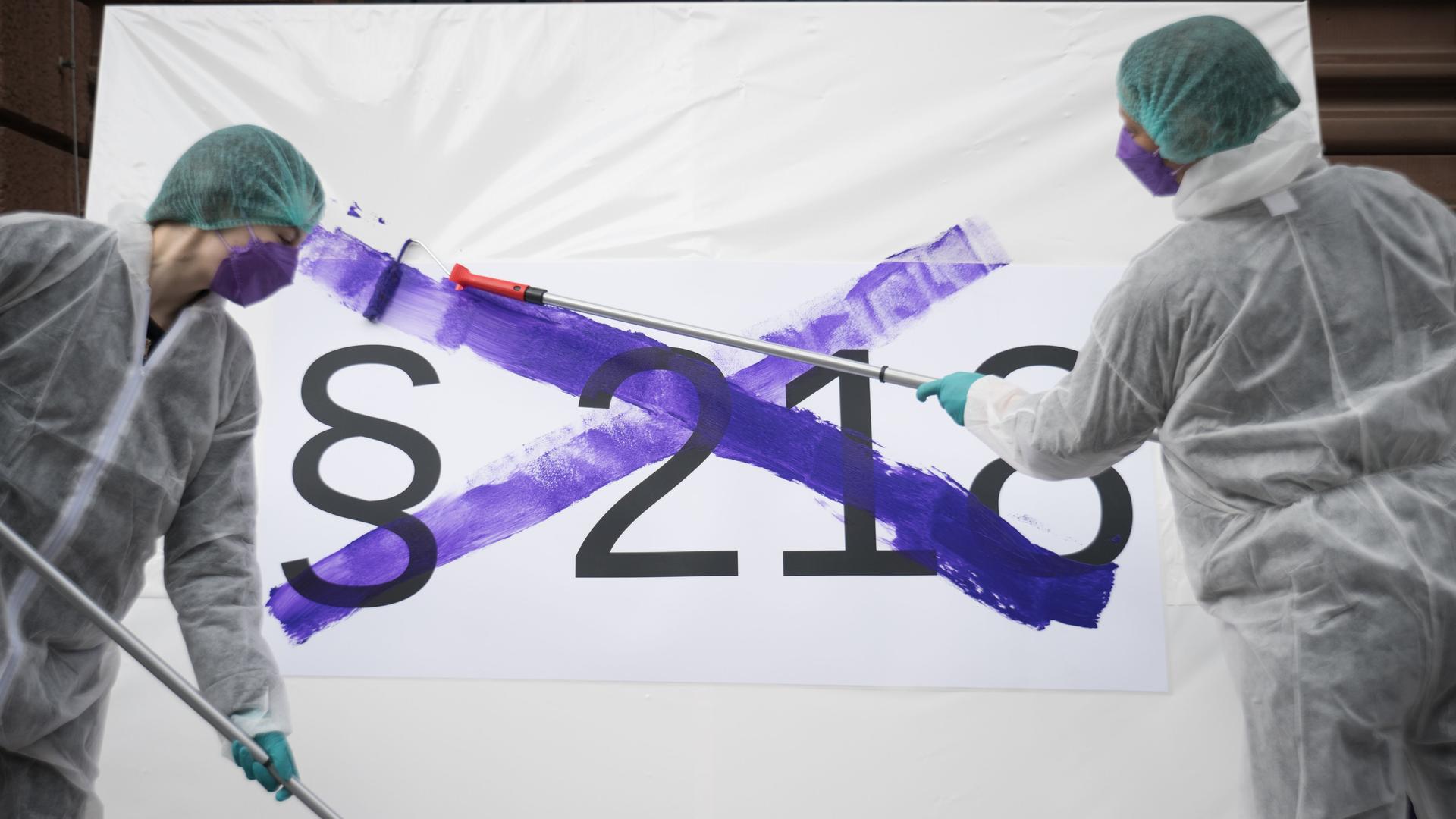
Wenn Frauen in Deutschland abtreiben, machen sie sich strafbar, werden in der Regel aber nicht bestraft. Um diesen Widerspruch herum gibt es eine gesellschaftspolitische Debatte, in der sich - grob skizziert - zwei Lager gegenüberstehen: Das eine will Abtreibungen entkriminalisieren, das andere plädiert dafür, die Rechtslage so zu lassen, wie sie im Moment ist.
Die ehemalige Ampelregierung hatte zu dieser Frage eine Expertenkommission eingesetzt: Diese empfahl im April 2024 die Entkriminalisierung von Abtreibungen. Von vielen mit dem Thema beschäftigten Verbänden kommen ähnliche Forderungen. Auch die Grünen sind dafür. CDU, katholische Kirche und Caritas stehen auf der anderen Seite.
Befürworter einer Reform des Abtreibungsrechts hatten darauf gehofft, dass noch vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar 2025 über einen entsprechenden Gesetzentwurf abgestimmt würde. Doch im Rechtsausschuss fand sich keine Mehrheit, um das Thema noch vor der Wahl auf die Tagesordnung des Parlaments zu setzen.
Mit der Konstituierung des neuen Bundestags am 25. März wurden alle noch offenen Gesetzentwürfe hinfällig. Nun muss sich die aktuelle Bundesregierung aus Union und SPD mit dem Thema beschäftigen. Eine Formulierung im Koalitionsvertrag sorgt bereits für Streit.
Inhalt
- Wie ist die derzeitige rechtliche Lage in Deutschland?
- Was steht im Koalitionsvertrag von Union und SPD zum Thema Schwangerschaftsabbruch?
- Was hat die von der ehemaligen Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission empfohlen?
- Wie reagieren Parteien, Kirchen und Verbände auf Überlegungen, Abtreibungen zu entkriminalisieren?
- Was wurde politisch zuletzt getan, um den Umgang mit Abtreibungen zu verändern?
- Wie läuft ein Schwangerschaftsabbruch ab?
- Wie denken die Bürgerinnen und Bürger über die mögliche Änderung des Paragrafen 218?
Wie ist die derzeitige rechtliche Lage in Deutschland?
Derzeit gelten für Abtreibungen die in Paragraf 218 des Strafgesetzbuches festgeschriebenen Regeln. Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig.
Er bleibt jedoch straffrei, wenn er in den ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft vorgenommen wird. Die schwangere Frau muss sich außerdem zuvor beraten lassen. Ausdrücklich nicht rechtswidrig ist eine Abtreibung nach einer Vergewaltigung und bei Gefahren für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der Schwangeren.
Als grundlegend für den hiesigen Umgang mit Abtreibungen gilt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1993. Damals kippte das Gericht eine im Jahr zuvor vom Bundestag beschlossene gesamtdeutsche Fristenregelung. Das Grundgesetz verpflichte den Staat, menschliches Leben – auch das ungeborene – zu schützen, hieß es aus Karlsruhe.
Was steht im Koalitionsvertrag von Union und SPD zum Thema Schwangerschaftsabbruch?
Im Koalitionsvertrag heißt es zu Schwangerschaftsabbrüchen: „Für Frauen in Konfliktsituationen wollen wir den Zugang zu medizinisch sicherer und wohnortnaher Versorgung ermöglichen. Wir erweitern dabei die Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung über die heutigen Regelungen hinaus.“
Bisher zahlen die Kassen den mehrere Hundert Euro teuren Eingriff nur bei medizinischer Indikation oder nach einer Vergewaltigung. Außerdem gibt es Möglichkeiten der Kostenübernahme für Frauen mit geringem Einkommen.
Die SPD-Rechtspolitikerin Carmen Wegge sagte der „Welt“, sie verstehe den Koalitionsvertrag so, dass Abtreibung eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse werden soll. „Dafür wäre es tatsächlich erforderlich, den Schwangerschaftsabbruch in der Frühphase zu legalisieren, weil rechtswidrige Eingriffe nicht über die Krankenkassen finanziert werden können.“
Dagegen sagte die CDU-Abgeordnete Elisabeth Winkelmeier-Becker dem „Focus“, in der Koalition sei vereinbart worden, den Strafrechtsparagrafen 218 unverändert zu lassen und das ungeborene Leben bestmöglich zu schützen.
Was hat die von der ehemaligen Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission empfohlen?
Die damalige Ampelkoalition hatte im März 2023 eine Expertenkommission eingesetzt, um zu klären, ob Schwangerschaftsabbrüche entkriminalisiert werden sollen. 15 Frauen und drei Männer aus den Bereichen Ethik, Medizin und Recht wurden berufen.
Die Expertinnen und Experten empfahlen dann, Abtreibungen künftig in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen grundsätzlich zu erlauben. Ein generelles Verbot der Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft sei nicht haltbar. Die aktuellen Regelungen im Strafgesetzbuch hielten einer „verfassungsrechtlichen, völkerrechtlichen und europarechtlichen Prüfung“ nicht stand.
In der mittleren Phase der Schwangerschaft – etwa von Woche zwölf bis 22 – könne der Gesetzgeber entscheiden, unter welchen Voraussetzungen eine Abtreibung straffrei sein soll. Sobald der Fötus eigenständig lebensfähig ist, sollten Abbrüche nach Ansicht der Kommission weiterhin verboten bleiben. Diese Grenze liege ungefähr in der 22. Schwangerschaftswoche.
Bei einer Vergewaltigung oder falls medizinische Indikatoren vorliegen, sollte es demnach weiterhin Ausnahmen geben - auch in späteren Phasen der Schwangerschaft. Die Entscheidungen des Gremiums fielen damals einstimmig.
Wie reagieren Parteien, Kirchen und Verbände auf Überlegungen, Abtreibungen zu entkriminalisieren?
Grob skizziert treten Liberale und Linke in der Abtreibungsdebatte eher für das Selbstbestimmungsrecht der Frauen ein, Konservative für den Schutz des ungeborenen Lebens. Im April 2024 hatte die Unionsfraktion mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gedroht, sollte die Ampel-Regierung der Empfehlung der Expertenkommission folgen.
Die beiden großen Kirchen in Deutschland vertreten konträre Positionen: Nach Überzeugung der katholischen Bischöfe muss der Schwangerschaftsabbruch weiterhin Straftatbestand bleiben. Eine andere Regelung kann ihrer Meinung nach nicht den verfassungsrechtlich gebotenen Schutz des ungeborenen Lebens ausreichend gewährleisten.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) kann sich laut einer Stellungnahme hingegen zwar keine „vollständige Entkriminalisierung“ des Schwangerschaftsabbruchs, aber eine teilweise Streichung der strafrechtlichen Vorschriften vorstellen. Eine Abtreibung könnte demnach erst ab der 22. Schwangerschaftswoche strafbar sein. Das Papier des EKD-Rates ist allerdings auch in der evangelischen Kirche selbst umstritten.
Unterschiedliche Gesetzentwürfe
Im Oktober 2024 hatten 26 Verbände, die sich mit dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen, einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. Sie plädierten dafür, Paragraf 218 komplett aus dem Strafgesetzbuch zu streichen: Ein Abbruch soll demnach bis zur 22. Woche möglich sein und von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt werden.
Zu den beteiligten Verbänden gehörten unter anderem das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, der Deutsche Frauenrat, Pro Familia, der Deutsche Juristinnenbund sowie Terre des Femmes.
Ein zweiter Gesetzentwurf stammte von einer fraktionsübergreifenden Gruppe von Abgeordneten der SPD, Grünen und Linken, wonach Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche legalisiert werden sollen. Im Dezember 2024 war der Entwurf erstmals im Bundestag beraten und danach an den Rechtsausschuss verwiesen worden.
Doch dort fand sich unter den Parlamentariern keine Mehrheit, um eine gesetzliche Reform noch vor der Bundestagswahl auf den Weg zu bringen. Eine dafür nötige Sondersitzung kam wegen des Widerstands von Union und FDP nicht zustande. Mit der Konstituierung des neuen Bundestags am 25. März 2025 verfielen alle offenen Gesetzentwürfe.
Was wurde politisch zuletzt getan, um den Umgang mit Abtreibungen zu verändern?
Die ehemalige Bundesfamilienministerin Paus hatte im Januar 2024 einen Gesetzentwurf vorgelegt, der schwangere Frauen vor Belästigungen durch Abtreibungsgegnerinnen und -gegner schützen soll. Diesen droht ein Bußgeld von bis 5.000 Euro, wenn sie schwangere Frauen beispielsweise auf Gehsteigen vor Arztpraxen bedrängen. Das Gesetz wurde von Bundestag und -rat beschlossen.
Im Juni 2022 hatte der Bundestag bereits die ersatzlose Streichung des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche (§219a StGB) beschlossen. Davor hatten sich Ärzte strafbar gemacht, wenn sie öffentlich Informationen – zum Beispiel auf ihrer Webseite – über den Ablauf und die Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen bereitstellten.
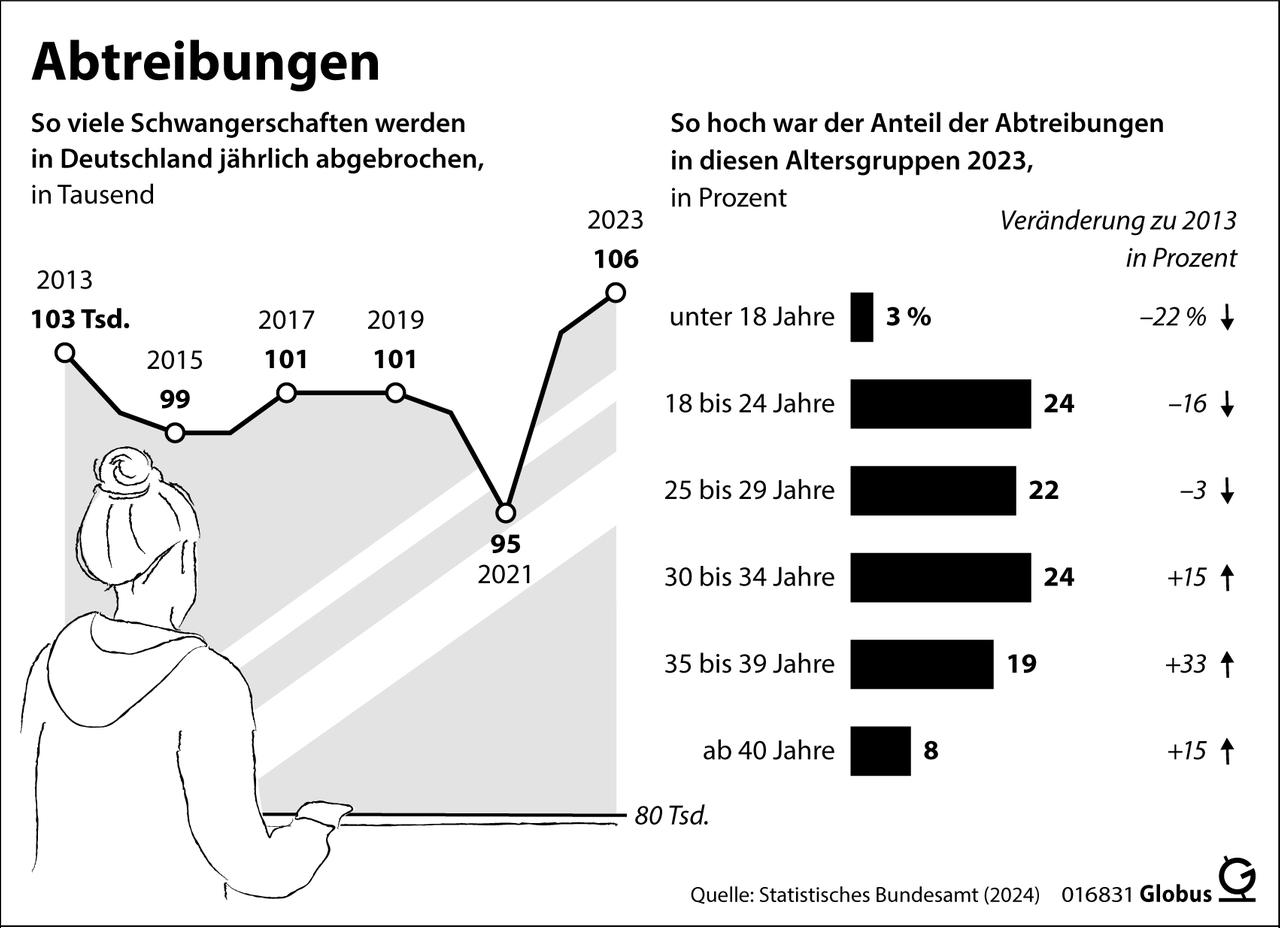
Wie läuft ein Schwangerschaftsabbruch ab?
Es gibt verschiedene Wege, die Schwangerschaft gemäß der geltenden Rechtslage abzubrechen. Nach einer Beratung und einer dreitägigen Bedenkzeit sei ein Abbruch sowohl medikamentös als auch operativ möglich, sagt Matthias David, geschäftsführender Oberarzt an der Frauenklinik der Charité Berlin.
Informationen gibt es unter anderem auf der Internetseite der Organisation "Doctors for Choice Germany". Das ist laut Selbstauskunft "ein deutschlandweites Netzwerk von Ärzt*innen und Medizinstudierenden". Studien des Projektes "Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer" legen nahe, dass es in Deutschland ein regionales Informations- und Versorgungsproblem bei Abbrüchen gibt. Demnach ist es in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für Schwangere nicht einfach, einen Termin für einen Abbruch zu bekommen.
Wie denken die Bürgerinnen und Bürger über die mögliche Änderung des Paragrafen 218?
Zu dieser Frage gibt es sehr widersprüchliche Umfragen. Nach einer Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF aus dem Mai 2023 ist eine Mehrheit der Menschen in Deutschland dafür, Abtreibung weiterhin als Straftat einzustufen. Demnach wollten 54 Prozent der Befragten, dass der Paragraf 218 erhalten bleibt. 36 Prozent votierten für seine Abschaffung; rund drei Prozent forderten eine Verschärfung.
Eine Forsa-Umfrage, die anlässlich des Kommissionsberichts durchgeführt wurde, kommt zum genau gegenteiligen Ergebnis: Eine Mehrheit der Bevölkerung (72 Prozent) ist für eine Legalisierung von Abtreibungen in den ersten zwölf Schwangerschaftswochen.
Zu einem ähnlichen Aussage kommt eine Umfrage aus dem Dezember 2022, erstellt vom Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung (BfsS): Hier sprachen sich 83 Prozent der Befragten für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs und die Streichung des Paragrafen 218 aus dem Strafgesetzbuch aus.
Bei einer INSA-Umfrage im Auftrag der katholischen „Tagespost“ vom Juni 2023 waren es wiederum 68 Prozent der Befragten, die wollten, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr als Straftatbestand gewertet wird. Nur 19 Prozent waren dafür, den Paragraf 218 zu erhalten.
ahe, lkn, tei, jma