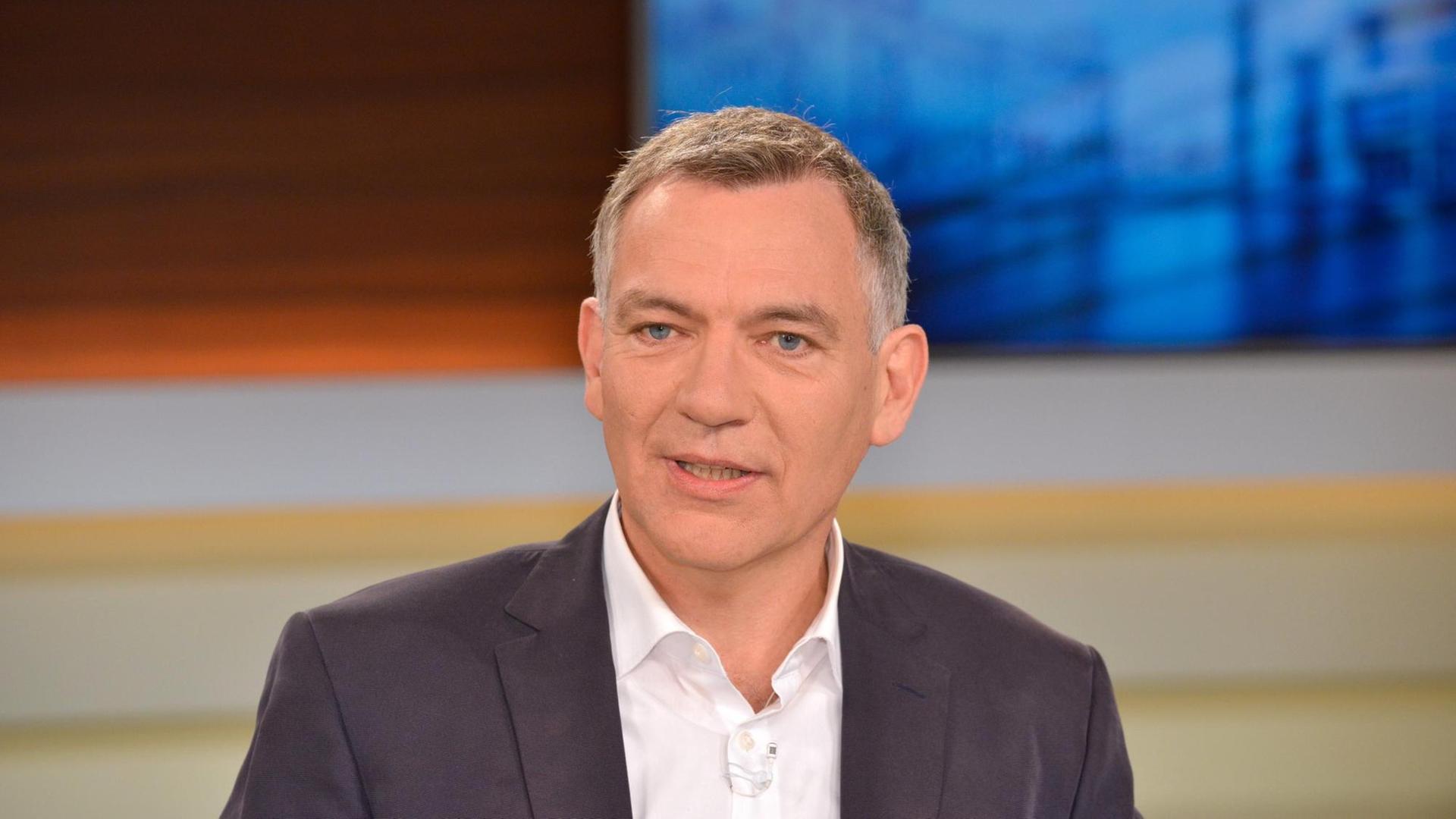In der Nähe von Munster, irgendwo im Nirgendwo der Lüneburger Heide etwa 100 Kilometer nördlich von Hannover, liegt die Geka – die Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten. Diese 100-prozentige Gesellschaft des Bundes ist das einzige Unternehmen in Deutschland, das chemische Munition mit dem Ziel der Vernichtung behandeln darf. Dass die Geka kein Unternehmen wie jedes andere ist, wird schon am Eingangstor deutlich: Ein bewaffneter Wachmann überreicht jedem Besucher ein Merkblatt mit Sicherheitsinformationen und Verhaltensregeln — und eine Atemschutzmaske.
"Fluchtmaske nennt sich das. Sollte doch mal irgendwo hier was sein, dass Gas ausströmt oder ungewöhnliche Gerüche, dann Behältnis aufmachen, die Pfropfen vom Filter lösen und aufsetzen wie eine Mütze!"
Klingt ganz simpel, trotzdem möchte man lieber nicht in die Verlegenheit kommen, eine Fluchtmaske benutzen zu müssen. Insgesamt drei Verbrennungsanlagen gibt es auf dem Gelände der Geka, dazu eine Bodenwaschanlage und mehrere sogenannte Delaborieranlagen, in denen Munition mechanisch zerlegt wird. Heiner Hormann, einer der Feuerwerker der Geka, öffnet eine schwere Stahltür.
"So, ich weise darauf hin, dass hier Kampfstoffmunition bearbeitet wird, es ist aber nichts messbar zurzeit! Ja, das ist unsere Kammer 1, hier bearbeiten wir Kampfstoffgranaten aus dem Ersten und auch Zweiten Weltkrieg, salopp gesagt: Senfgas. Diese Granaten werden hier angeliefert und dann von uns auf der Fräse geöffnet, sodass wir den Sprengstoff entfernen, den Kampfstoff entfernen und dann einzeln zur Vernichtung zuführen."
Die Granathüllen und der konventionelle Sprengstoff werden in einem speziell gesicherten Sprengofen thermisch behandelt. Am Ende bleibt nur ein Haufen ausgeglühter Metallschrott übrig. Die chemischen Kampfstoffe werden in einem anderen Ofen bei gut 1.000 Grad rückstandslos verbrannt. Bei der Vernichtung von chemischen Kampfstoffen aus den Weltkriegen und auch aus den Bürgerkriegsregionen in Syrien und Libyen zählen die Mitarbeiter der Geka in Munster zu den international anerkannten Top-Spezialisten.
"Fluchtmaske nennt sich das. Sollte doch mal irgendwo hier was sein, dass Gas ausströmt oder ungewöhnliche Gerüche, dann Behältnis aufmachen, die Pfropfen vom Filter lösen und aufsetzen wie eine Mütze!"
Klingt ganz simpel, trotzdem möchte man lieber nicht in die Verlegenheit kommen, eine Fluchtmaske benutzen zu müssen. Insgesamt drei Verbrennungsanlagen gibt es auf dem Gelände der Geka, dazu eine Bodenwaschanlage und mehrere sogenannte Delaborieranlagen, in denen Munition mechanisch zerlegt wird. Heiner Hormann, einer der Feuerwerker der Geka, öffnet eine schwere Stahltür.
"So, ich weise darauf hin, dass hier Kampfstoffmunition bearbeitet wird, es ist aber nichts messbar zurzeit! Ja, das ist unsere Kammer 1, hier bearbeiten wir Kampfstoffgranaten aus dem Ersten und auch Zweiten Weltkrieg, salopp gesagt: Senfgas. Diese Granaten werden hier angeliefert und dann von uns auf der Fräse geöffnet, sodass wir den Sprengstoff entfernen, den Kampfstoff entfernen und dann einzeln zur Vernichtung zuführen."
Die Granathüllen und der konventionelle Sprengstoff werden in einem speziell gesicherten Sprengofen thermisch behandelt. Am Ende bleibt nur ein Haufen ausgeglühter Metallschrott übrig. Die chemischen Kampfstoffe werden in einem anderen Ofen bei gut 1.000 Grad rückstandslos verbrannt. Bei der Vernichtung von chemischen Kampfstoffen aus den Weltkriegen und auch aus den Bürgerkriegsregionen in Syrien und Libyen zählen die Mitarbeiter der Geka in Munster zu den international anerkannten Top-Spezialisten.
Ein gewaltiger diplomatischer Erfolg
Chemiewaffen sind international geächtet und der überwiegende Teil wurde seit Inkrafttreten der Chemiewaffenkonvention von 1997 in Anlagen wie der Geka weltweit vernichtet - ein gewaltiger diplomatischer Erfolg. Die eigens eingerichtete Organisation für das Verbot Chemischer Waffen, die OVCW, wurde vor fünf Jahren dafür mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Doch die Gewissheit, dass das Grauen chemischer Kampfstoffe der Vergangenheit angehört, beginnt zu bröckeln.
"Die Gefahr droht, dass die Norm erodieren könnte, dass der Eindruck entsteht, dass Chemiewaffen doch eine gewisse Nützlichkeit haben. Das geht, glaube ich, vor allen Dingen aus, diese Gefahr von Syrien, denn andere Staaten und Diktatoren werden mit Interesse beobachten, zum einen wie die internationale Gemeinschaft auf diese Einsätze reagiert - und da müssen wir leider feststellen, dass der Sicherheitsrat tief gespalten ist in der Reaktion - und zum anderen werden sie beobachten, welche militärischen Erfolge denn das syrische Regime durch den Einsatz dieser Waffen erzielen konnte und ob sich das lohnt."
Sagt Oliver Meier, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, kurz SWP. Obwohl Syrien 2013 unter internationalem Druck dem Chemiewaffenabkommen beitrat und sich zur vollständigen Vernichtung seines Waffenbestands verpflichtete, hat das Regime nicht gänzlich auf seine Chemiewaffen verzichtet. Im dortigen Bürgerkrieg wurden mehrfach chemische Kampfstoffe wie Chlorgas und Sarin gegen Rebellen und Zivilbevölkerung eingesetzt. Und obwohl die OVCW und die UNO nachweisen konnten, dass Syrien Vertragsbruch begangen hat und dass die eingesetzten Waffen aus Beständen der syrischen Armee stammten, blieben Baschar al-Assad und sein Regime ungeschoren.
"Die Gefahr droht, dass die Norm erodieren könnte, dass der Eindruck entsteht, dass Chemiewaffen doch eine gewisse Nützlichkeit haben. Das geht, glaube ich, vor allen Dingen aus, diese Gefahr von Syrien, denn andere Staaten und Diktatoren werden mit Interesse beobachten, zum einen wie die internationale Gemeinschaft auf diese Einsätze reagiert - und da müssen wir leider feststellen, dass der Sicherheitsrat tief gespalten ist in der Reaktion - und zum anderen werden sie beobachten, welche militärischen Erfolge denn das syrische Regime durch den Einsatz dieser Waffen erzielen konnte und ob sich das lohnt."
Sagt Oliver Meier, Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, kurz SWP. Obwohl Syrien 2013 unter internationalem Druck dem Chemiewaffenabkommen beitrat und sich zur vollständigen Vernichtung seines Waffenbestands verpflichtete, hat das Regime nicht gänzlich auf seine Chemiewaffen verzichtet. Im dortigen Bürgerkrieg wurden mehrfach chemische Kampfstoffe wie Chlorgas und Sarin gegen Rebellen und Zivilbevölkerung eingesetzt. Und obwohl die OVCW und die UNO nachweisen konnten, dass Syrien Vertragsbruch begangen hat und dass die eingesetzten Waffen aus Beständen der syrischen Armee stammten, blieben Baschar al-Assad und sein Regime ungeschoren.

Ein weiterer mutmaßlicher Bruch des Chemiewaffenübereinkommens: der Nervengiftanschlag auf den ehemaligen russischen Spion Sergei Skripal und seine Tochter im britischen Salisbury. Ein gewaltiger Vorwurf steht im Raum: Russland, das mit 40.000 Tonnen reinem Kampfstoff das größte Chemiewaffenarsenal deklariert und mit westlicher Hilfe vernichtet hat, hat womöglich selbst die Verpflichtungen aus der Chemiewaffenkonvention unterlaufen. Oliver Meier von der SWP:
"Wenn es sich bestätigen sollte, dass Russland hier verantwortlich ist, dass ein Besitzerstaat, ein wichtiger Besitzerstaat Chemiewaffen nicht deklariert hat, die er hätte deklarieren müssen, und bereit ist, diese einzusetzen, wäre natürlich auch das eine Schwächung der Norm."
"Wenn es sich bestätigen sollte, dass Russland hier verantwortlich ist, dass ein Besitzerstaat, ein wichtiger Besitzerstaat Chemiewaffen nicht deklariert hat, die er hätte deklarieren müssen, und bereit ist, diese einzusetzen, wäre natürlich auch das eine Schwächung der Norm."
Es steht einiges auf dem Spiel
Es steht einiges auf dem Spiel: Das Chemiewaffenübereinkommen ist der umfangreichste und wirksamste Abrüstungs- und Rüstungskontrollvertrag, den die internationale Gemeinschaft je vereinbart hat. Fast alle Staaten der Welt sind ihm beigetreten. Noch zu Beginn der 90er-Jahre verfügten viele Länder über tödliche Chemiewaffen. Kampfstoffe wie Produktionsstätten sind heute weitgehend zerstört. Chemische Kampfstoffe unterliegen zudem einem umfassenden Verbot. Das bezieht sich ausnahmslos auf alle Chemikalien, wenn sie dazu dienen können, als Waffe zum Schaden anderer eingesetzt zu werden, egal, ob es um das tödliche Nervengift Sarin geht oder um Stoffe wie Chlorgas, die auch zivile Verwendung finden. Das stelle offiziell bislang auch niemand infrage, sagt der Toxikologe und Chemiewaffenexperte Ralf Trapp.
"Die Verurteilung der Anwendung solcher Waffen grundsätzlich ist schon ziemlich universell. Die Frage ist, wie haltbar im praktischen Sinne das Verfahren ist und wie groß die Versuchung ist, entweder für bestimmte Staaten oder auch für nichtstaatliche Akteure, trotz des Verbotes und trotz der Maßnahmen unter dem Chemiewaffenübereinkommen zur inneren und zur internationalen Kontrolle, dennoch zu versuchen, solche Waffen zu entwickeln und einzusetzen."
"Die Verurteilung der Anwendung solcher Waffen grundsätzlich ist schon ziemlich universell. Die Frage ist, wie haltbar im praktischen Sinne das Verfahren ist und wie groß die Versuchung ist, entweder für bestimmte Staaten oder auch für nichtstaatliche Akteure, trotz des Verbotes und trotz der Maßnahmen unter dem Chemiewaffenübereinkommen zur inneren und zur internationalen Kontrolle, dennoch zu versuchen, solche Waffen zu entwickeln und einzusetzen."
Es fehlt eine angemessene Antwort auf Regelverstöße
Es besteht also ein Widerspruch zwischen den unbestreitbaren Errungenschaften gegen Chemiewaffen und den erwiesenen oder mutmaßlichen Verstößen gegen ihre Ächtung. Auch in diesem Jahr konnte die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen Erfolge vermelden. Im Januar wurde bei der Geka in Munster der Abbau von Vorprodukten für die Herstellung chemischer Kampfstoffe aus libyschen Beständen abgeschlossen. Und am 13. März gratulierte die OVCW dem Irak zur Vernichtung seines Arsenals. Das ging aber im politischen Getöse unter.
Am selben Tag nämlich warf die britische Premierministerin Theresa May Russland vor, es habe entweder die Kontrolle über sein als "Nowitschok" bezeichnetes Nervengift verloren oder, schlimmer noch, es stehe selbst hinter dem Anschlag auf Ex-Agent Sergei Skripal. Haben Vorfälle wie in Syrien und Salisbury das Potenzial, das Chemiewaffenverbot ins Wanken zu bringen? Una Becker-Jakob ist Expertin für Rüstungskontrolle bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
"Es gerät nicht automatisch in Gefahr dadurch, dass einzelne Staaten oder einzelne Akteure gegen das Verbot verstoßen, sondern das Entscheidende ist, wie mit diesen Vertragsverstößen oder Regelbrüchen umgegangen wird. Und da sehe ich eigentlich in der aktuellen Situation das Problem, dass es im Moment sehr sehr schwierig scheint, eine angemessene Antwort zu finden und darin liegt meiner Meinung nach das Risiko für die weitere Entwicklung."
Im Fall Skripal steht das Ergebnis der Experten noch aus. Die diplomatische Reaktion war bereits scharf. Premierministerin May sagte, sie habe britische Geheimdienstinformationen mit den Partnerstaaten geteilt. Neben Großbritannien wiesen zahlreiche andere Staaten, darunter Deutschland, russische Botschaftsangehörige aus. Es soll sich bei ihnen um Geheimdienstmitarbeiter handeln. Der Ton wird schärfer und eine Aufklärung dürfte schwierig werden, wenn nicht alle Beteiligten offen kooperieren, Russland eingeschlossen.
"Ich glaube, eine zweifelsfreie Feststellung der Urheberschaft wird äußerst schwierig werden. Was man sicher feststellen kann, ist, welcher Stoff verwendet wurde."
Sagt Una Becker-Jakob. Wie andere Experten auch geht sie davon aus, dass das Nowitschok-Gift nur unter Beteiligung staatlicher Stellen verwendet werden konnte. Die Wissenschaftlerin plädiert dafür, die OVCW ohne den Druck politischer Vorverurteilungen ihre Arbeit machen zu lassen. Eine solche neutrale Instanz sei in so einem brisanten Fall unverzichtbar.
In Syrien gibt es wesentlich klarere Hinweise auf die Urheberschaft der Giftgasangriffe. Ein Fall ist besonders wichtig: Ein vom UNO-Sicherheitsrat eingesetztes Untersuchungsgremium aus OVCW und UNO, der Joint Investigative Mechanism, kam zu dem Ergebnis, dass der Angriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun vor einem Jahr vom syrischen Militär verübt wurde. Dabei wurden über 80 Menschen mit dem Nervengift Sarin getötet.
"Also man hat praktisch eine Verbindung herstellen können zwischen den Materialien, die Syrien 2013 an die OVCW als Bestandteil ihres Chemiewaffenarsenals gemeldet hat und den chemischen Signaturen, die man zum Beispiel in Chan Scheichun gefunden hat, wo Sarin verwendet worden ist."
Sagt Ralf Trapp. Im Bericht an den UNO-Sicherheitsrat hieß es im Oktober unmissverständlich: "Die Syrische Arabische Republik ist verantwortlich für den Einsatz von Sarin in Chan Scheichun am 4. April 2017."
"Es gerät nicht automatisch in Gefahr dadurch, dass einzelne Staaten oder einzelne Akteure gegen das Verbot verstoßen, sondern das Entscheidende ist, wie mit diesen Vertragsverstößen oder Regelbrüchen umgegangen wird. Und da sehe ich eigentlich in der aktuellen Situation das Problem, dass es im Moment sehr sehr schwierig scheint, eine angemessene Antwort zu finden und darin liegt meiner Meinung nach das Risiko für die weitere Entwicklung."
Im Fall Skripal steht das Ergebnis der Experten noch aus. Die diplomatische Reaktion war bereits scharf. Premierministerin May sagte, sie habe britische Geheimdienstinformationen mit den Partnerstaaten geteilt. Neben Großbritannien wiesen zahlreiche andere Staaten, darunter Deutschland, russische Botschaftsangehörige aus. Es soll sich bei ihnen um Geheimdienstmitarbeiter handeln. Der Ton wird schärfer und eine Aufklärung dürfte schwierig werden, wenn nicht alle Beteiligten offen kooperieren, Russland eingeschlossen.
"Ich glaube, eine zweifelsfreie Feststellung der Urheberschaft wird äußerst schwierig werden. Was man sicher feststellen kann, ist, welcher Stoff verwendet wurde."
Sagt Una Becker-Jakob. Wie andere Experten auch geht sie davon aus, dass das Nowitschok-Gift nur unter Beteiligung staatlicher Stellen verwendet werden konnte. Die Wissenschaftlerin plädiert dafür, die OVCW ohne den Druck politischer Vorverurteilungen ihre Arbeit machen zu lassen. Eine solche neutrale Instanz sei in so einem brisanten Fall unverzichtbar.
In Syrien gibt es wesentlich klarere Hinweise auf die Urheberschaft der Giftgasangriffe. Ein Fall ist besonders wichtig: Ein vom UNO-Sicherheitsrat eingesetztes Untersuchungsgremium aus OVCW und UNO, der Joint Investigative Mechanism, kam zu dem Ergebnis, dass der Angriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun vor einem Jahr vom syrischen Militär verübt wurde. Dabei wurden über 80 Menschen mit dem Nervengift Sarin getötet.
"Also man hat praktisch eine Verbindung herstellen können zwischen den Materialien, die Syrien 2013 an die OVCW als Bestandteil ihres Chemiewaffenarsenals gemeldet hat und den chemischen Signaturen, die man zum Beispiel in Chan Scheichun gefunden hat, wo Sarin verwendet worden ist."
Sagt Ralf Trapp. Im Bericht an den UNO-Sicherheitsrat hieß es im Oktober unmissverständlich: "Die Syrische Arabische Republik ist verantwortlich für den Einsatz von Sarin in Chan Scheichun am 4. April 2017."
Ein Gremium, das von der höchsten Instanz der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, kam also zu dem Schluss, dass Assad seine eigene Bevölkerung weiterhin mit Chemiewaffen tötet. Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft war aber alles andere als geeint. Stattdessen blockierte Moskau weitere Untersuchungen. Oliver Meier von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin:
"Russland hat nicht zuletzt durch sein Veto im Sicherheitsrat verhindert, dass ein Untersuchungsmechanismus, der sogenannte Joint Investigative Mechanism, der explizit den Auftrag hatte hier, zum ersten Mal hier tatsächlich die Verantwortlichen zu identifizieren, dass der seine Arbeit fortfahren kann, sodass er im November letzten Jahres seine Arbeit beenden musste. Und das ist wirklich ein schwerer Verlust."
Russland warf der OVCW gar vor, parteiisch zu sein - ein beispielloser Angriff auf die Behörde, die das Verbot von Chemiewaffen gewährleisten soll und in der bislang weitgehend im Konsens aller Beteiligten entschieden wurde. Die UNO versuche nun, die Untersuchungen wieder aufzunehmen, sagt Chemiewaffenexperte Ralf Trapp.
"Wir wissen, dass nach wie vor die Syrien-Kommission des Menschenrechtsrates an diesem Problem arbeitet und es gibt auch Diskussionen im Sicherheitsrat zu neuen Verfahren zur Untersuchung der Verantwortlichkeit für diese Chemiewaffeneinsätze."
"Russland hat nicht zuletzt durch sein Veto im Sicherheitsrat verhindert, dass ein Untersuchungsmechanismus, der sogenannte Joint Investigative Mechanism, der explizit den Auftrag hatte hier, zum ersten Mal hier tatsächlich die Verantwortlichen zu identifizieren, dass der seine Arbeit fortfahren kann, sodass er im November letzten Jahres seine Arbeit beenden musste. Und das ist wirklich ein schwerer Verlust."
Russland warf der OVCW gar vor, parteiisch zu sein - ein beispielloser Angriff auf die Behörde, die das Verbot von Chemiewaffen gewährleisten soll und in der bislang weitgehend im Konsens aller Beteiligten entschieden wurde. Die UNO versuche nun, die Untersuchungen wieder aufzunehmen, sagt Chemiewaffenexperte Ralf Trapp.
"Wir wissen, dass nach wie vor die Syrien-Kommission des Menschenrechtsrates an diesem Problem arbeitet und es gibt auch Diskussionen im Sicherheitsrat zu neuen Verfahren zur Untersuchung der Verantwortlichkeit für diese Chemiewaffeneinsätze."
Neue Aufgaben für die OVCW
Der Streit kommt zu einer Zeit, in der ohnehin fraglich ist, wie das künftige Mandat der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen aussehen soll. Bis auf Restbestände in den USA, die bis 2023 abgebaut werden sollen, sind die Chemiewaffenarsenale der Vertragsstaaten offiziell weitgehend aufgelöst. Somit könnte die OVCW sich künftig nach Vorstellung einiger Mitglieder darauf beschränken, Industriekontrollen durchzuführen oder technische Hilfe zu leisten. Sie könnte vor dem Hintergrund der Einsätze in Syrien andererseits aber auch ein stärkeres Mandat erhalten als bisher und etwa ermächtigt werden, eigenständig Kontrollen durchzuführen, auch in Konfliktgebieten. Zum Ende des Jahres steht eine Überprüfungskonferenz an, die alle fünf Jahre stattfindet und darauf Antworten geben soll.
"Es zeichnet sich doch meiner Meinung nach ab, dass man auch am scharfen Ende der Kontrolle Fähigkeiten vorhalten muss und vorhalten sollte und dass man nicht so tun kann, als ob die Herausforderungen durch Chemiewaffen jetzt schon alle bewältigt sind."
Sagt Oliver Meier von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

Der Einsatz von chemischen Kampfstoffen hat sich verändert. Als die Chemiewaffenkonvention 1997 geschlossen wurde, hatten die Vertragspartner vor allem Einsätze auf dem Schlachtfeld vor Augen. Angriffe auf die eigene Bevölkerung oder taktische Anwendungen im Bürgerkrieg stellen eine neue Dimension dar. Auch auf mögliche Anschläge durch Terroristen muss die Weltgemeinschaft vorbereitet sein. Wobei die zwischenstaatliche Chemiewaffenkonvention hier an ihre Grenzen gerät. Denn der Kampf gegen Terrorgruppen ist vor allem Polizeiarbeit.
"Wir wissen auch durch die Arbeit der Vereinten Nationen, dass der sogenannte Islamische Staat in der Lage ist, selbst Senfgas herzustellen. Und sie haben es auch mehrfach eingesetzt."
Jan van Aken ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken und war zuvor Biowaffeninspekteur der UNO, als die einmalig im Irak eingesetzt wurden. Dass Terroristen des sogenannten "Islamischen Staates" das bereits im Ersten Weltkrieg eingesetzte Senfgas hergestellt und eingesetzt haben, wurde durch Untersuchungen der OVCW bestätigt. Auch die französische Regierung warnte nach den Terroranschlägen in Paris vom November 2015 davor, dass Terroristen chemische Kampfstoffe einsetzen könnten. Chemiewaffenexperte Ralf Trapp sieht die Gefahr ebenfalls.
"Bestimmte toxische Chemikalien können sich sicher kriminelle Organisationen oder Terrororganisationen relativ leicht beschaffen und dann auch entsprechend in improvisierte Waffensysteme umbauen."
Ein Kampfstoff wie Senfgas, das der "Islamische Staat" hergestellt hat, wirkt über die Haut. Er führt zu einer Blasenbildung, die einer chemischen Verbrennung gleicht und zum Tod führen kann. Es kann zudem Augen, Verdauungstrakt, Atemwege und Schleimhäute schädigen. Der irakische Machthaber Saddam Hussein ließ damit 1988 das Massaker an den Kurden von Halabdscha verüben. 5.000 Menschen wurden getötet.
"Wir wissen auch durch die Arbeit der Vereinten Nationen, dass der sogenannte Islamische Staat in der Lage ist, selbst Senfgas herzustellen. Und sie haben es auch mehrfach eingesetzt."
Jan van Aken ist ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Linken und war zuvor Biowaffeninspekteur der UNO, als die einmalig im Irak eingesetzt wurden. Dass Terroristen des sogenannten "Islamischen Staates" das bereits im Ersten Weltkrieg eingesetzte Senfgas hergestellt und eingesetzt haben, wurde durch Untersuchungen der OVCW bestätigt. Auch die französische Regierung warnte nach den Terroranschlägen in Paris vom November 2015 davor, dass Terroristen chemische Kampfstoffe einsetzen könnten. Chemiewaffenexperte Ralf Trapp sieht die Gefahr ebenfalls.
"Bestimmte toxische Chemikalien können sich sicher kriminelle Organisationen oder Terrororganisationen relativ leicht beschaffen und dann auch entsprechend in improvisierte Waffensysteme umbauen."
Ein Kampfstoff wie Senfgas, das der "Islamische Staat" hergestellt hat, wirkt über die Haut. Er führt zu einer Blasenbildung, die einer chemischen Verbrennung gleicht und zum Tod führen kann. Es kann zudem Augen, Verdauungstrakt, Atemwege und Schleimhäute schädigen. Der irakische Machthaber Saddam Hussein ließ damit 1988 das Massaker an den Kurden von Halabdscha verüben. 5.000 Menschen wurden getötet.
Vom Kampfstoff zum ungefährlichen Füllmaterial
Heiner Hormann und seine Kollegen in der Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten in Munster haben oft mit Senfgas zu tun, das auch Lost oder Schwefellost genannt wird. Sie müssen sich aber auch mit Stoffen wie Tabun oder Phosgen, beides hochgiftige Lungenkampfstoffe, befassen. Das geht nicht ohne die entsprechende Schutzausrüstung, den sogenannten Zodiak, einen klobig wirkenden Gummianzug in olivgrün.
"Wir haben das Ding immer an, wenn wir Kampfstoffmunition bearbeiten. Sie können ohne Gummianzug, ohne Zodiak, keinen Kampfstoff verarbeiten, das ist unmöglich!"
Der Gummianzug besteht aus zwei Teilen, einer Art Wathose und einer Jacke. Heiner Hormann holt einen der Anzüge aus dem Schrank.
"Das ist das Unterteil, das ist eine ganz normale Hose mit Stiefeln, und dann das Oberteil, das wird dann da drüber gezogen. Und dann wird alles umwickelt, so zusammengerollt, dass da auch ja kein Kampfstoff reinkommt. Wenn Sie so einen Anzug anziehen, passiert das immer mit drei Mann: Einer der angezogen wird und zwei Mann, die ihm helfen den Anzug anzuziehen. Das wird alles nochmal mit Tape zur Sicherheit abgedichtet und dann geht es los."
Zusätzlich tragen die Mitarbeiter schweren Atemschutz. So ausgerüstet ist die Arbeit nicht gerade ein Vergnügen, sagt Heiner Hormann.
"Nee, auf keinen Fall. Wenn Sie das Ding eine halbe Stunde anhaben und damit auch körperlich gearbeitet haben, dann sind Sie bedient, dann können Sie eineinhalb Stunden Ruhe haben!"
Der Umgang mit den Kampfmittelgranaten findet grundsätzlich hinter dicken Betonmauern und schweren Stahltüren statt. Die nächste Halle dagegen wirkt eher wie ein großes Lager in einem Baumarkt. Eine kräftige Lüftungsanlage macht hier einen ziemlichen Lärm.
In langen Reihen stehen große, weiße Plastiksäcke am Boden der Halle. In diesen sogenannten Big Packs befindet sich mit Chemikalien belastetes Erdreich - überwiegend vom nahegelegenen Truppenübungsplatz Munster, aber auch aus anderen Regionen Deutschlands. Als Leiter der Betriebstechnik bei Geka weiß Ulrich Stiene genau, was in diesen kontaminierten Böden steckt.
"Es sind Kampfstoffreste, Clark 1, Clark 2, das sind Reizstoffe aus dem Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg. Es können aber auch Lost-Reste drin sein, es können deren Zersetzungsprodukte drin sein, und es kann halt, wenn es ganz zersetzt ist, Arsen drin sein. Weil: Jeder Kampfstoff wurde in Deutschland mit Arsen umgesetzt und somit ist da viel Arsen in den Böden drin."
Die Reinigung dieser Böden findet in großen Waschanlagen statt. Mithilfe eines Rührwerks und zugesetzten Chemikalien werden die Giftstoffe von jedem einzelnen Sandkorn sprichwörtlich abgewaschen. Der gereinigte Sand - das sind etwa 80 Prozent des Ausgangsmaterials - kann anschließend als Füllmaterial zum Beispiel für Deponien verwendet werden. Die restlichen 20 Prozent sind feiner Schlamm, in dem sich die Kampfstoffe konzentriert haben. Dieser Schlamm wird getrocknet und wandert anschließend in einen Lichtbogenofen. Extreme Hitze von gut 20.000 Grad zerstört dort die meisten Kampfstoffe vollständig. Übrig bleiben Arsenverbindungen, die in dem Plasmafeuer des Lichtbogens zu einer Glasschlacke eingeschmolzen werden. Eine sichere Technik, beteuert Geka-Geschäftsführer Andreas Krüger, während er einige der erstarrten Glasschlackereste mit dem Fuß zur Seite schiebt.
"Das heißt, mit diesem Glas können Sie arbeiten, das kann auch als Ersatzbaustoff beispielsweise verwendet werden, ohne dass man mit einer Gefährdung durch das Arsen rechnen muss."
Der Gummianzug besteht aus zwei Teilen, einer Art Wathose und einer Jacke. Heiner Hormann holt einen der Anzüge aus dem Schrank.
"Das ist das Unterteil, das ist eine ganz normale Hose mit Stiefeln, und dann das Oberteil, das wird dann da drüber gezogen. Und dann wird alles umwickelt, so zusammengerollt, dass da auch ja kein Kampfstoff reinkommt. Wenn Sie so einen Anzug anziehen, passiert das immer mit drei Mann: Einer der angezogen wird und zwei Mann, die ihm helfen den Anzug anzuziehen. Das wird alles nochmal mit Tape zur Sicherheit abgedichtet und dann geht es los."
Zusätzlich tragen die Mitarbeiter schweren Atemschutz. So ausgerüstet ist die Arbeit nicht gerade ein Vergnügen, sagt Heiner Hormann.
"Nee, auf keinen Fall. Wenn Sie das Ding eine halbe Stunde anhaben und damit auch körperlich gearbeitet haben, dann sind Sie bedient, dann können Sie eineinhalb Stunden Ruhe haben!"
Der Umgang mit den Kampfmittelgranaten findet grundsätzlich hinter dicken Betonmauern und schweren Stahltüren statt. Die nächste Halle dagegen wirkt eher wie ein großes Lager in einem Baumarkt. Eine kräftige Lüftungsanlage macht hier einen ziemlichen Lärm.
In langen Reihen stehen große, weiße Plastiksäcke am Boden der Halle. In diesen sogenannten Big Packs befindet sich mit Chemikalien belastetes Erdreich - überwiegend vom nahegelegenen Truppenübungsplatz Munster, aber auch aus anderen Regionen Deutschlands. Als Leiter der Betriebstechnik bei Geka weiß Ulrich Stiene genau, was in diesen kontaminierten Böden steckt.
"Es sind Kampfstoffreste, Clark 1, Clark 2, das sind Reizstoffe aus dem Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg. Es können aber auch Lost-Reste drin sein, es können deren Zersetzungsprodukte drin sein, und es kann halt, wenn es ganz zersetzt ist, Arsen drin sein. Weil: Jeder Kampfstoff wurde in Deutschland mit Arsen umgesetzt und somit ist da viel Arsen in den Böden drin."
Die Reinigung dieser Böden findet in großen Waschanlagen statt. Mithilfe eines Rührwerks und zugesetzten Chemikalien werden die Giftstoffe von jedem einzelnen Sandkorn sprichwörtlich abgewaschen. Der gereinigte Sand - das sind etwa 80 Prozent des Ausgangsmaterials - kann anschließend als Füllmaterial zum Beispiel für Deponien verwendet werden. Die restlichen 20 Prozent sind feiner Schlamm, in dem sich die Kampfstoffe konzentriert haben. Dieser Schlamm wird getrocknet und wandert anschließend in einen Lichtbogenofen. Extreme Hitze von gut 20.000 Grad zerstört dort die meisten Kampfstoffe vollständig. Übrig bleiben Arsenverbindungen, die in dem Plasmafeuer des Lichtbogens zu einer Glasschlacke eingeschmolzen werden. Eine sichere Technik, beteuert Geka-Geschäftsführer Andreas Krüger, während er einige der erstarrten Glasschlackereste mit dem Fuß zur Seite schiebt.
"Das heißt, mit diesem Glas können Sie arbeiten, das kann auch als Ersatzbaustoff beispielsweise verwendet werden, ohne dass man mit einer Gefährdung durch das Arsen rechnen muss."
Vom tödlichen Nervengas zu harmlosem Glas. Die Experten bei der Geka wissen genau, wie sie zu verfahren haben, wenn chemische Kampfstoffe zum Einsatz gekommen sind. Damit haben sie der internationalen Politik einiges voraus.