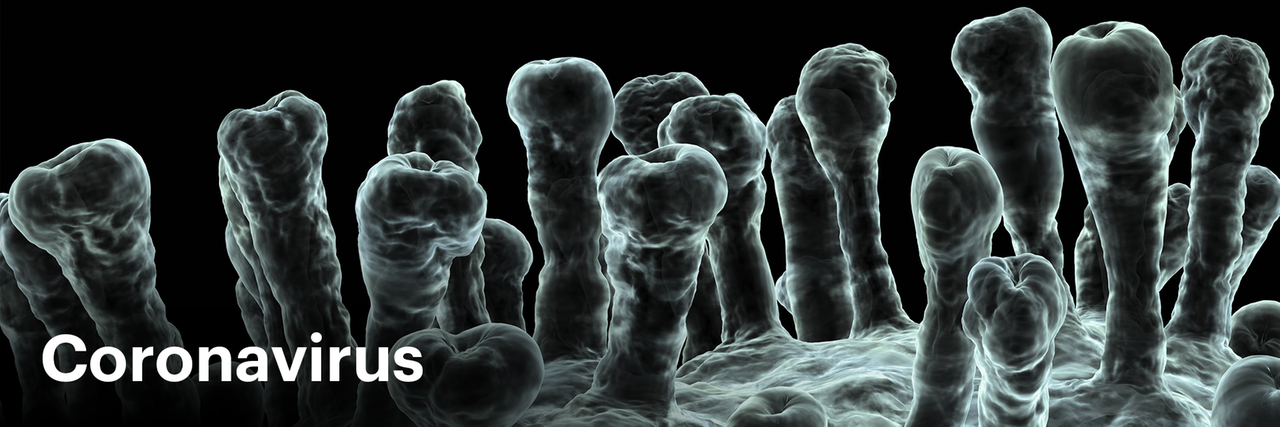Wer Radionachrichten hört, Zeitung liest oder Nachrichtenmagazine schaut, kommt an solchen Schlagzeilen über das Coronavirus nicht vorbei: "In NRW ist die Zahl der Infizierten sprunghaft angestiegen", "Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verdreifacht", "Über 80.000 Infizierte", "Städte in Italien und China abgeriegelt". Wie sachlich beziehungsweise sachdienlich wird über diese Pandemie berichtet? Professor Georg Ruhrmann ist Kommunikationswissenschaftler an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Er findet diese Meldungen nur bedingt sachdienlich. "Die Frage ist, ob das Ab- und Aufzählen von Infizierten hilfreich ist", sagte Ruhrmann im Dlf.
"Die Öffentlich-Rechtlichen können das"
Ein Journalist hätte in der Berichterstattung vor Kurzem von der Angst vor der Panik gesprochen, die jetzt größer sei, als die Angst vor dem Virus. "Ich glaube, Panik ist ganz unangemessen. Wir sollten eher von Sorge sprechen. Ich würde versuchen, diese Begrifflichkeit, zum Beispiel auch das Wort Angst, zu vermeiden", so Ruhrmann. Diese Wörter würden den kühlen Kopf behindern. Eines der eigentlichen Probleme derzeit sei eher eine immer dramatisierende Berichterstattung. Dem müsse man begegnen.
Wie jemand auf die derzeitige ungewisse Situation reagiere hänge unter anderem auch von subjektiver Wahrnehmung und Bildung ab, "von dem Schulwissen, das ich über Viren habe, weil das ein ziemlich interessanter, komplexer Stoff ist."
Ob der Medizin- und Wissenschaftsjournalismus der Aufgabe gerecht wird, den Lesern und Hörern sachdienlich und unaufgeregt die Lage zu erklären, hänge nach Auffassung von Ruhrmann von den jeweiligen Redaktionen und Sendern ab. "Große Häuser und Redaktionen, zumal die Öffentlich-Rechtlichen, die können das und die machen das auch". Es hänge natürlich auch von der Linie des Hauses und von den Einstellungen der einzelnen Journalisten zur Wissenschaft und ihren Qualifikationen ab. Es gebe allerdings keinen Schnelltest für journalistische Qualität.
Soziale Medien seien sicherlich ein Teil des Problems
Medien und Journalisten könnten so schnell, aktuell, global und komplex über das Thema recherchieren und berichten wie nie zuvor. Zurzeit sehe man aber auch medizinische Experten, die das täten, was guten Journalismus ausmache: Sie würden live zugeschaltet und berichteten multiperspektivisch, anschlussfähig und interessant. Das sei sehr anschaulich und verständlich.
Ruhrmann betonte, die sozialen Medien seien sicherlich ein Teil des Problems, könnten aber genauso ein Element der Lösung sein. Das liege an der Interaktivität der Nutzer und etwa daran, dass auch Betroffene zu Wort kommen könnten. Die Krisenkommunikation von Behörden und Kliniken sei dagegen oft sehr direktiv und paternalistisch.
Grundsätzlich sei man als Bürger dazu angehalten, mehrere Medien zu nutzen, also beispielsweise verschiedene Zeitungen – sowohl Boulevard als auch seriöse Blätter. Eine solche "ausgeglichene Mediendiät" könne auch dazu führen, dass man bestimmte Dinge besser durchschaue. Es gehöre zum mündigen Bürger, die Medienkommunikation zu durchschauen.
Ruhrmann betonte, die sozialen Medien seien sicherlich ein Teil des Problems, könnten aber genauso ein Element der Lösung sein. Das liege an der Interaktivität der Nutzer und etwa daran, dass auch Betroffene zu Wort kommen könnten. Die Krisenkommunikation von Behörden und Kliniken sei dagegen oft sehr direktiv und paternalistisch.
Grundsätzlich sei man als Bürger dazu angehalten, mehrere Medien zu nutzen, also beispielsweise verschiedene Zeitungen – sowohl Boulevard als auch seriöse Blätter. Eine solche "ausgeglichene Mediendiät" könne auch dazu führen, dass man bestimmte Dinge besser durchschaue. Es gehöre zum mündigen Bürger, die Medienkommunikation zu durchschauen.