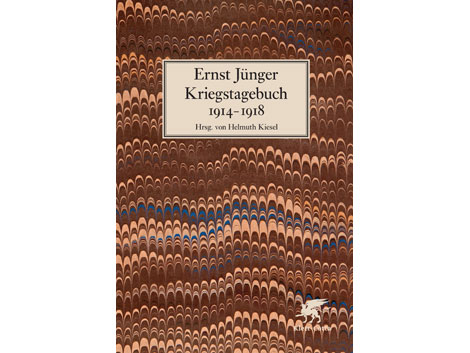Ernst Jünger ist nicht in den Krieg gezogen, sondern er ist in den Krieg geflohen. Andere mögen 1914 aus Vaterlandsliebe und im Überschwang nationalistischer Gefühle die Uniform angezogen haben, ohne zu ahnen, was auf sie zukommen mochte. Bei Jünger verhielt es sich anders. Der Krieg, der zehn Millionen Soldaten und Zivilisten das Leben kosten sollte, ihm kam er gelegen. Er ergriff ihn wie eine günstige Gelegenheit, und er ergriff ihn, um sich vom Krieg, dem Vater aller Dinge, ergreifen und formen zu lassen.
Jünger war mit achtzehn Jahren aus dem wenig geliebten Elternhaus geflohen, um in die Fremdenlegion einzutreten. Es war der Fluchtversuch eines schlechten Schülers, eines Schulversagers, der unter dem Pult Reise- und Abenteuerliteratur verschlang, wegen schlechter Zensuren mehrfach die Schulen wechseln musste und in so genannte "Pressen" gesteckt wurde, denen er im Oktober des Jahres 1913 endgültig entfliehen wollte. Er reiste illegal, weil ohne gültige Papiere, nach Frankreich, meldete sich in Verdun zur Fremdenlegion, wurde tatsächlich genommen und gelangte im Handumdrehen über Marseille nach Nordafrika, in das südlich von Oran gelegene Hauptquartier der Legion. Doch statt der ersehnten Abenteuer erwarteten ihn hier Drill und die Ödnis der Kasernenhöfe. Jünger desertierte, wurde jedoch nach einigen Tagen in der Steppe Nordafrikas wieder eingefangen und wenig später auf Betreiben des Vaters, der manchen Hebel in Bewegung gesetzt haben musste, wieder nach Hause geschickt.
Unmittelbar nach den Weihnachtstagen des Jahres 1913 war Ernst Jünger wieder daheim. Nun war er ein Veteran der Fremdenlegion, ein Deserteur und Fahnenflüchtiger, der sich unerlaubt von der Truppe entfernt hatte, aber vor allem war er wieder: ein Schüler. Und zwar einer, der dem Vater wohl oder übel hatte versprechen müssen, sich brav und gründlich auf die Reifeprüfung vorzubereiten. Aber kein Jahr später, nur wenige Monate nach der schmählichen Rückkehr, bot der Krieg die Möglichkeit, endgültig der Schulbank zu entfliehen und endlich dem zu folgen, was er für seine Bestimmung hielt:
"Ich fühlte mich meinem Wesen nach auf eine Weite und Freiheit des Lebens angelegt, von der ich wohl mit Recht vermutete, dass sie im bürgerlichen Deutschland nicht zu verwirklichen sei."
Jünger muss diese Freiheit und Weite in der Enge der Schützengräben und Unterstände gefunden haben, bei den ausgiebigen Besäufnissen im Offizierskreis, auf nächtlichen Patrouillen und beim Anblick von Tod und Verwesung. Als er sofort nach der Mobilmachung nach Hannover fuhr, um sich als Kriegsfreiwilliger eintragen zu lassen, lag die Kaserne zu seiner Überraschung wie im Belagerungszustand vor ihm. Tausende von Freiwilligen drängelten sich vor den Toren, und Jünger musste ganze drei Tage lang warten, bevor er sich beim Füsilier-Regiment 73 registrieren lassen konnte. In diesen Tagen und den darauffolgenden Wochen, die bis zur Verlegung an die Front vergehen sollten, wuchs die Sorge. Aber es war nicht die Sorge um Verwundung oder Tod.
"Ich hatte eigentlich nur einen Kummer, und der bestand darin, dass mich die Siegesnachrichten in den Zeitungen beängstigten. Deutsche Kavalleriestreifen hatten bereits die Türme von Paris gesehen; wenn das so weiterging, was sollte dann noch für uns übrig bleiben? Wir wollten doch auch noch Kugeln pfeifen hören und jene Augenblicke erleben, die man als die eigentliche Männertaufe bezeichnen kann."
Es sollten noch genügend Kugeln übrig bleiben, und Unzählige, denen es mit der sogenannten Männertaufe nicht schnell genug hatte gehen können, kehrten gebrochen zurück, für den Rest ihres Lebens an Leib und Seele beschädigt: Zu den zehn Millionen Toten kamen noch achtzehn Millionen Kriegsversehrte hinzu. Europa war nach den Verheerungen des Ersten Weltkriegs "auf den Hund gekommen". Heute ist längst vergessen, woher der Ausdruck stammt. Er hat nichts mit dem "Hundeleben" zu tun, sondern bezog sich auf die zahllosen Beinamputierten im Straßenbild der Nachkriegszeit, die sich keinen Rollstuhl leisten konnten, sondern mit dem sogenannten "Hund" vorlieb nehmen mussten, einem Brett, unter das Räder montiert wurden, und das normalerweise zum Möbeltransport diente. Aber daran dachte bei Ausbruch des Krieges kaum jemand und Jünger schon gar nicht.
Zwanzig Jahre später, im Jahr 1934, veröffentlichte Jünger unter dem Titel "Kriegsausbruch 1914" einen kurzen Text von gerade einmal vier Seiten, aus dem die bislang erwähnten Zitate stammen und an dessen Ende auch das in diesem Herbst erstmals veröffentlichten Kriegstagebuch und die ihm zugedachte Funktion erwähnt werden.
"Am 27. Dezember 1914 wurden wir plötzlich alarmiert; die Front wartete auf uns. Schwer bepackt und doch fröhlich, wie an einem Feiertage, marschierten wir zum Bahnhof ab. In meiner Rocktasche hatte ich ein schmales Büchlein verwahrt; es war für meine täglichen Aufzeichnungen bestimmt. Ich wusste, dass die Dinge, die uns erwarteten, unwiederbringlich waren, und ich ging mit höchster Neugier auf sie zu. Auch hatte ich einen natürlichen Hang zur Beobachtung; ich hegte schon früh eine Vorliebe für Fernrohre und Mikroskope als für Werkzeuge, mit denen man das Große und Kleine sieht, und unter Schriftstellern schätzte ich von jeher die, denen neben einem scharfen Auge für alles Sichtbare auch ein Instinkt für das Unsichtbare gegeben ist.
Als der Zug anfuhr, brach bereits die Dunkelheit herein. Wir fuhren mit Gesang in die Nacht hinein. Wie wir so mit Licht und Lärm an Dörfern und einsamen Höfen vorbeirollten, sagten wohl die Eltern, die mit ihren Kindern an den Tischen saßen: ,Das sind Soldaten. Die fahren in den Krieg.’ Und vielleicht fragten die Kinder: "Was ist denn das – der Krieg?""
Die Kriegstagebücher, von dem Heidelberger Germanisten und Jünger-Biografen Helmuth Kiesel jetzt mustergültig ediert, geben eine erschreckende und faszinierende, eine verstörende und rätselhafte Antwort auf diese Frage. Was der Krieg, der moderne, mit Flugzeugen, Giftgas und nie zuvor gekannter Feuerkraft geführte Krieg war, sollte Jünger nicht nur kennenlernen, er sollte es geradezu erkunden. Seine Beobachtungen notierte er in dem schmalen, in der Rocktasche verwahrten Büchlein, von dem soeben die Rede war. Ob es um das Kleine oder das Große ging, um das Sichtbare oder das Unsichtbare, alles wurde festgehalten, bis bei Kriegsende fünfzehn dieser Hefte mit Aufzeichnungen gefüllt waren. Oft Tag für Tag, in Sätzen, die das unmittelbar Erlebte festhalten sollten, oft hastig, atemlos niedergeschrieben, wie unter Zeitdruck, zu dem sich freilich ein anderer Druck gesellte: die Anspannung der Nerven, die unter schwerem Granatfeuer zum Zerreißen angespannt waren.
Die Kriegstagebücher, die seit 1995 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar aufbewahrt werden, bildeten das Rohmaterial, aus denen Jünger "In Stahlgewittern" formte, das Buch, das ihn bei seinem Erscheinen schlagartig berühmt machte und das er immer wieder hervornahm, um es zu überarbeiten. Sechs Fassungen sind so in mehr als einem halben Jahrhundert entstanden, von der Erstausgabe des Jahres 1920 bis zur sechsten Fassung, die Jünger 1978, da war er 83 Jahre alt, vorlegte. Man kann sich die Szenerie nicht seltsam genug vorstellen: ein Greis, der sich über die Notizen beugt, die er als Neunzehnjähriger, glücklich der Schule entronnen, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs angefertigt hat. Vierundsechzig Jahre lag damals, 1978, die erste Eintragung zurück, und noch einmal zweiunddreißig Jahre sollten vergehen, bis die Kriegstagebücher jetzt ediert wurden. Dabei war der Anblick der fünfzehn Hefte ihrem Verfasser schon zehn Jahre nach Kriegsausbruch fremd geworden, wie er 1924, im Vorwort zur fünften Auflage der "Stahlgewitter", schrieb:
"Es war eine seltsame Beschäftigung, im bequemen Sessel das Gekritzel dieser Hefte zu entziffern, an deren Deckeln noch der vertrocknete Schlamm der Gräben klebte, und dunkle Flecken, von denen ich nicht mehr wusste, war es Blut oder
Wein."
Eine seltsame Beschäftigung sei es also gewesen, das Entziffern des Gekritzels – das ist eine der für Jünger so typischen absichtsvollen Untertreibungen. Er war mehr als seltsam, dieser Vorgang, aber vor allem ging es um weit mehr als nur um das bloße Entziffern. Denn das Entziffern dürfte das geringste Problem gewesen sein, das sich dem hochdekorierten Kriegshelden stellte, als er sich anschickte, eines der wichtigsten und umstrittensten Kriegsbücher des zwanzigsten Jahrhunderts zu verfassen, ein Buch, das Erich Maria Remarque und André Gide ebenso beschäftigte und faszinierte wie Jahrzehnte später den Dramatiker Heiner Müller. Dieses Buch warf Fragen auf, die seit Jahrzehnten immer neue Antworten provozieren: Wie hat Ernst Jünger in den "Stahlgewittern" die Transformation seiner unmittelbaren Wahrnehmung ins Werk gesetzt? Welche ästhetischen Verfahren hat er eingesetzt, um das unfassbare Phänomen des Krieges literarisch zu fassen? Wo verläuft die Grenze zwischen erlaubter Literarisierung des Grauens und seiner moralisch anfechtbaren Ästhetisierung? Und schließlich, die jüngste, die aktuellste Frage in diesem Zusammenhang: Was verrät das jetzt edierte Kriegstagebuch über das ideologische Sturmgepäck, mit dem der junge Kriegsfreiwillige ins Feld zog? Wer war dieser Ernst Jünger als junger Mann? Ein Nationalist, ein kriegs- und mordlüsterner Abenteurer, ein amoralischer Ästhet des Schreckens?
Für diese Fragen ist das Kriegstagebuch ungemein aufschlussreich, aber es sind überwiegend philologische Fragen, und wer an ihnen nicht oder nur wenig interessiert ist, mag dazu neigen, sich die Lektüre dieses Buches zu ersparen. Das wäre schade. Denn Jüngers Aufzeichnungen bieten auch noch etwas ganz anderes: eine nahezu einzigartige, in ihrer Anschaulichkeit und Präzision unvergleichlich herzlose und deshalb aufrichtige Antwort auf die Kinderfrage "Was ist denn das – der Krieg?"
Für Ernst Jünger begann dieser Krieg am 30. Dezember des Jahres 1914 so:
"Nachmittags, Empfang von Patronen und eiserner Ration. Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten. Als wir antraten, nahmen einige Mütter Abschied, was doch etwas trübe stimmte. 6.44 Abfahrt. Wir bekamen Stroh in die Wagen. Furchtbar gedrängte Pennerei in und unter den Bänken.
31. XII. 14.
Halb eins bekamen wir Kaffee und Brot in Hannoversch Münden. 7 Uhr morgens in Gießen. Wir aßen Erbsensuppe mit Fleisch. Lahntal, wunderbare Aussicht. Rhein überschritten bei Coblenz."
Dann folgen das Moseltal, Erbsensuppe abends um halb zehn in Luxemburg, ein Schluck Curacao um Mitternacht, um das neue Jahr zu begrüßen, und am Neujahrsmorgen, schon um sieben Uhr in der Früh – Erbsensuppe. Man hat Sedan hinter sich gelassen, die Stimmung ist "fidel", die Gegend, Jünger notiert es wohl nicht ohne eine gewisse Befriedigung, bekomme allmählich ein "kriegsmäßiges Aussehn". Damit sind Anzeichen ordinärer Zerstörung gemeint: gesprengte Brücken, verlassene Häuser, die verfaulten Garben der Ernte auf den Feldern. Die Insignien des Krieges werden begrüßt, aber zugleich wird die damit einhergehende Zerstörung der Natur bedauert: "Die verwilderten Felder bieten ein traurigen Anblick", notiert der Neunzehnjährige, ohne sich um den Widerspruch seiner Beobachtungen zu bekümmern. So wird er es auch künftig halten. Denn alle Widersprüche sind aufgehoben in einer allen Dingen und Denkweisen übergeordneten Ordnung: Es ist die Ordnung des Krieges. Ihre Logik ist allen von Menschen geschaffenen Ordnungssystemen überlegen. Er sei ein guter Krieger, aber ein schlechter Soldat gewesen, wird Jünger viel später einmal von sich sagen und damit auf sein Autoritätsproblem anspielen. Er ordnete sich nicht gern unter. Der Krieg bildete auch hier die Ausnahme. Ihm unterwarf sich Jünger vollständig. Von Anfang an.
Am 2. Januar des Jahres 1915, seit dem Aufbruch sind gerade einmal 72 Stunden vergangen, kommt es zur ersten unmittelbaren Begegnung mit dem Kriegsgeschehen. Die Nacht hatte man in einer Scheune in Oranville zugebracht, am nächsten Morgen wird Jünger zur 9. Kompanie zugeteilt und bezieht Posten in der Schule des Ortes.
"Plötzlich krachte es ziemlich in unserer Nähe. Aus allen Häusern liefen Soldaten auf die Straße. Dann pfiff es dreimal dicht über uns hinweg. Alles lachte und niemand lief, aber jeder senkte den Kopf. Wenige Augenblicke später wurden die ersten Getroffenen auf Zeltbahnen herangetragen. Der erste, den ich sah, war blutüberströmt und rief ein heiseres, ersticktes zu Hilfe, zu Hilfe. Dem zweiten hing das Bein lose am Schenkel. Es waren 9 Mann getötet, darunter der Musikdirektor Gebhardt. Es wurde von Spionage gesprochen, da unser Dorf erst seit gestern befeuert wurde. Wir standen längere zeit hinter einer Böschung am Dorf und gingen dann wieder hinein. Ich kam nachher am Portal des Schlosses vorbei. Eine Granate war in die linke Ecke eingeschlagen. Einige große Blutlachen röteten die Straße und am Pfeiler klebte Hirn."
Von Goethe weiß man, dass er Kranke mied, Beerdigungen fernblieb, Vergänglichkeit und den Tod nach Kräften ignorierte, weil er sie im Grunde seines Herzens nicht akzeptierte. Er war nicht bereit, sie als Teil der Realität anzuerkennen. Ernst Jünger hielt es genau umgekehrt. Für ihn war nichts realer als der Tod. Nicht zuletzt darin lag seine radikale, auf seine Zeitgenossen oft verstörend wirkende Modernität.
Zwei Tage nach dem Anblick der ersten Toten schreibt er:
"Ich bin sehr neugierig, wie sich eine Schrapnellbeschießung ausmacht. Im Allgemeinen ist mir der Krieg schrecklicher vorgekommen, wie er wirklich ist. Der Anblick der von Granaten zerrissenen hat mich vollkommen kalt gelassen, ebenso die ganze Knallerei, trotzdem ich einige Male die Kugeln sehr nahe habe singen hören. Im Allgemeinen sind mir die Kälte und die Nässe in unsern Erdlöchern das Unangenehmste."
Maulheldentum? So könnte man denken. Aber hier pfeift kein Pennäler im Wald. Zwei Tage später, er ist kaum eine Woche im Feld, sieht Jünger mit an, wie einem Mann neben ihm eine Kugel den Kopf durchschlägt. Der Mann stand geschützt hinter dem eisernen Schutzschild der Maschinengewehrstellung, aber die Kugel fand ihr Ziel durch den winzigen Ausguck. Jüngers Kommentar:
"Wer es haben soll, den trifft auch."
Freilich gilt auch der Umkehrschluss: Wer noch nicht an der Reihe ist, der überlebt. Und zwar fast alles.
Dreizehn Mal wird Ernst Jünger verwundet, immer wieder entgeht er dem Tod um Haaresbreite. Als der Krieg endet, ist er mit seinen 23 Jahren der zweitälteste Kompanieführer seiner Einheit. Sechzig Prozent der Gefallenen, so berichtet Helmuth Kiesel in seinem unbedingt zur Lektüre empfohlenen Nachwort, gehörten zur Altersgruppe der Neunzehn- bis Neunundzwanzigjährigen. Im letzten Kriegsjahr lag das Durchschnittsalter der Gefallenen bei neunzehneinhalb Jahren. Jünger überlebte – überlebte, beobachtete und notierte. Jeder Fleischfetzen, jeder Knochen, jeder durchschossene Helm, jeder von einem verfaulenden Fleischrest wie mit einem widerlich stinkenden Film überzogene Uniformfetzen wird registriert – sei es ein Beinstumpf, ein Beckenknochen, dessen Bestimmung Stolz auf die im Feld erworbenen anatomischen Kenntnisse hervorruft, oder ein Stück von der Schädeldecke des Leutnants Eiwald:
"ganz weiß, ohne Haare und Hirn, nur etliche kleine Äderchen waren zu sehen."
Ab und an malt Jünger einen Totenkopf in seine Hefte oder zeichnet den Knochenmann als apokalyptischen Reiter, der seinen Gaul gegen eine dahinsausende Granate eingetauscht hat. Memento mori- und Vanitas-Gedanken sind ihm durchaus nicht fremd, und gelegentlich erinnert ihn die Szenerie der Zerstörung an ein Böcklin-Gemälde. Aber das Sterben ist von einer alles durchdringenden Gegenwärtigkeit und bedarf keiner Symbolisierung, keiner Überhöhung. Frühere Völker sollen aus den Schädeln ihrer besiegten Feinde getrunken haben, der junge deutsche Offizier liebäugelt mit urbaneren Genüssen:
"Heute Nachmittag fand ich in der Nähe der Latrine von der Festung Altenburg zwei noch zusammenhängende Finger- und Mittelhandknochen. Ich hob sie auf und hatte den geschmackvollen Plan, sie zu einer Zigarrenspitze umarbeiten zu lassen. Jedoch es klebte, genau wie an der Leiche im Stacheldrahtverhau bei Combres noch grünlichweißes verwestes Fleisch zwischen den Gelenken, deshalb stand ich von meinem Vorhaben ab. Um 7 zogen wir wieder in vorderste Linie."
Das Dandytum, das sich mit der morbiden Zigarrenspitze verbindet, wird abgewehrt, denn in Jünger bildet sich ein anderes Ideal des Soldaten heran. Jünger klassifiziert nicht nur die Granaten anhand ihrer Fluggeräusche, er berechnet den Munitionsaufwand und dessen Kosten und lässt sich die gewaltige Infrastruktur zeigen, die im Hinterland dafür sorgt, dass die Truppen an der Front ernährt und versorgt werden können. Wenn der Krieg industrialisiert ist, muss dann nicht der Soldat zum Arbeiter werden? In einer der wenigen längeren, zusammenhängenden Textpassagen der ersten Kriegsjahre tritt neben das Ideal des Kriegers plötzlich ein ganz anderes:
"Der Moderne Infanterist ist Erdarbeiter, Bergmann, Zimmermann, kurz ein Mann, der alles versteht."
Jünger beginnt den Krieg als Maschinerie zu begreifen, und den Menschen, gleich welcher Nation, als Teil des Materials, mit dem diese Maschinerie unablässig gefüttert werden muss. Das grünlichweiß verweste Fleisch am französischen Mittelhandknochen oder der bluttriefende Oberschenkel des jungen deutschen Offiziers Ernst Jünger: Material, das eine wie das andere. Dies anzuerkennen und zugleich die eigene Individualität zu behaupten, war die Aufgabe, vor die sich Jünger gestellt sah. Dieses Projekt konnte nur gelingen, wenn der Krieg als solcher in seiner Sinnhaftigkeit nicht infrage gestellt wurde.
Der entscheidende Schritt, den Jünger vollzog, das zeigt dieses Tagebuch deutlich, ist nicht die Ästhetisierung des Schreckens, sondern noch davor die Affirmation von Tod und Vernichtung als überzeitlichen Phänomenen, deren Legitimation auch durch ihre industrialisierte Ausprägung nicht ausgehöhlt werden kann. Das schließt gelegentliche Zweifel freilich nicht aus. Nach elf Monaten auf den Schlachtfeldern notiert er:
"Lange schon bin ich im Krieg, schon manchen sah ich fallen, der wert war zu leben. Was soll dies morden und immer wieder morden? Ich fürchte, es wird zu viel vernichtet und es bleiben zu wenig, um wieder aufzubauen. Vorm Kriege dachte ich wie mancher: nieder, zerschlagt das alte Gebäude, das neue wird auf jeden Fall besser. Aber nun - es scheint mir, das Kultur und alles Große langsam vom Kriege erstickt wird. Der Krieg hat in mir doch die Sehnsucht nach den Segnungen des Friedens geweckt.
Doch genug der Wachstubenphilosophie! In einigen Tagen sollen wir neue Gewehre bekommen, das ist ein verdächtiges Zeichen. Eines Tages in unsrer alten Stellung wird’s heißen: Alarm. Es geht ins Gefecht, das wird wieder mal gut tun."
Und vier Monate später, am 29. März 1916, seinem Geburtstag, notierte er fröhlich:
"Mir macht das Kriegsleben jetzt gerade den richtigen Spaß, das ständige Spiel mit dem Leben als Einsatz hat einen hohen Reiz. Man lebt, man erlebt, man gelangt zu Ruhm und Ehren, das alles nur um den Einsatz eines armseligen Lebens."
Der Zweck seines Buches, so resümierte Ernst Jünger am 10. August 1918, dem Tag, mit dem seien Aufzeichnungen enden, sei es, dem Leser sachlich zu schildern, was er erlebt und sich inmitten seines Regiments bei diesen Erlebnissen gedacht habe.
"Ich bin kein Mann der Feder, trotzdem hoffe ich, dass mancher, der dieses Buch aus der Hand legt, eine Ahnung davon bekommen hat, von dem, was von uns Infanteristen geleistet wurde. "
Worin aber besteht die Leistung, die uns aus diesen Aufzeichnungen entgegentritt? Politische Reflexionen haben in ihnen keinen Platz, ebenso wenig wie Nationalismus oder Standesdünkel. Töten, überleben, sich mannhaft verhalten, die Angst überwinden, sich panzern und beobachten – darum geht es. Was Jünger in seinem Kriegstagebuch festhält, ist der Prozess einer umfassenden Panzerung, die im Angesicht der permanenten Gefahr der Auslöschung erfolgt. So wird einer tatsächlich nicht zum Mann der Feder, wohl aber zum unberührten und unberührbaren Stenografen des Todes.
Besprochen von Hubert Spiegel
Ernst Jünger: "Kriegstagebuch 1914-1918"
Herausgegeben von Helmuth Kiesel, Klett-Cotta Verlag 2010, 654 Seiten, 32,95 Euro
Jünger war mit achtzehn Jahren aus dem wenig geliebten Elternhaus geflohen, um in die Fremdenlegion einzutreten. Es war der Fluchtversuch eines schlechten Schülers, eines Schulversagers, der unter dem Pult Reise- und Abenteuerliteratur verschlang, wegen schlechter Zensuren mehrfach die Schulen wechseln musste und in so genannte "Pressen" gesteckt wurde, denen er im Oktober des Jahres 1913 endgültig entfliehen wollte. Er reiste illegal, weil ohne gültige Papiere, nach Frankreich, meldete sich in Verdun zur Fremdenlegion, wurde tatsächlich genommen und gelangte im Handumdrehen über Marseille nach Nordafrika, in das südlich von Oran gelegene Hauptquartier der Legion. Doch statt der ersehnten Abenteuer erwarteten ihn hier Drill und die Ödnis der Kasernenhöfe. Jünger desertierte, wurde jedoch nach einigen Tagen in der Steppe Nordafrikas wieder eingefangen und wenig später auf Betreiben des Vaters, der manchen Hebel in Bewegung gesetzt haben musste, wieder nach Hause geschickt.
Unmittelbar nach den Weihnachtstagen des Jahres 1913 war Ernst Jünger wieder daheim. Nun war er ein Veteran der Fremdenlegion, ein Deserteur und Fahnenflüchtiger, der sich unerlaubt von der Truppe entfernt hatte, aber vor allem war er wieder: ein Schüler. Und zwar einer, der dem Vater wohl oder übel hatte versprechen müssen, sich brav und gründlich auf die Reifeprüfung vorzubereiten. Aber kein Jahr später, nur wenige Monate nach der schmählichen Rückkehr, bot der Krieg die Möglichkeit, endgültig der Schulbank zu entfliehen und endlich dem zu folgen, was er für seine Bestimmung hielt:
"Ich fühlte mich meinem Wesen nach auf eine Weite und Freiheit des Lebens angelegt, von der ich wohl mit Recht vermutete, dass sie im bürgerlichen Deutschland nicht zu verwirklichen sei."
Jünger muss diese Freiheit und Weite in der Enge der Schützengräben und Unterstände gefunden haben, bei den ausgiebigen Besäufnissen im Offizierskreis, auf nächtlichen Patrouillen und beim Anblick von Tod und Verwesung. Als er sofort nach der Mobilmachung nach Hannover fuhr, um sich als Kriegsfreiwilliger eintragen zu lassen, lag die Kaserne zu seiner Überraschung wie im Belagerungszustand vor ihm. Tausende von Freiwilligen drängelten sich vor den Toren, und Jünger musste ganze drei Tage lang warten, bevor er sich beim Füsilier-Regiment 73 registrieren lassen konnte. In diesen Tagen und den darauffolgenden Wochen, die bis zur Verlegung an die Front vergehen sollten, wuchs die Sorge. Aber es war nicht die Sorge um Verwundung oder Tod.
"Ich hatte eigentlich nur einen Kummer, und der bestand darin, dass mich die Siegesnachrichten in den Zeitungen beängstigten. Deutsche Kavalleriestreifen hatten bereits die Türme von Paris gesehen; wenn das so weiterging, was sollte dann noch für uns übrig bleiben? Wir wollten doch auch noch Kugeln pfeifen hören und jene Augenblicke erleben, die man als die eigentliche Männertaufe bezeichnen kann."
Es sollten noch genügend Kugeln übrig bleiben, und Unzählige, denen es mit der sogenannten Männertaufe nicht schnell genug hatte gehen können, kehrten gebrochen zurück, für den Rest ihres Lebens an Leib und Seele beschädigt: Zu den zehn Millionen Toten kamen noch achtzehn Millionen Kriegsversehrte hinzu. Europa war nach den Verheerungen des Ersten Weltkriegs "auf den Hund gekommen". Heute ist längst vergessen, woher der Ausdruck stammt. Er hat nichts mit dem "Hundeleben" zu tun, sondern bezog sich auf die zahllosen Beinamputierten im Straßenbild der Nachkriegszeit, die sich keinen Rollstuhl leisten konnten, sondern mit dem sogenannten "Hund" vorlieb nehmen mussten, einem Brett, unter das Räder montiert wurden, und das normalerweise zum Möbeltransport diente. Aber daran dachte bei Ausbruch des Krieges kaum jemand und Jünger schon gar nicht.
Zwanzig Jahre später, im Jahr 1934, veröffentlichte Jünger unter dem Titel "Kriegsausbruch 1914" einen kurzen Text von gerade einmal vier Seiten, aus dem die bislang erwähnten Zitate stammen und an dessen Ende auch das in diesem Herbst erstmals veröffentlichten Kriegstagebuch und die ihm zugedachte Funktion erwähnt werden.
"Am 27. Dezember 1914 wurden wir plötzlich alarmiert; die Front wartete auf uns. Schwer bepackt und doch fröhlich, wie an einem Feiertage, marschierten wir zum Bahnhof ab. In meiner Rocktasche hatte ich ein schmales Büchlein verwahrt; es war für meine täglichen Aufzeichnungen bestimmt. Ich wusste, dass die Dinge, die uns erwarteten, unwiederbringlich waren, und ich ging mit höchster Neugier auf sie zu. Auch hatte ich einen natürlichen Hang zur Beobachtung; ich hegte schon früh eine Vorliebe für Fernrohre und Mikroskope als für Werkzeuge, mit denen man das Große und Kleine sieht, und unter Schriftstellern schätzte ich von jeher die, denen neben einem scharfen Auge für alles Sichtbare auch ein Instinkt für das Unsichtbare gegeben ist.
Als der Zug anfuhr, brach bereits die Dunkelheit herein. Wir fuhren mit Gesang in die Nacht hinein. Wie wir so mit Licht und Lärm an Dörfern und einsamen Höfen vorbeirollten, sagten wohl die Eltern, die mit ihren Kindern an den Tischen saßen: ,Das sind Soldaten. Die fahren in den Krieg.’ Und vielleicht fragten die Kinder: "Was ist denn das – der Krieg?""
Die Kriegstagebücher, von dem Heidelberger Germanisten und Jünger-Biografen Helmuth Kiesel jetzt mustergültig ediert, geben eine erschreckende und faszinierende, eine verstörende und rätselhafte Antwort auf diese Frage. Was der Krieg, der moderne, mit Flugzeugen, Giftgas und nie zuvor gekannter Feuerkraft geführte Krieg war, sollte Jünger nicht nur kennenlernen, er sollte es geradezu erkunden. Seine Beobachtungen notierte er in dem schmalen, in der Rocktasche verwahrten Büchlein, von dem soeben die Rede war. Ob es um das Kleine oder das Große ging, um das Sichtbare oder das Unsichtbare, alles wurde festgehalten, bis bei Kriegsende fünfzehn dieser Hefte mit Aufzeichnungen gefüllt waren. Oft Tag für Tag, in Sätzen, die das unmittelbar Erlebte festhalten sollten, oft hastig, atemlos niedergeschrieben, wie unter Zeitdruck, zu dem sich freilich ein anderer Druck gesellte: die Anspannung der Nerven, die unter schwerem Granatfeuer zum Zerreißen angespannt waren.
Die Kriegstagebücher, die seit 1995 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach am Neckar aufbewahrt werden, bildeten das Rohmaterial, aus denen Jünger "In Stahlgewittern" formte, das Buch, das ihn bei seinem Erscheinen schlagartig berühmt machte und das er immer wieder hervornahm, um es zu überarbeiten. Sechs Fassungen sind so in mehr als einem halben Jahrhundert entstanden, von der Erstausgabe des Jahres 1920 bis zur sechsten Fassung, die Jünger 1978, da war er 83 Jahre alt, vorlegte. Man kann sich die Szenerie nicht seltsam genug vorstellen: ein Greis, der sich über die Notizen beugt, die er als Neunzehnjähriger, glücklich der Schule entronnen, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs angefertigt hat. Vierundsechzig Jahre lag damals, 1978, die erste Eintragung zurück, und noch einmal zweiunddreißig Jahre sollten vergehen, bis die Kriegstagebücher jetzt ediert wurden. Dabei war der Anblick der fünfzehn Hefte ihrem Verfasser schon zehn Jahre nach Kriegsausbruch fremd geworden, wie er 1924, im Vorwort zur fünften Auflage der "Stahlgewitter", schrieb:
"Es war eine seltsame Beschäftigung, im bequemen Sessel das Gekritzel dieser Hefte zu entziffern, an deren Deckeln noch der vertrocknete Schlamm der Gräben klebte, und dunkle Flecken, von denen ich nicht mehr wusste, war es Blut oder
Wein."
Eine seltsame Beschäftigung sei es also gewesen, das Entziffern des Gekritzels – das ist eine der für Jünger so typischen absichtsvollen Untertreibungen. Er war mehr als seltsam, dieser Vorgang, aber vor allem ging es um weit mehr als nur um das bloße Entziffern. Denn das Entziffern dürfte das geringste Problem gewesen sein, das sich dem hochdekorierten Kriegshelden stellte, als er sich anschickte, eines der wichtigsten und umstrittensten Kriegsbücher des zwanzigsten Jahrhunderts zu verfassen, ein Buch, das Erich Maria Remarque und André Gide ebenso beschäftigte und faszinierte wie Jahrzehnte später den Dramatiker Heiner Müller. Dieses Buch warf Fragen auf, die seit Jahrzehnten immer neue Antworten provozieren: Wie hat Ernst Jünger in den "Stahlgewittern" die Transformation seiner unmittelbaren Wahrnehmung ins Werk gesetzt? Welche ästhetischen Verfahren hat er eingesetzt, um das unfassbare Phänomen des Krieges literarisch zu fassen? Wo verläuft die Grenze zwischen erlaubter Literarisierung des Grauens und seiner moralisch anfechtbaren Ästhetisierung? Und schließlich, die jüngste, die aktuellste Frage in diesem Zusammenhang: Was verrät das jetzt edierte Kriegstagebuch über das ideologische Sturmgepäck, mit dem der junge Kriegsfreiwillige ins Feld zog? Wer war dieser Ernst Jünger als junger Mann? Ein Nationalist, ein kriegs- und mordlüsterner Abenteurer, ein amoralischer Ästhet des Schreckens?
Für diese Fragen ist das Kriegstagebuch ungemein aufschlussreich, aber es sind überwiegend philologische Fragen, und wer an ihnen nicht oder nur wenig interessiert ist, mag dazu neigen, sich die Lektüre dieses Buches zu ersparen. Das wäre schade. Denn Jüngers Aufzeichnungen bieten auch noch etwas ganz anderes: eine nahezu einzigartige, in ihrer Anschaulichkeit und Präzision unvergleichlich herzlose und deshalb aufrichtige Antwort auf die Kinderfrage "Was ist denn das – der Krieg?"
Für Ernst Jünger begann dieser Krieg am 30. Dezember des Jahres 1914 so:
"Nachmittags, Empfang von Patronen und eiserner Ration. Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten. Als wir antraten, nahmen einige Mütter Abschied, was doch etwas trübe stimmte. 6.44 Abfahrt. Wir bekamen Stroh in die Wagen. Furchtbar gedrängte Pennerei in und unter den Bänken.
31. XII. 14.
Halb eins bekamen wir Kaffee und Brot in Hannoversch Münden. 7 Uhr morgens in Gießen. Wir aßen Erbsensuppe mit Fleisch. Lahntal, wunderbare Aussicht. Rhein überschritten bei Coblenz."
Dann folgen das Moseltal, Erbsensuppe abends um halb zehn in Luxemburg, ein Schluck Curacao um Mitternacht, um das neue Jahr zu begrüßen, und am Neujahrsmorgen, schon um sieben Uhr in der Früh – Erbsensuppe. Man hat Sedan hinter sich gelassen, die Stimmung ist "fidel", die Gegend, Jünger notiert es wohl nicht ohne eine gewisse Befriedigung, bekomme allmählich ein "kriegsmäßiges Aussehn". Damit sind Anzeichen ordinärer Zerstörung gemeint: gesprengte Brücken, verlassene Häuser, die verfaulten Garben der Ernte auf den Feldern. Die Insignien des Krieges werden begrüßt, aber zugleich wird die damit einhergehende Zerstörung der Natur bedauert: "Die verwilderten Felder bieten ein traurigen Anblick", notiert der Neunzehnjährige, ohne sich um den Widerspruch seiner Beobachtungen zu bekümmern. So wird er es auch künftig halten. Denn alle Widersprüche sind aufgehoben in einer allen Dingen und Denkweisen übergeordneten Ordnung: Es ist die Ordnung des Krieges. Ihre Logik ist allen von Menschen geschaffenen Ordnungssystemen überlegen. Er sei ein guter Krieger, aber ein schlechter Soldat gewesen, wird Jünger viel später einmal von sich sagen und damit auf sein Autoritätsproblem anspielen. Er ordnete sich nicht gern unter. Der Krieg bildete auch hier die Ausnahme. Ihm unterwarf sich Jünger vollständig. Von Anfang an.
Am 2. Januar des Jahres 1915, seit dem Aufbruch sind gerade einmal 72 Stunden vergangen, kommt es zur ersten unmittelbaren Begegnung mit dem Kriegsgeschehen. Die Nacht hatte man in einer Scheune in Oranville zugebracht, am nächsten Morgen wird Jünger zur 9. Kompanie zugeteilt und bezieht Posten in der Schule des Ortes.
"Plötzlich krachte es ziemlich in unserer Nähe. Aus allen Häusern liefen Soldaten auf die Straße. Dann pfiff es dreimal dicht über uns hinweg. Alles lachte und niemand lief, aber jeder senkte den Kopf. Wenige Augenblicke später wurden die ersten Getroffenen auf Zeltbahnen herangetragen. Der erste, den ich sah, war blutüberströmt und rief ein heiseres, ersticktes zu Hilfe, zu Hilfe. Dem zweiten hing das Bein lose am Schenkel. Es waren 9 Mann getötet, darunter der Musikdirektor Gebhardt. Es wurde von Spionage gesprochen, da unser Dorf erst seit gestern befeuert wurde. Wir standen längere zeit hinter einer Böschung am Dorf und gingen dann wieder hinein. Ich kam nachher am Portal des Schlosses vorbei. Eine Granate war in die linke Ecke eingeschlagen. Einige große Blutlachen röteten die Straße und am Pfeiler klebte Hirn."
Von Goethe weiß man, dass er Kranke mied, Beerdigungen fernblieb, Vergänglichkeit und den Tod nach Kräften ignorierte, weil er sie im Grunde seines Herzens nicht akzeptierte. Er war nicht bereit, sie als Teil der Realität anzuerkennen. Ernst Jünger hielt es genau umgekehrt. Für ihn war nichts realer als der Tod. Nicht zuletzt darin lag seine radikale, auf seine Zeitgenossen oft verstörend wirkende Modernität.
Zwei Tage nach dem Anblick der ersten Toten schreibt er:
"Ich bin sehr neugierig, wie sich eine Schrapnellbeschießung ausmacht. Im Allgemeinen ist mir der Krieg schrecklicher vorgekommen, wie er wirklich ist. Der Anblick der von Granaten zerrissenen hat mich vollkommen kalt gelassen, ebenso die ganze Knallerei, trotzdem ich einige Male die Kugeln sehr nahe habe singen hören. Im Allgemeinen sind mir die Kälte und die Nässe in unsern Erdlöchern das Unangenehmste."
Maulheldentum? So könnte man denken. Aber hier pfeift kein Pennäler im Wald. Zwei Tage später, er ist kaum eine Woche im Feld, sieht Jünger mit an, wie einem Mann neben ihm eine Kugel den Kopf durchschlägt. Der Mann stand geschützt hinter dem eisernen Schutzschild der Maschinengewehrstellung, aber die Kugel fand ihr Ziel durch den winzigen Ausguck. Jüngers Kommentar:
"Wer es haben soll, den trifft auch."
Freilich gilt auch der Umkehrschluss: Wer noch nicht an der Reihe ist, der überlebt. Und zwar fast alles.
Dreizehn Mal wird Ernst Jünger verwundet, immer wieder entgeht er dem Tod um Haaresbreite. Als der Krieg endet, ist er mit seinen 23 Jahren der zweitälteste Kompanieführer seiner Einheit. Sechzig Prozent der Gefallenen, so berichtet Helmuth Kiesel in seinem unbedingt zur Lektüre empfohlenen Nachwort, gehörten zur Altersgruppe der Neunzehn- bis Neunundzwanzigjährigen. Im letzten Kriegsjahr lag das Durchschnittsalter der Gefallenen bei neunzehneinhalb Jahren. Jünger überlebte – überlebte, beobachtete und notierte. Jeder Fleischfetzen, jeder Knochen, jeder durchschossene Helm, jeder von einem verfaulenden Fleischrest wie mit einem widerlich stinkenden Film überzogene Uniformfetzen wird registriert – sei es ein Beinstumpf, ein Beckenknochen, dessen Bestimmung Stolz auf die im Feld erworbenen anatomischen Kenntnisse hervorruft, oder ein Stück von der Schädeldecke des Leutnants Eiwald:
"ganz weiß, ohne Haare und Hirn, nur etliche kleine Äderchen waren zu sehen."
Ab und an malt Jünger einen Totenkopf in seine Hefte oder zeichnet den Knochenmann als apokalyptischen Reiter, der seinen Gaul gegen eine dahinsausende Granate eingetauscht hat. Memento mori- und Vanitas-Gedanken sind ihm durchaus nicht fremd, und gelegentlich erinnert ihn die Szenerie der Zerstörung an ein Böcklin-Gemälde. Aber das Sterben ist von einer alles durchdringenden Gegenwärtigkeit und bedarf keiner Symbolisierung, keiner Überhöhung. Frühere Völker sollen aus den Schädeln ihrer besiegten Feinde getrunken haben, der junge deutsche Offizier liebäugelt mit urbaneren Genüssen:
"Heute Nachmittag fand ich in der Nähe der Latrine von der Festung Altenburg zwei noch zusammenhängende Finger- und Mittelhandknochen. Ich hob sie auf und hatte den geschmackvollen Plan, sie zu einer Zigarrenspitze umarbeiten zu lassen. Jedoch es klebte, genau wie an der Leiche im Stacheldrahtverhau bei Combres noch grünlichweißes verwestes Fleisch zwischen den Gelenken, deshalb stand ich von meinem Vorhaben ab. Um 7 zogen wir wieder in vorderste Linie."
Das Dandytum, das sich mit der morbiden Zigarrenspitze verbindet, wird abgewehrt, denn in Jünger bildet sich ein anderes Ideal des Soldaten heran. Jünger klassifiziert nicht nur die Granaten anhand ihrer Fluggeräusche, er berechnet den Munitionsaufwand und dessen Kosten und lässt sich die gewaltige Infrastruktur zeigen, die im Hinterland dafür sorgt, dass die Truppen an der Front ernährt und versorgt werden können. Wenn der Krieg industrialisiert ist, muss dann nicht der Soldat zum Arbeiter werden? In einer der wenigen längeren, zusammenhängenden Textpassagen der ersten Kriegsjahre tritt neben das Ideal des Kriegers plötzlich ein ganz anderes:
"Der Moderne Infanterist ist Erdarbeiter, Bergmann, Zimmermann, kurz ein Mann, der alles versteht."
Jünger beginnt den Krieg als Maschinerie zu begreifen, und den Menschen, gleich welcher Nation, als Teil des Materials, mit dem diese Maschinerie unablässig gefüttert werden muss. Das grünlichweiß verweste Fleisch am französischen Mittelhandknochen oder der bluttriefende Oberschenkel des jungen deutschen Offiziers Ernst Jünger: Material, das eine wie das andere. Dies anzuerkennen und zugleich die eigene Individualität zu behaupten, war die Aufgabe, vor die sich Jünger gestellt sah. Dieses Projekt konnte nur gelingen, wenn der Krieg als solcher in seiner Sinnhaftigkeit nicht infrage gestellt wurde.
Der entscheidende Schritt, den Jünger vollzog, das zeigt dieses Tagebuch deutlich, ist nicht die Ästhetisierung des Schreckens, sondern noch davor die Affirmation von Tod und Vernichtung als überzeitlichen Phänomenen, deren Legitimation auch durch ihre industrialisierte Ausprägung nicht ausgehöhlt werden kann. Das schließt gelegentliche Zweifel freilich nicht aus. Nach elf Monaten auf den Schlachtfeldern notiert er:
"Lange schon bin ich im Krieg, schon manchen sah ich fallen, der wert war zu leben. Was soll dies morden und immer wieder morden? Ich fürchte, es wird zu viel vernichtet und es bleiben zu wenig, um wieder aufzubauen. Vorm Kriege dachte ich wie mancher: nieder, zerschlagt das alte Gebäude, das neue wird auf jeden Fall besser. Aber nun - es scheint mir, das Kultur und alles Große langsam vom Kriege erstickt wird. Der Krieg hat in mir doch die Sehnsucht nach den Segnungen des Friedens geweckt.
Doch genug der Wachstubenphilosophie! In einigen Tagen sollen wir neue Gewehre bekommen, das ist ein verdächtiges Zeichen. Eines Tages in unsrer alten Stellung wird’s heißen: Alarm. Es geht ins Gefecht, das wird wieder mal gut tun."
Und vier Monate später, am 29. März 1916, seinem Geburtstag, notierte er fröhlich:
"Mir macht das Kriegsleben jetzt gerade den richtigen Spaß, das ständige Spiel mit dem Leben als Einsatz hat einen hohen Reiz. Man lebt, man erlebt, man gelangt zu Ruhm und Ehren, das alles nur um den Einsatz eines armseligen Lebens."
Der Zweck seines Buches, so resümierte Ernst Jünger am 10. August 1918, dem Tag, mit dem seien Aufzeichnungen enden, sei es, dem Leser sachlich zu schildern, was er erlebt und sich inmitten seines Regiments bei diesen Erlebnissen gedacht habe.
"Ich bin kein Mann der Feder, trotzdem hoffe ich, dass mancher, der dieses Buch aus der Hand legt, eine Ahnung davon bekommen hat, von dem, was von uns Infanteristen geleistet wurde. "
Worin aber besteht die Leistung, die uns aus diesen Aufzeichnungen entgegentritt? Politische Reflexionen haben in ihnen keinen Platz, ebenso wenig wie Nationalismus oder Standesdünkel. Töten, überleben, sich mannhaft verhalten, die Angst überwinden, sich panzern und beobachten – darum geht es. Was Jünger in seinem Kriegstagebuch festhält, ist der Prozess einer umfassenden Panzerung, die im Angesicht der permanenten Gefahr der Auslöschung erfolgt. So wird einer tatsächlich nicht zum Mann der Feder, wohl aber zum unberührten und unberührbaren Stenografen des Todes.
Besprochen von Hubert Spiegel
Ernst Jünger: "Kriegstagebuch 1914-1918"
Herausgegeben von Helmuth Kiesel, Klett-Cotta Verlag 2010, 654 Seiten, 32,95 Euro