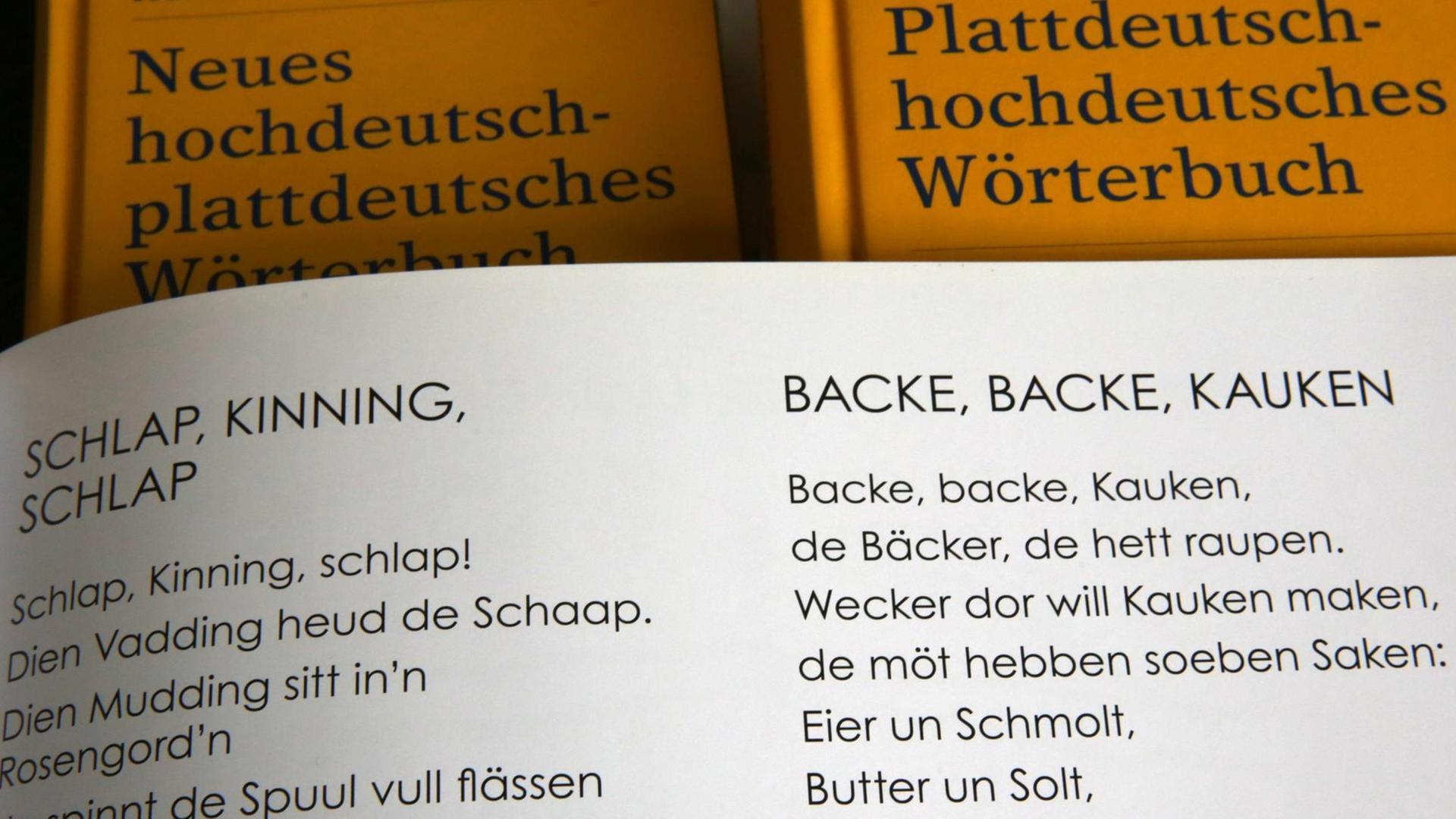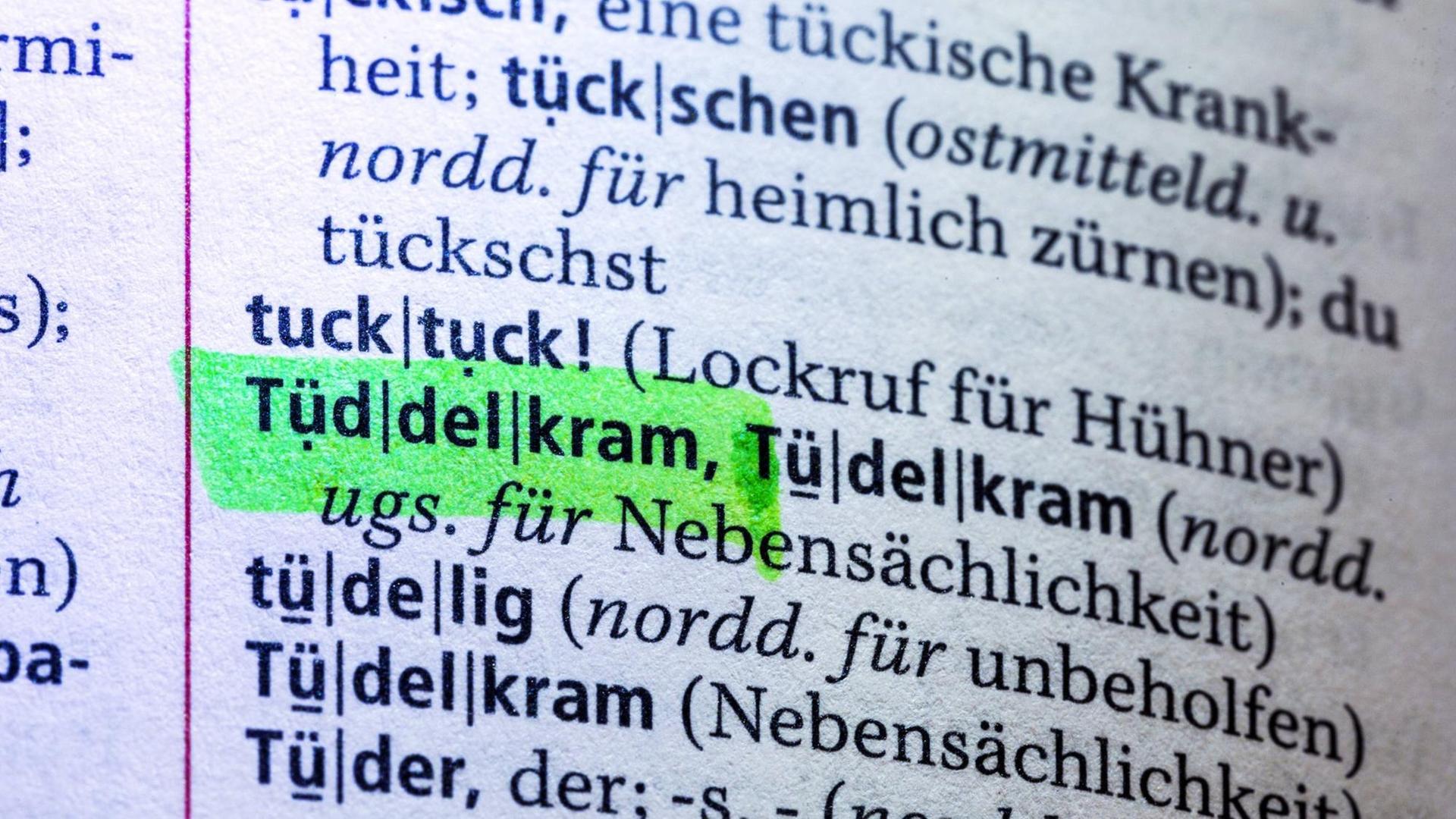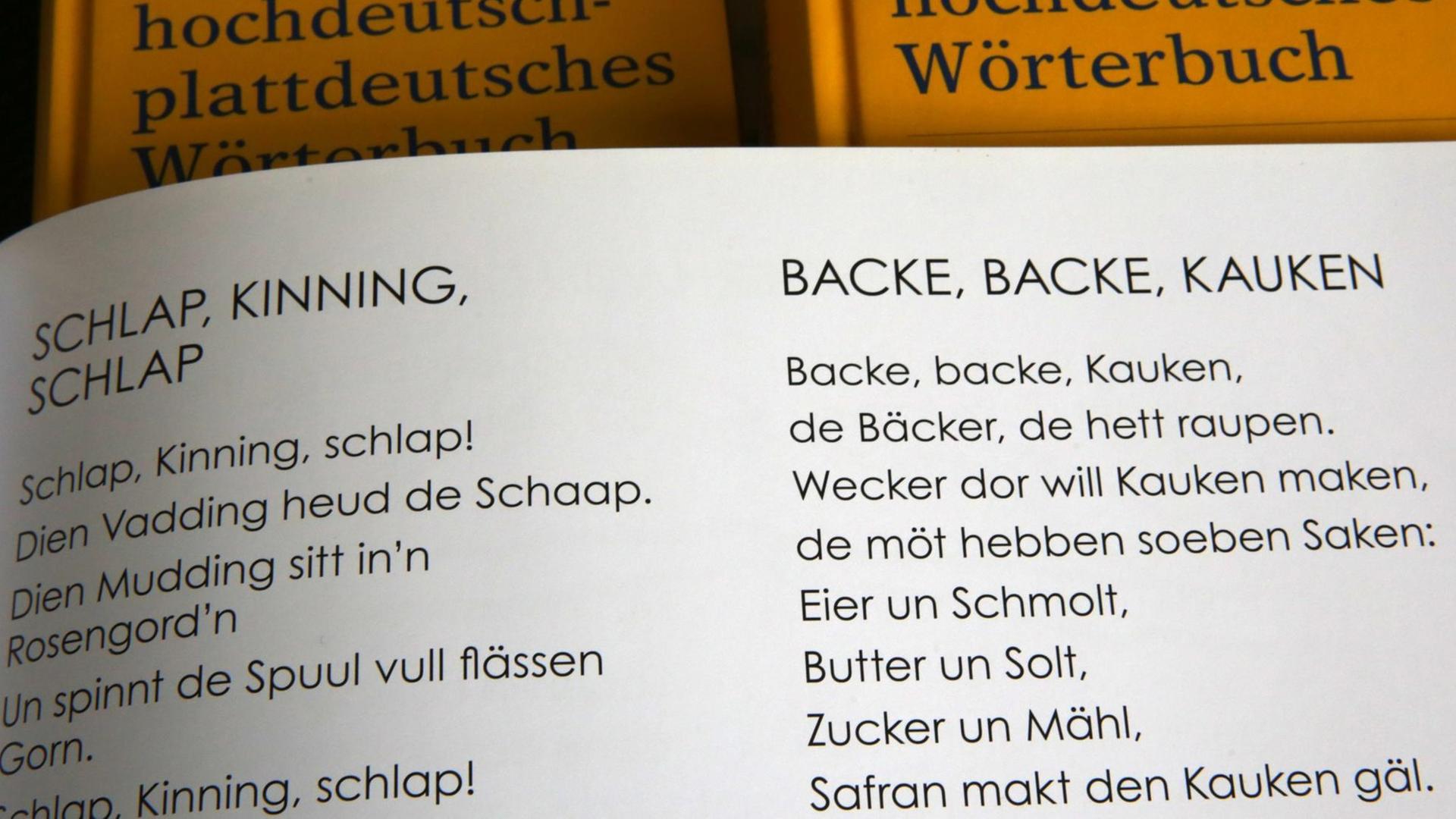Michael Köhler: Heute am ersten Advent, da beginnen wir mit einer weihnachtlichen Serie über unsere Anfänge, unsere Wurzeln, unser Erbe, unsere Traditionen. Und was liegt da näher, als mit der Sprache zu beginnen. Sie steht buchstäblich am Anfang. Und nicht nur, wer Kinder hat, weiß, wie bedeutsam die ersten Worte sind. Zur Welt kommen, heißt zur Sprache kommen, eine Sprache für die Welt und für sich und andere finden. Anfangen heißt, sich zur Sprache durchzuringen. Dass am Anfang das Wort war, sagt nicht nur die Bibel, Menschsein heißt sprechen können, in ein Gespräch zu geraten.
Der Kölner Germanist Karl-Heinz Göttert, er hat in diesem Jahr einige Bücher über Luther vorgelegt, in den letzten Jahren eine Biografie der deutschen Sprache und über Hochdeutsch, und ihn habe ich gefragt: Jahrhundertelang sprach ja niemand etwas anderes als Dialekt. Unter modernen Medienbedingungen wird aber erst seit knapp 100 Jahren Hochdeutsch gesprochen. Sterben die Dialekte als ursprüngliche erste Sprache aus?
Karl-Heinz Göttert: Hängt natürlich von den Eltern ab. Es gibt Eltern, die reines Hochdeutsch sprechen, und es gibt auch Eltern, die glauben, sie müssten reines Hochdeutsch sprechen. Wenn man das Glück hat, dass die Eltern in dieser Hinsicht normal sind und jetzt nicht von Ängsten geplagt, dass das arme Kind in der Schule Schwierigkeiten bekommt, wenn man ein bisschen Dialekt dabei hat, wenn die Kinder dieses Glück haben, dann werden sie mit einer Eigensprache vertraut gemacht, die sie bis ins Alter begleitet, woran sie sich erinnern und mit der sie auch dann so ein Stück Wohlfühlen verbinden. Das denke ich schon und ich glaube auch, dass das so bleiben wird.
Aber wir verfügen ja alle über mehrere Sprachen. Man kann jetzt wissenschaftlich sagen, das sind jetzt keine Sprachen, sondern Register – also ein Register für hier zum Beispiel, was wir hier machen, was sich an ein größeres Publikum wendet, dann ein privates Register. Es gibt keinen vernünftigen Menschen, der zu Hause so spricht wie vor dem Mikrophon hier, würde ich mal sagen. Das wäre ja entsetzlich. Wenn ich mit meiner Frau Stress habe, das merkt die an meiner Sprache. Das ist auch klar. Und so setzen wir unsere Sprachkenntnisse auch ein.
Riesiger Unterschied zwischen mündlich und schriftlich
Köhler: Nun will ich das jetzt nicht groß problematisieren, denn nicht jeder verfügt über so eine Sprachsouveränität. Für viele fällt, sagen wir mal, Hochdeutsch und Dialekt schon in eins. Worauf ich hinaus will: Was ist denn das, was wir hier eigentlich sprechen? Man sagt gerade jetzt, wo wir an 500 Jahre Luther erinnern, das ist Luther-Deutsch, das ist Hochdeutsch. Etwas präziser gefragt: Was ist das, eine Mischung aus meissnischem Deutsch, ein bisschen was an Hochsprache, an Amtssprache, ein Schuss Preußisch ist auch noch drin?
Göttert: Es ist zunächst einmal der Versuch, Schriftsprache ins Mündliche zu transportieren. Das ist ja nun das Entscheidende gewesen. In Luthers Zeiten gab es einen riesigen Unterschied zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Im 18. Jahrhundert gab es den auch noch ganz gravierend. Goethe sprach kein Hochdeutsch. Der schrieb ganz gut Deutsch, denken wir mal, das wollen wir mal unterstellen, aber sprach ein absolut reines Frankfurterisch. So war das bis ins 19. Jahrhundert hinein. Was wir hier sprechen, das ist tatsächlich erst am Ende des 19. Jahrhunderts so gewachsen, dass man die Schriftsprache ins Mündliche nimmt.
Köhler: So, wie wir sprechen, sprechen wir gerade mal 100 Jahre?
Göttert: Ja, höchstens.
Köhler: Ein bisschen mehr?
Göttert: Ja. Man kann auf Siebs verweisen, deutsche Bühnenaussprache 1898, und dann hat sich Duden angeschlossen später und hat das dann übernommen und in den Redaktionen müsste das eigentlich herumliegen. Aber das hat sich auch nie vollkommen durchgesetzt. Wenn Sie mal den Siebs von 1898 aufschlagen, dann sehen Sie, was da alles gefordert wird. Zum Beispiel, dass man das Gewehr, mit dem man schießt, von der Gewähr, die man leistet, unterscheidet, also Gewehr und Gewähr, aber nicht kräftig und heftig. Das kurze Ä und das kurze E wird gleich gesprochen; das lange Ä und das lange E wird unterschiedlich gesprochen. Oder solche Sachen: Man sagt, mit tief'm Dialekt, mit tief'm ohne das E, aber mit rotem.
Wenn Sie diese Forderungen lesen, dann werden Sie sagen oder werden Sie sehen, das hat sich nie durchgesetzt. Ich wollte sagen, das Hochdeutsche, das wurde dann auch in eine Kunstsprache versetzt, die es so allenfalls bei Radiosprechern gegeben hat. Aber ich will behaupten, die haben es auch nicht beherrscht.
Goethe reimte Kinder auf Winter – klang das für ihn gleich?
Köhler: Sie machen es mir leicht, weil Sie zwei wichtige Stichworte haben fallen lassen, nämlich einmal Goethe und auch Bühnensprache, also Sprachvorbilder. Unsere Sprachvorbilder kommen ja, wenn sie denn nicht aus der Nachbarschaft oder der Familie kommen, heute über weite Strecken: aus der Zeitung oder modernen Medien. Wir lassen jetzt mal das Spezialproblem bei Seite, dass Kinder heute gerne Artikel und Präpositionen weglassen, solche Redundanzphänomene wie Verkürzungen.
Goethe sagt 1824 zu Eckermann, dass er auch in seiner lieben Stadt Weimar die lächerlichsten Missgriffe erlebt, nämlich dass in den hiesigen Schulen die Kinder nicht angehalten werden, das B vom P, das D vom T zu unterscheiden. Aus einem solchen Munde klingt dann Pein wie Bein, Pass wie Bass, Teckel wie Deckel und so weiter. Aus dem Küstenbewohner wird ein Kistenbewohner, aus dem Türstück ein Tierstück und so weiter und so weiter. Goethe macht sich übers Thüringische lustig. Eigentlich hat er gar keine Gründe dazu: Sein Hessisch war auch miserabel, oder?
Göttert: Genau. – Übrigens: Es gibt diese berühmten Reime wie Kinder auf Winter. Daran kann man ablesen, dass er gesagt hat, in diesem Winter und so weiter auf Winder gereimt. Er konnte es auch nicht. Das schlägt dann auch in die Schrift noch durch.
Köhler: Sind die Dialekte, um sie noch mal stark zu machen, so etwas wie ein Reservoire oder ein Archiv unserer Herkunft.
Göttert: Ja, ja. Walser hat gesprochen von der Goldwährung der Sprache. Das ist so eine ganz nette Metapher. Nicht das Hochdeutsche ist die eigentliche Reserve, sondern der Dialekt. Da spielt er darauf an, auch mit einem gewissen Recht, dass das die natürliche Sprache ist – natürlich in dem Sinne, dass sie von Mutter zu Kind übertragen wird und so weiter und so fort –, während das Hochdeutsche die richtig künstliche ist.
Etwas ausdrücken und sich ausdrücken
Köhler: Noch einmal abschließend zu diesem Komplex. Trotzdem lässt sich nicht leugnen, dass das, was wir sprechen – und ich habe Sie eingeladen auch als Verfasser zahlreicher Bücher über Luther; ich glaube, drei oder vier sind es mindestens, die dieses Jahr von Ihnen erschienen sind –, das ist dann doch die Latte, an der wir uns messen müssen. Das moderne Deutsch fußt dann letztlich doch darauf, oder?
Göttert: Ja, aber man muss doch deutlich sagen: eben diese Schriftsprache. Denn Luther hat – der saß in Sachsen, wie man weiß; er sagt selbst, dass er sich nach der sächsischen Kanzlei gerichtet hat, und damit meint er diese Verschriftung, die in einer Kanzlei gepflegt wird, dass die Meissener Kanzlei auch noch mit der kaiserlichen zusammengearbeitet hat. Luther sah das Problem, dass man für eine Schriftsprache eine gemeinsame Grundlage braucht, und das ist in der Schriftsprache geschehen.
Luther hat keine Sekunde an die Mündlichkeit gedacht. Übrigens er selbst hat sich geäußert dazu und gesagt, dass ihm das Niederdeutsche am liebsten ist, das Brandenburgische. Das Sächsische oder Thüringische, das er vom Elternhaus her kannte, hat er noch nicht mal an die erste Stelle gestellt. Aber bei Luther kommt es darauf an, dass es sich um die Bibel und damit um die Verbreitung in Deutschland handelt und damit um die Schriftsprache.
Wir haben, um es noch mal zu sagen, in der Schriftsprache einen Druck zur Einheit gehabt, den man in der Mündlichkeit so nicht verspürt hat. Deshalb hat es da auch so viel länger gedauert.
Köhler: Wir sprechen nicht nur etwas aus, Herr Göttert, wir teilen uns nicht nur mit, sondern wir drücken uns damit auch aus. Es ist auch der höchste Grat von Eigentlichkeit, von Subjektivität, auch wenn wir die gleichen Worte teilen.
Göttert: Ja, da könnte man sich auf Goethe berufen, auf diese Unterscheidung, etwas ausdrücken und sich ausdrücken. Das war natürlich immer bekannt, dass man in der Sprache etwas ausdrückt. Dann wird im Sturm und Drang entdeckt und dann natürlich in der Klassik, dass es etwas gibt, was weit darüber hinausgeht, dass man bei diesem etwas ausdrücken auch sich selbst ins Spiel bringt und sich ausdrückt.
"Für die Arbeitswelt braucht man gemeinsame Sprache"
Köhler: Nationale Einheit oder Integration bedarf nicht zwingend der sprachlichen Einheit, oder?
Göttert: Ich will es mal so sagen: Für die Arbeitswelt braucht man eine gemeinsame Sprache. Deshalb kann ich sehr gut verstehen, wenn gesagt wird, diejenigen, die hier herkommen, müssen Deutsch lernen, weil sie sich sonst nie integrieren können. Das ist auch etwas, was eigentlich kein Mensch bestreitet.
Eine andere Seite ist, ob Deutschland einsprachig sein muss, ob jeder nur dann Deutscher ist, wenn er Deutsch kann und Deutsch spricht. Das ist eine ganz andere Frage. Wir können viel mehr aushalten an Sprachen und wir halten auch sehr viel aus. Ich habe eine Statistik gesehen: In Deutschland werden im Moment über 100 Sprachen gesprochen. Das heißt aber nicht, dass diese Sprecher nicht auch Deutsch können beziehungsweise lernen sollen müssen und so weiter. Das ist der Unterschied. Es kommt nicht darauf an, dass wir hier nur Deutsch hören in Deutschland.
Köhler: Zum Abschluss doch noch mal was Sonntägliches. Als ich hörte, dass wir zwei miteinander sprechen, sagte ich spontan: Na ja, dann muss ich halt mit ihm über die berühmte Übersetzungsszene im "Faust" sprechen. Am Anfang war das Wort, ich kann das Wort. Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, Ich muss es anders übersetzen. Da ist sozusagen alles gemeinsam drin, nämlich erstens, dass wer spricht immer auch übersetzt, zweitens, dass Faust selber ein bisschen Luther spielt, und drittens, dass das einfach der Text der Deutschen ist.
Göttert: Ja, ja. Ich kann mir jetzt nur was herauspicken: dieses Übersetzen. Das hat mich sehr beschäftigt. Ich habe mich mit der Luther-Übersetzung in einem dickeren Buch befasst und bin eigentlich darauf gekommen erst im Laufe der Zeit, wie sehr uns Übersetzung überhaupt geprägt hat. Zum Schluss lief es auf die These hinaus, dass unsere Kultur eigentlich eine Übersetzungskultur ist.
"Beim Übersetzen finden wir zu uns selbst"
Wie hat Luther seine Theologie begriffen? Indem er übersetzte. Beim Übersetzen kommt es raus. Da musste er den Begriff der Gerechtigkeit, da kann er so viel drüber reden und schreiben wie er will. Aber wenn er den Begriff der Gerechtigkeit dann in der Bibel vorfindet, die Justizia, und muss übersetzen, dann ist er gezwungen, an der Stelle das zu tun, was er dauernd theoretisch versucht hat. Das heißt, beim Übersetzen finden wir im Grunde genommen zu uns selbst, und das ist etwas Überraschendes, weil alle denken, Übersetzen, das ist so was Mechanisches. Aber man muss schon sagen, dass unsere Kulturen davon profitiert haben, dass Verstehensprozesse eigentlich durchs Übersetzen gefördert worden sind.
Köhler: Und das nicht nur in einer anderen Sprache, sondern das fängt ja schon damit an: Das Bild des Über-Setzens von einem Ufer ans andere hat es ja in sich. Das heißt, man macht einen Weg. Man führt nicht nur ein Gespräch, man gerät vielleicht auch in ein Gespräch. Und wenn es gut geht, entdeckt man in der Sprache etwas, was sie bereit hält, aber von dem man es vorher nicht wusste.
Göttert: Ja, ja. Wo Sie das sagen: Das wissen eigentlich ganz wenige, dass bei dem Übersetzen auch diese Metaphorik des Übersetzens, Hinübersetzens tatsächlich mitschwingt. Normalerweise denkt man beim Übersetzen nur an das Übertragen. Die eine Sprache wird in die andere übertragen. Aber wenn man hinübersetzt an ein anderes Ufer, wenn man jemanden hinüberträgt, dann merkt man, dass das alles nicht so einfach ist, sondern dass da eine große Leistung hinter steht, bei der man womöglich erst versteht, worum es eigentlich geht.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.