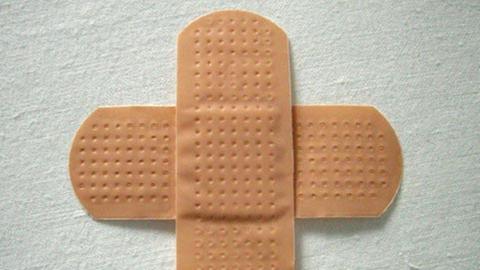"Es ist nur ein kleiner Pieks”, sagen Ärzte, wenn sie eine Spritze mit Impfstoff in den Oberarmmuskel stechen. Dennoch kann das durchaus Schmerzen bereiten. US-Forscher des Massachusetts Institute of Technology, kurz: MIT, arbeiten an einem neuen Impfverfahren, bei dem nur noch ein harmloses Pflaster auf die Haut geklebt werden muss. Das Pflaster ist mit Hunderten feinen Mikronadeln aus Kunststoff bestückt. Sie dringen nur etwa einen halben Millimeter in die Oberhaut ein und reichen so nicht tief genug, um Nerven zu treffen. Die Nadeln sind mit mehreren, nanometerdünnen Schichten aus dem Impfstoff und einem schützenden Polymer überzogen.
"Wenn wir das Pflaster auf die Haut auftragen, können wir es schon nach wenigen Sekunden wieder abziehen. Dabei bleibt der dünne Film mit dem Impfstoff in der Haut zurück. Wir sprechen von einer Art Tattoo. Über Tage oder sogar Wochen gibt es langsam den Impfstoff ab. Das ist anders als bei den bisher bekannten Mikronadel-Impftechniken. Dort wird stets der komplette Wirkstoff auf einmal freigesetzt. Das lässt dem Körper aber häufig nicht genügend Zeit, die Immunreaktion wie gewollt aufzubauen."
Paula Hammond ist Chemikerin am MIT. Sie erforscht den Einsatz von Nanotechnologie bei Medizinprodukten. Für das Impfpflaster entwickelte sie gemeinsam mit Kollegen eine spezielle Technik, um die Mikronadeln zu beschichten. Bis zu 20 ultradünne Lagen aus dem Kunststoff Polylactid und einem Wirkstoff werden abwechselnd auf die Mikronadeln aufgesprüht. Polylactid basiert auf Milchsäure und wird im Körper mit der Zeit rückstandslos abgebaut. So wird Schicht für Schicht der Impfstoff langsam freigegeben. Und das funktioniert nicht nur mit Proteinen, sondern auch mit reiner DNA als Wirkstoff.
"Das ist besonders spannend. Denn wenn die DNA in die Zellen gelangt, liefert sie die Baupläne zur Produktion der gewünschten Antigene. Diese Technik lässt sich auf ein breites Spektrum von Krankheiten übertragen."
Das Impfen mit DNA, etwa gegen eine Infektion mit HIV, wird in vielen Labors schon länger erprobt, allerdings nur mit mäßigen Erfolgen. Zwar bilden Zellen tatsächlich die durch die DNA codierten Antigene, auf die der Körper mit einer Immunantwort reagiert. Doch bisher gab es keine praktikable Impftechnik, die genügend DNA in die Zellen einschleust, um eine ausreichend starke Immunreaktion zu erreichen. Die in die Haut gespritzte DNA wird größtenteils schon abgebaut, bevor sie in die Zellen eindringen kann. Die nanobeschichteten Impfpflaster schneiden im Vergleich viel besser ab, berichtet Paula Hammond.
"Bei unserer Technik ist die DNA ja verkapselt, dadurch ist sie geschützt und wird nicht gleich abgebaut. Die Zellen nehmen dann die DNA effektiver auf und bilden mehr Antigene, die zur Immunität führen."
Versuche an Hautproben von Affen zeigten, dass die Zellen 140 Mal mehr Antigene bildeten, wenn die DNA mit dem Impfpflaster eingebracht und nicht einfach nur eingespritzt wurde. Ob solche Erfolge auch bei Menschen möglich sind, müssen klinische Studien erst noch zeigen. Bevor damit angefangen werden kann, sind nach Angaben von Paula Hammond weitere Tierversuche nötig. Das wird einige Jahre dauern.
In der Zwischenzeit wollen die Forscher auch die Haltbarkeit der Impfpflaster genauer testen. Da die DNA zwischen den Polylactid-Lagen auf den Mikronadeln gut geschützt ist, muss sie nicht gekühlt werden, sondern sogar bleibt bei Raumtemperatur intakt und wirksam.
"Wir gehen davon aus, dass wir die Mikronadel-Impfungen so designen können, dass sie mehrere Monate lang lagerfähig sind und vielleicht sogar noch länger halten. Dadurch wird der Transport sehr einfach."
Besonders interessant wäre diese Eigenschaft der Impfpflaster für ihren Einsatz in Entwicklungsländern. Gerade in ärmeren, ländlichen Regionen ist es bis heute nicht immer möglich, die nötige Kühlkette und die Spritzenversorgung für großangelegte Impfkampagnen sicherzustellen. Mikronadelpflaster ließen sich einfach verschicken und an die Menschen verteilen. Diese müssten sie nur noch aufkleben und wieder abziehen, um geimpft zu sein.
"Wenn wir das Pflaster auf die Haut auftragen, können wir es schon nach wenigen Sekunden wieder abziehen. Dabei bleibt der dünne Film mit dem Impfstoff in der Haut zurück. Wir sprechen von einer Art Tattoo. Über Tage oder sogar Wochen gibt es langsam den Impfstoff ab. Das ist anders als bei den bisher bekannten Mikronadel-Impftechniken. Dort wird stets der komplette Wirkstoff auf einmal freigesetzt. Das lässt dem Körper aber häufig nicht genügend Zeit, die Immunreaktion wie gewollt aufzubauen."
Paula Hammond ist Chemikerin am MIT. Sie erforscht den Einsatz von Nanotechnologie bei Medizinprodukten. Für das Impfpflaster entwickelte sie gemeinsam mit Kollegen eine spezielle Technik, um die Mikronadeln zu beschichten. Bis zu 20 ultradünne Lagen aus dem Kunststoff Polylactid und einem Wirkstoff werden abwechselnd auf die Mikronadeln aufgesprüht. Polylactid basiert auf Milchsäure und wird im Körper mit der Zeit rückstandslos abgebaut. So wird Schicht für Schicht der Impfstoff langsam freigegeben. Und das funktioniert nicht nur mit Proteinen, sondern auch mit reiner DNA als Wirkstoff.
"Das ist besonders spannend. Denn wenn die DNA in die Zellen gelangt, liefert sie die Baupläne zur Produktion der gewünschten Antigene. Diese Technik lässt sich auf ein breites Spektrum von Krankheiten übertragen."
Das Impfen mit DNA, etwa gegen eine Infektion mit HIV, wird in vielen Labors schon länger erprobt, allerdings nur mit mäßigen Erfolgen. Zwar bilden Zellen tatsächlich die durch die DNA codierten Antigene, auf die der Körper mit einer Immunantwort reagiert. Doch bisher gab es keine praktikable Impftechnik, die genügend DNA in die Zellen einschleust, um eine ausreichend starke Immunreaktion zu erreichen. Die in die Haut gespritzte DNA wird größtenteils schon abgebaut, bevor sie in die Zellen eindringen kann. Die nanobeschichteten Impfpflaster schneiden im Vergleich viel besser ab, berichtet Paula Hammond.
"Bei unserer Technik ist die DNA ja verkapselt, dadurch ist sie geschützt und wird nicht gleich abgebaut. Die Zellen nehmen dann die DNA effektiver auf und bilden mehr Antigene, die zur Immunität führen."
Versuche an Hautproben von Affen zeigten, dass die Zellen 140 Mal mehr Antigene bildeten, wenn die DNA mit dem Impfpflaster eingebracht und nicht einfach nur eingespritzt wurde. Ob solche Erfolge auch bei Menschen möglich sind, müssen klinische Studien erst noch zeigen. Bevor damit angefangen werden kann, sind nach Angaben von Paula Hammond weitere Tierversuche nötig. Das wird einige Jahre dauern.
In der Zwischenzeit wollen die Forscher auch die Haltbarkeit der Impfpflaster genauer testen. Da die DNA zwischen den Polylactid-Lagen auf den Mikronadeln gut geschützt ist, muss sie nicht gekühlt werden, sondern sogar bleibt bei Raumtemperatur intakt und wirksam.
"Wir gehen davon aus, dass wir die Mikronadel-Impfungen so designen können, dass sie mehrere Monate lang lagerfähig sind und vielleicht sogar noch länger halten. Dadurch wird der Transport sehr einfach."
Besonders interessant wäre diese Eigenschaft der Impfpflaster für ihren Einsatz in Entwicklungsländern. Gerade in ärmeren, ländlichen Regionen ist es bis heute nicht immer möglich, die nötige Kühlkette und die Spritzenversorgung für großangelegte Impfkampagnen sicherzustellen. Mikronadelpflaster ließen sich einfach verschicken und an die Menschen verteilen. Diese müssten sie nur noch aufkleben und wieder abziehen, um geimpft zu sein.