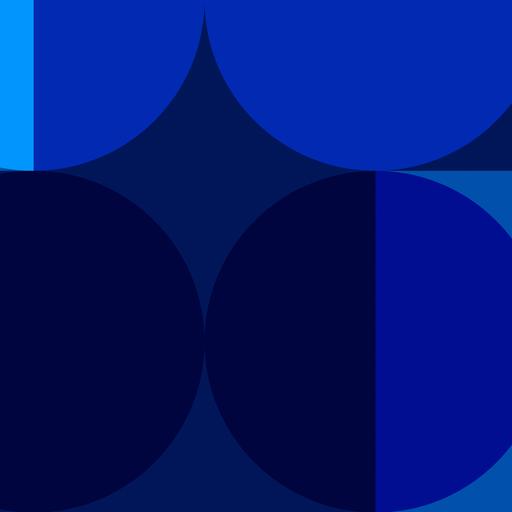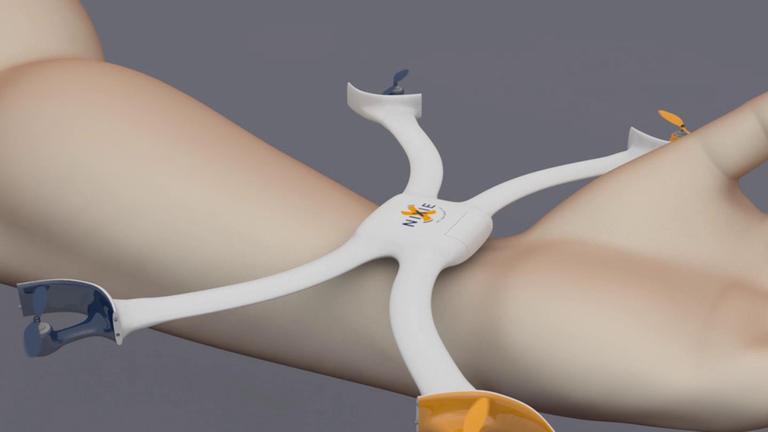Noch nie wurde so viel erzählt wie heute. Natürlich auch mit dem Bedürfnis nach möglichst vielen Likes. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass diese Likes wie Dopamin funktionieren – je mehr Bestätigung wir im Netz bekommen, desto mehr wollen wir davon haben. Was bedeutet das für unsere Selbstdarstellung? Der Literatur- und Medienwissenschaftler Roberto Simanowski meint:
"Früher gab es wenige, die Tagebuch schrieben. Heute schreiben alle über sich und stellen sich selbst dar auf den sozialen Netzwerken. Der Unterschied ist ein inhaltlicher, denn das ist kein retrospektiver Eindruck dessen, was ich erlebt habe, sondern es ist eine Notierung in der Gegenwart und eigentlich immer eher unreflektiert."
Reflexion bezieht sich auf das Vergangene
Das Nachdenken über das Erlebte kommt uns abhanden, sagt Simanowski, denn wer sich immer nur in der Gegenwart bewegt, der hat keine Distanz zu dem, was er erlebt hat. Die Reflexion bezieht sich auf das Vergangene. Außerdem problematisiert Simanowski die zunehmende Dokumentation des eigenen Lebens mit Fotos und Bildern und dementsprechend den immer spärlicheren Einsatz von Sprache. Sprache sei aber notwendig, um zum Erlebten Distanz zu entwickeln, um zu reflektieren und einzuordnen.
Geschichte wird nicht mehr vom Autor erzählt
Natürlich wurde das eigene Leben auch früher schon mit Fotos dokumentiert – im Fotoalbum oder beim Dia-Abend. Allerdings musste man die Bilder dort noch aussuchen, Zusammenhänge herstellen, gewichten, was einem wichtig war und was nicht. Wer auf Facebook auf seine Vergangenheit zurückblicken will, wird nicht nur mit einer Unmenge an Fotos konfrontiert, sondern genau dieses narrative Geflecht fehlt. Die Geschichte wird nicht mehr vom Autor erzählt, sondern mehr und mehr von den Freunden, die mit Likes markieren, was ihnen gefällt und vom Algorithmus, der daraus die rein mathematische Gewichtung der Quantität macht.