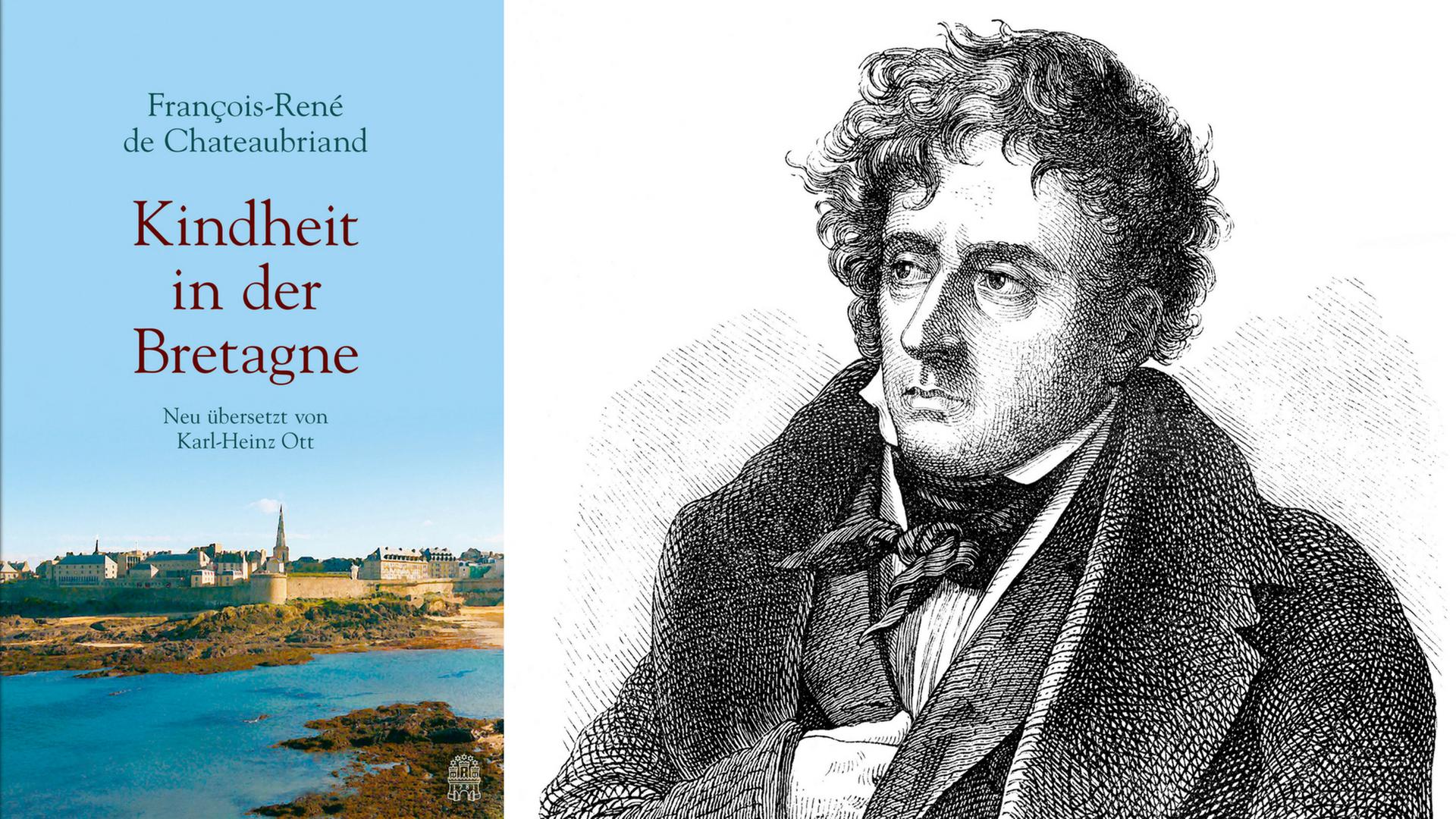
Er hat in seinem Heimatland Frankreich in etwa die Bedeutung wie Goethe für uns in Deutschland - der französische Schriftsteller und Politiker François-René de Chateaubriand. Morgen am 4. September vor 250 Jahren wurde der Spross einer bretonischen Adelsfamilie in Saint-Malo geboren. 1848 starb er in Paris. Ruhm erlangte Chateaubriand vor allen Dingen mit seinen rund 2000 Seiten umfassenden Memoiren "Erinnerungen von jeneits des Grabes". Der Schriftsteller und Übersetzer Karl-Heinz Ott hat Auszüge aus diesem der Romantik verpflichteten Werks in einer Neuübersetzung vorgelegt. Das Buch "Kindheit in der Bretagne" schlägt einen Bogen von der Geburt Chateaubriands, über die französische Revolution 1789 bis zu seinem Aufbruch nach Amerika. - Angela Gutzeit sprach mit Karl-Heinz Ott über diesen großen französischen Stilisten.
Angela Gutzeit: Karl-Heinz Ott, Sie sind nicht nur der Übersetzer dieses Memoiren-Bandes François-René Chateaubriands, sondern auch der Herausgeber, der eine bestimmte Auswahl getroffen hat, was die Erinnerungen dieses französischen Schriftstellers und Politikers angeht.- Was war Ihnen wichtig, in den Vordergrund zu stellen und eventuell in den vorherigen Ausgaben zu kurz kam?
Karl-Heinz Ott: Das waren zwei Dinge. Zum Ersten wollte ich versuchen, die Schönheit von Chateaubriands Sprache so gut es geht ins Deutsche rüberzuretten. Das ist nicht einfach bei Chateaubriand. Es ist aber, glaube ich, der wesentliche Grund, weshalb er hier lange nicht so berühmt ist wie in Frankreich. Der andere Grund bestand darin, dass die bisherigen Ausgaben ein wenig gesprungen sind, was die Kindheit und Jugend anbelangt und ein bisschen schneller auf die politischen Dimensionen, also auf den eher wachsenden Chateaubriand, zulaufen, und ich wollte eigentlich zeigen, was für ein großartiger Landschaftsschilderer er ist, wie er Atmosphären einfängt, wie er in einer Sprache, die, obwohl man ihn als Romantiker charakterisiert, im Grunde gar nicht so sehr romantisch ist, zumindest sie schwelgt nicht endlos in Gefühlen, sie zeigt eigentlich nicht permanent ein Innenleben, sondern sie schildert tatsächlich die Welt, sie schildert atmosphärisch die Sonnenuntergänge, die Heide in der Bretagne, das Meer und so weiter.
Gutzeit: Chateaubriand war Spross einer bretonischen Adelsfamilie, die allerdings nicht zu den einflussreichsten und wohlhabendsten des Landes gehörte, wenigstens war es so im späteren Verlauf. Die raue, klimatisch vom Meer beherrschte Bretagne hat spürbar Chateaubriands Werk und speziell seine Landschaftsschilderungen geprägt, wie Sie es auch im Nachwort sehr schön beschreiben und eben ja auch betont haben. Inwieweit hat denn eigentlich diese bretonische Herkunft Einfluss gehabt auf diesen Autoren und sein Werk?
Ott: Ich denke, das ist bei ihm so prägend wie wahrscheinlich nichts anderes. Das Raue war ja auch in der Familie da. Also so, wie er den Vater schildert, der besteht ja nur aus Rauheit, um es vorsichtig zu sagen, und die Landschaft beschreibt er aber in einer Weise, sodass das Raue eine – das klingt jetzt nach Phrase – herbe Schönheit gewinnt, aber es ist eine herbe Schönheit, und in seinem leider, soweit ich weiß, nie übersetzten Werk "Die Reise nach Jerusalem", von Paris nach Jerusalem, in dieser Reise schildert er das damals sehr heruntergekommene Griechenland, das noch von den Osmanen besetzt war und sagt, ich kann nicht verstehen, wie so viele Leute inzwischen, die natürlich alle damals nicht in Griechenland waren, von den alten Griechen schwärmen, wir haben doch die viel schöneren Küsten, und damit meint er natürlich die Bretagne.
Gutzeit: Was sofort auffällt bei diesem Text, und das ist sicherlich, finde ich wenigstens, auch Ihrer Übersetzungskunst geschuldet, das sind die Frische des Ausdrucks und die Intensität der Bilder. Das wirkt ja alles sehr nah und unmittelbar, zum Beispiel wie Chateaubriand seinen autoritären Vater, seine eher zartbesaitete Mutter beschreibt oder die Höllenqualen der Pubertät oder seine Unlust, geistlicher zu werden oder auf die Dauer Offizier zu bleiben, vor allen Dingen aber, mit welcher Ironie und Selbstironie und auch Reflexion über seine eigene Zukunft und über seinen Adelsstand, das finde ich ganz enorm, und das spricht unmittelbar an. Wie sehen Sie das?
Ott: Sie sagen das genau. Bei ihm fließen grandiose Landschaftsschilderungen in Schilderungen der Kindheit. Das geht alles ineinander über. Gleichzeitig ist natürlich immer schon die politische Reflexion da. Also das Reflexive, das politisch Orientierte, das weltgeschichtlich Orientierte und die sogenannten kleinen Dinge des Alltags sind bei ihm nie zu trennen. Das eine ergibt sich aus dem anderen, was übrigens Proust gegen Ende seiner "Recherche" an ihm gerühmt hat, dass er sagt, bei Chateaubriand kann man nie das Kleine vom Großen unterscheiden oder gar gewichten, es gibt nichts Kleines in diesem Sinne, und es gibt auch nicht die große Weltgeschichte, die das ganz andere wäre.
Gutzeit: Und das absolut Erstaunlichste ist, wie dieser Chateaubriand die epochale Bedeutung der Französischen Revolution 1789 erkannte, die er als Zeuge verfolgte. Er wusste ja, seine Welt, so wie er sie kennt – das entnehme ich jetzt auch diesem Text –, geht unter, und etwas Neues entsteht, das er zunächst ja durchaus begrüßt. Wie würden Sie denn die Position zur Revolution dieses aufgeklärten Adligen beschreiben? Das ist ja durchaus eine ambivalente. Er hat sich dort auch durchaus als Adliger im Zwiespalt befunden.
Ott: Ja, wobei man sagen muss, der bretonische Adel war natürlich vollkommen gegen Versailles. Die Bretonen waren immer widerständig, auch die Adelsseite, und gerade Chateaubriands Familie war deutlich verarmt, auch wenn die in einem Koloss von altem Bunkerschloss gelebt hatten, das ja in seiner Schilderung was Gespenstisches bekommt, aber bei Chateaubriand besteht eigentlich alles aus Ambivalenz. Also ich glaube, der Begriff Ambivalenz trifft bei ihm auf jede Gefühlsregung zu, und wie er die Revolution schildert, das zeigt sich eigentlich am besten in diesem Kontrast, wie er noch wenige Stunden, bevor der Aufseher der Bastille erschlagen wird, was er persönlich miterlebt auf der Straße, wie er noch wenige Stunden zuvor in Versailles im Garten Marie-Antoinette trifft mit den beiden Kindern, und einerseits ist er gerührt von diesem Treffen und von ihrem Blick, andererseits kommt ein kleiner Spott dabei, wie die beiden Kinder schon so aussehen, als wüssten sie, dass sie für die Krone geboren sind. Wenige Stunden danach erlebt er Mob und Meute in Totschlagmanier in Paris. Das ist eine höchst aufgewühlte Stimmung, und er mittendrin, und man hat zuerst den Eindruck, als könne er nur Abscheu vor diesem Mob empfinden und vor diesem Blutrausch, und dann aber plötzlich heißt es wenige Seiten danach, das Volk mag nicht recht gehabt haben im handgreiflichen Sinne, also in der Brutalität, aber im moralischen Sinne war es eine große Tat, also diese Revolution oder dieser Auslöser, die Erstürmung der Bastille, und das erlebt man bei ihm immer wieder. Er schwärmt einerseits noch von den alten Zeiten von Pomp und Gloria, könnte man sagen, oder einfach von ästhetischer Größe, kann man auch mit dem Architektonischen, mit dem Zeremoniellen und alles weiter sagen, worüber er auch gleichzeitig ein bisschen spottet oder oft sogar sehr spottet. Andererseits tut man ihm vollkommen Unrecht, wenn man ihn in eine reaktionäre Ecke steckt, wie zum Beispiel in die Nähen von Joseph de Maistre rückt, der ja wirklich reaktionär war und den alten Katholizismus und die Zeit vor 1789 zurückwollte. Damit hat Chateaubriand nichts am Hut. Er möchte die Freiheiten, die neugewordenen, bewahren, aber möchte natürlich auch das Schöne der alten Zeit in die neue hinüberretten.
Gutzeit: Nach der 1789er-Revolution, in deren Folge Chateaubriand ja etliche Familienangehörige und auch Freunde verloren hatte, schrieb er das Buch "Genie des Christentums", das 1802 in Paris erschien. Sie sagten gerade, dass er zu Unrecht oftmals in die reaktionäre Ecke geschoben wird. Auch dieses Buch, da wird manches Mal behauptet, dass dieses Buch als antirevolutionäre Schrift zu verstehen ist, als Plädoyer für das Wiedererstarken der Religion und so weiter. Was ist denn da dran?
Ott: Das ist schwierig. Also ich würde sagen, man findet das in dem Buch nicht. Andererseits ist es natürlich ein Plädoyer für den Katholizismus, das kann man ja überhaupt nicht leugnen. Nur, typischerweise fand die Kirche nie Gefallen an diesem Werk. Es wird auch eigentlich dort nie zitiert, und, gut, das war in dem Falle ein Protestant: Adolf von Harnack hat in dem, glaube ich, 1900 erschienen Buch "Wesen des Christentums", Schimpftiraden gegen Chateaubriand, das sei ein rein ästhetisches Christentum und habe mit dem wahren Christentum überhaupt nichts zu tun, heißt es da, und da ist was dran, denn für ihn bedeutet das Christentum, dass natürlich die antike Welt abgeschafft ist, das heißt, dieser Hokuspokus von den Göttern und dass alle Menschen zusammengehören, also eigentlich die universalistische Idee des Christentums ist für ihn prägend. Das andere daran ist wiederum, was man vielleicht romantisch nennen kann, nämlich, dass das Gefühl der Unendlichkeit durch das Christentum in die Welt gebracht wird, nämlich eine Sehnsucht nach dem Jenseitigen, dass das Leben nicht aufhören möge, und das kann man natürlich bei Chateaubriand wieder verbinden mit seinem Stehen am Meer, wo man in … Ja, in was schaut man, in einen Horizont, der Abgrund sein kann und gleichzeitig sowas wie ein Glücksversprechen, und das ist für ihn im Grunde das Christentum.
Gutzeit: Und ist auch wirklich schon sehr romantisch, aber vielleicht noch mal eine Nachfolgefrage: Chateaubriand wird ja allgemein als Vorreiter der literarischen Romantik in Frankreich bezeichnet. Ist das denn eigentlich so eindeutig?
Ott: Ja, in den Schulbüchern steht es überall so. Da ist natürlich was dran, aber ich würde ihn abgrenzen gegen eine Romantik, die zum Beispiel Natur vor allem so beschreibt, dass man weiß, es geht nur um eigene Seelenregungen. Das ist bei Chateaubriand schon sprachlich nicht der Fall. Er wühlt nicht in seinem Innern, auch wenn er das Innere nicht verbirgt, aber er stellt es nicht aus, worin er auch den Unterschied zu Rousseau selbst betont beispielsweise, sondern er schildert die Welt immer eigentlich durch die Augen und nicht durch den Blick in die Seele. Aber natürlich kommt das Seelenleben auf dem Wege zum Ausdruck, aber was die Romantik angeht, denke ich, hängt das vor allem auch mit seiner ganz frühen Erzählung "René" zusammen, die in der Tat etwas von Goethes "Werther" an sich hat, also ein Mensch, der in sich vollkommen, wie soll man sagen, zerwühlt ist und keinen Ausweg findet, dann nach Amerika geht und dort versucht, in indianischen Weiten seine Seele wieder zu retten, was natürlich nicht funktioniert. Ich glaube, mit diesem Buch hat das mehr zu tun als mit seinem Mémoire.
Gutzeit: Karl-Heinz Ott, eine letzte Frage: Sie sprechen in Ihrem schönen Nachwort von der lichtdurchfluteten Schönheit der Sprache Chateaubriands. Welche Spezifika seiner Sprache waren denn für Sie als Übersetzer die größte Herausforderung?
Ott: Dass er ganz häufig identische Worte benutzt, die verschiedene Bedeutungen besitzen, in Sätzen hintereinander, in ein und demselben Satz, und das kriegt man im Deutschen eigentlich so gut wie nicht hin. Das sind so Wortspiele, die er aber nicht ausstellt, wie man im modernen Sinn Wortspiele ausstellt, sondern die sind, wie alles bei ihm, von einer Beiläufigkeit, von einer, ich sage mal, sehr sanften Ironie, die nicht protzt, und das kann man, wie ich finde, ins Deutsche nicht hinüberschieben.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassung wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
François-René Chateaubriand: "Kindheit in der Bretagne"
Neu übersetzt und kommentiert von Karl-Heinz Ott
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2018. 304 Seiten, 20 Euro.
Neu übersetzt und kommentiert von Karl-Heinz Ott
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2018. 304 Seiten, 20 Euro.

