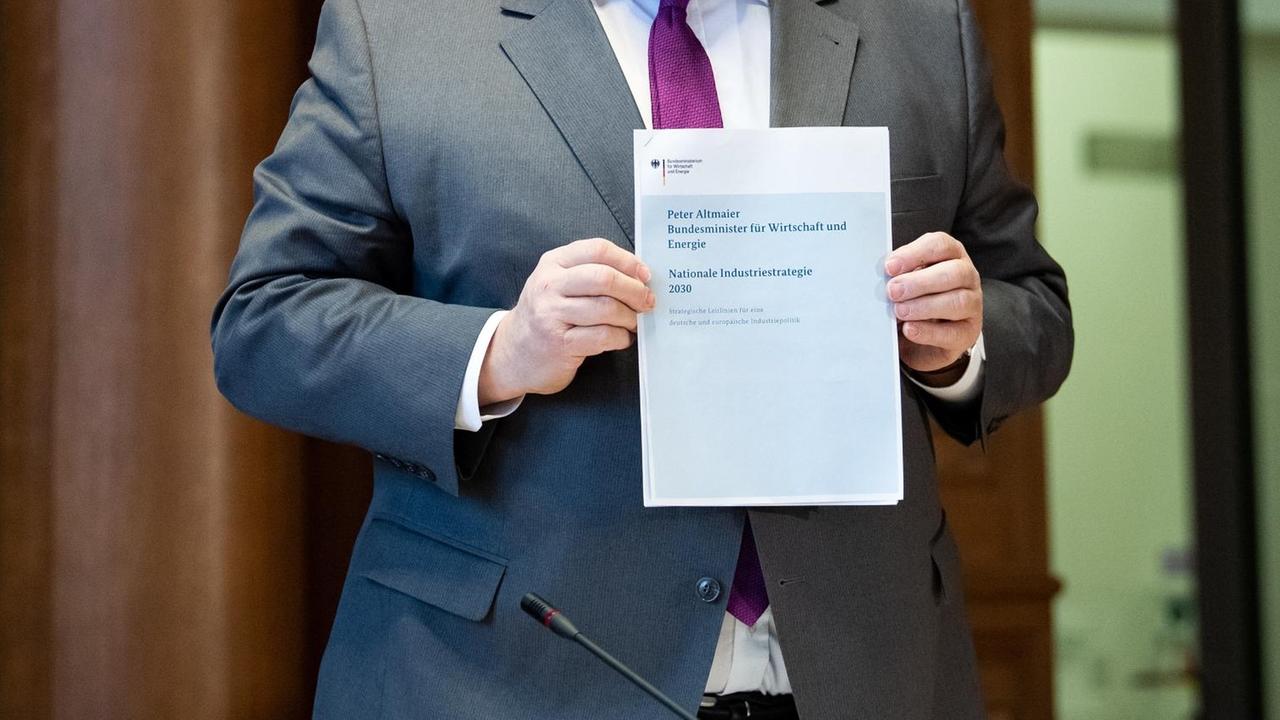In einer Industriehalle stehen mehrere große grüne Maschinen. Alle paar Sekunden wird erhitztes Kunststoffmaterial in eine Form gespritzt. Am Ende entstehen so ganz unterschiedliche Produkte.
"Von Gehäuseteilen für Elektrotechnik, über Gastronomieartikel über Medizintechnik, über Steckverbinder. Der Großteil unserer Kunden sitzt hier in Schleswig-Holstein."
Vor einem halben Jahr hat Elisabeth Gill den Betrieb in Ascheberg bei Plön übernommen. Nun trägt die 31-Jährige die Verantwortung. Nicht nur für die teuren Maschinen, sondern auch für sechs Mitarbeiter.
"Es ist kein Arbeitsplatz, wo man irgendwie so hingeht. Es ist ein zweites Zuhause quasi. Im Vergleich zum Job vorher, wo ich im Angestelltenverhältnis war, geht man anders an die Sache ran. Ist ein schönes Gefühl."
"Es ist kein Arbeitsplatz, wo man irgendwie so hingeht. Es ist ein zweites Zuhause quasi. Im Vergleich zum Job vorher, wo ich im Angestelltenverhältnis war, geht man anders an die Sache ran. Ist ein schönes Gefühl."
Gesucht hat sie den Weg in die Selbstständigkeit nicht. Denn Elisabeth Gill war zufrieden mit ihrem vorherigen Job. Trotzdem wurde sie neugierig, als sie davon hörte, dass in ihrer schleswig-holsteinischen Heimatstadt Ascheberg ein Unternehmensnachfolger gesucht wird. Oder eine Unternehmensnachfolgerin.
Denn Frauen sind in der Kunststofffertigung bisher die Ausnahme, erst recht als Firmenbesitzerin. Anders als die meisten Betriebsinhaber hat Elisabeth Gill keine Lehre oder eine Ausbildung gemacht, sondern ein Studium der Materialwissenschaften absolviert. Mit manchem Nachholbedarf geht sie ganz offen um.
"Jeden Tag lerne ich dazu. Jeden Tag finde ich was Neues. Aber meine Mitarbeiter hier, die sind super. Die wissen, dass ich nicht alles weiß. Und die kommen damit gut klar, dass ich auch einfach nachfrage bei denen und mir das von denen erklären lasse."
Denn Frauen sind in der Kunststofffertigung bisher die Ausnahme, erst recht als Firmenbesitzerin. Anders als die meisten Betriebsinhaber hat Elisabeth Gill keine Lehre oder eine Ausbildung gemacht, sondern ein Studium der Materialwissenschaften absolviert. Mit manchem Nachholbedarf geht sie ganz offen um.
"Jeden Tag lerne ich dazu. Jeden Tag finde ich was Neues. Aber meine Mitarbeiter hier, die sind super. Die wissen, dass ich nicht alles weiß. Und die kommen damit gut klar, dass ich auch einfach nachfrage bei denen und mir das von denen erklären lasse."
Suche nach Nachfolger dauerte zehn Jahre
Zehn Jahre lang hat Peter Daugallis Nachfolgesuche gedauert. Zwar meldeten sich immer wieder Interessenten. Doch manchem sei es offenbar vor allem um eine hohe Rendite und weniger um das Wohl der Beschäftigten gegangen, sagt der 68-Jährige. Peter Daugallis freut sich darüber, dass die Suche nun abgeschlossen ist und er mit Elisabeth Gill eine Nachfolgerin gefunden hat.
"Ich bin sehr zufrieden. Wir harmonieren sehr gut. Und der Übergang ist eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe, bisher gelaufen."
Zwei bis drei Jahre lang will er weiter als angestellter Mitarbeiter im Betrieb bleiben und damit auch seiner Nachfolgerin bei Fragen zur Seite stehen. Ein dreiviertel Jahr lang hatte Elisabeth Gill vor der Übernahme zur Probe mitgearbeitet und so Mitarbeiter, Kunden und die Maschinen kennengelernt.
"Es hat sich gezeigt, dass Frau Gill eben sehr schnell auch von den Mitarbeitern akzeptiert worden ist als Nachfolgerin. Die Mitarbeiter wussten das von vornherein, dass sie den Betrieb übernehmen möchte, waren etwas erstaunt, dass es eine Frau sein würde, das ist schon etwas interessant. Aber sie haben sie recht schnell auch akzeptiert als jemanden, mit dem man ja technisch sich auch auseinandersetzen kann oder mit dem man zusammenarbeiten kann. Und von daher gab es auch keine Probleme in der Einarbeitungsphase."
"Ich bin sehr zufrieden. Wir harmonieren sehr gut. Und der Übergang ist eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe, bisher gelaufen."
Zwei bis drei Jahre lang will er weiter als angestellter Mitarbeiter im Betrieb bleiben und damit auch seiner Nachfolgerin bei Fragen zur Seite stehen. Ein dreiviertel Jahr lang hatte Elisabeth Gill vor der Übernahme zur Probe mitgearbeitet und so Mitarbeiter, Kunden und die Maschinen kennengelernt.
"Es hat sich gezeigt, dass Frau Gill eben sehr schnell auch von den Mitarbeitern akzeptiert worden ist als Nachfolgerin. Die Mitarbeiter wussten das von vornherein, dass sie den Betrieb übernehmen möchte, waren etwas erstaunt, dass es eine Frau sein würde, das ist schon etwas interessant. Aber sie haben sie recht schnell auch akzeptiert als jemanden, mit dem man ja technisch sich auch auseinandersetzen kann oder mit dem man zusammenarbeiten kann. Und von daher gab es auch keine Probleme in der Einarbeitungsphase."
Kleine und mittlere Unternehmen, kurz KMU, seien das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, erklärt das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage. 99,5 Prozent – also fast alle Firmen in Deutschland – seien Mittelständler. Sie erwirtschafteten mehr als jeden zweiten Euro. Laut dem Ministerium sind knapp 17 Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs in Deutschland den KMU zu verdanken. Genauso wie rund 1,2 Millionen Ausbildungsplätze.
Dass Firmen neu gegründet werden, irgendwann weitergegeben werden oder vielleicht auch schließen ist vollkommen normal. Doch die Bedingungen für die Unternehmensnachfolge bei kleinen und mittleren Unternehmen haben sich geändert. Immer noch werden viele Firmen innerhalb der Familie weitergegeben. Doch immer häufiger haben die Töchter und Söhne andere berufliche Pläne und wollen mehr Zeit für sich und die eigene Familie haben.
Dass Firmen neu gegründet werden, irgendwann weitergegeben werden oder vielleicht auch schließen ist vollkommen normal. Doch die Bedingungen für die Unternehmensnachfolge bei kleinen und mittleren Unternehmen haben sich geändert. Immer noch werden viele Firmen innerhalb der Familie weitergegeben. Doch immer häufiger haben die Töchter und Söhne andere berufliche Pläne und wollen mehr Zeit für sich und die eigene Familie haben.
Demografischer Wandel schlägt auch auf die Unternehmensnachfolge durch
Auch beim Thema Unternehmensnachfolge mache sich jetzt immer stärker der demografische Wandel bemerkbar, sagt Michael Schwartz. Er beschäftigt sich in der Forschungsabteilung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit mittelständischen Betrieben und damit auch mit dem Thema Unternehmensnachfolge. Klar sei,
"dass dort eben etwas passiert, was bisher nicht so da war. Und zwar die Babyboomer, die werden so circa ab 2025 in den Ruhestand gehen. Und das betrifft ja nicht nur die Erwerbsbevölkerung in Deutschland insgesamt. Das wird natürlich auch die Inhaberschaft im Mittelstand oder bei den kleineren, mittleren Unternehmen treffen."
Zuletzt legte die KfW im vergangenen Februar Zahlen vor. Demnach sind bundesweit 227.000 mittelständische Betriebe bis Ende 2020 auf Nachfolgersuche. Ein Projekt, das schnell mehrere Jahre dauern kann. Zwar sei das Bewusstsein dafür gestiegen. Doch für rund 36.000 Betriebe werde es schwer, noch rechtzeitig fündig zu werden. Das hänge auch damit zusammen, dass immer weniger Personen für eine Betriebsübernahme infrage kommen.
"Wir sehen das schon seit der Jahrtausendwende, dass die Zahl der Existenzgründer mit ein paar Ausnahmen stetig sinkt von Jahr zu Jahr. Wir hatten 2001 rund 1,5 Millionen Existenzgründer. Und im letzten Jahr waren es gerade mal ein Drittel davon. Und dann kann man sich in etwa vorstellen, dass es deutlich weniger Personen gibt, die überhaupt Interesse daran haben, ein bestehendes Unternehmen zu übernehmen."

Für den Mittelstand sei das Thema Unternehmensnachfolge neben der Digitalisierung und der Fachkräftesicherung derzeit wohl die größte Herausforderung, so das Bundeswirtschaftsministerium.
Ein Grund dafür sei die Konjunktur so KfW-Forscher Schwartz. In einer gut laufenden Wirtschaft mit hoher Beschäftigung scheuten viele Frauen und Männer das unternehmerische Risiko und blieben lieber festangestellt.
Ein Grund dafür sei die Konjunktur so KfW-Forscher Schwartz. In einer gut laufenden Wirtschaft mit hoher Beschäftigung scheuten viele Frauen und Männer das unternehmerische Risiko und blieben lieber festangestellt.
Immer weniger Nachfolgeinteressenten
Er geht davon aus, dass wegen des demografischen Wandels in den nächsten Jahren immer mehr Nachfolgersuchende einer kleiner werdenden Zahl von Nachfolgeinteressenten gegenüberstehen werden.
"Vor zwei Jahren haben wir uns angeschaut, wie das Inhaberalter und die Nachfolgeplanung auf Bundeslandebene aussehen. Und da kann man interessanterweise ziemlich große Unterschiede sehen. So zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Dort sind die Inhaber im Durchschnitt am ältesten. Da ist fast jeder zweite Inhaber über 55 Jahre. Und dementsprechend auch der Anteil von Unternehmen, die einen Nachfolger brauchen, viel, viel höher, als im Bundesdurchschnitt."
Demnach suchen in Schleswig-Holstein binnen der nächsten drei Jahre 21 Prozent aller Firmeninhaberinnen- und -inhaber eine Nachfolge. Soviel wie in keinem anderen Bundesland. In Hamburg seien es dagegen nur vier Prozent. Auch in Sachsen-Anhalt lag der Anteil mit 14 Prozent beziehungsweise zehn Prozent in Rheinland-Pfalz und dem Saarland klar hinter Schleswig-Holstein, so die KfW-Umfrage.
In Schleswig-Holstein zählen über 90 Prozent aller 130.000 Betriebe zu den sogenannten KMU, also zu kleinen und mittleren Unternehmen. In den nächsten fünf Jahren stelle sich bei 5.400 Unternehmen die Nachfolgefrage. Davon seien 83.000 Beschäftigte betroffen, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von der FDP.
"Und wir wollen, dass diese 83.000 Beschäftigungsverhältnisse nicht einfach wegfallen, weil die Unternehmen schließen. Sondern wir wollen möglichst dafür sorgen, dass Unternehmen in neue Hände kommen, die dann gegebenenfalls auch was Neues aus diesen Unternehmungen machen oder jedenfalls das Baby, das ein Unternehmer mal kreiert hat, weiterentwickeln, nach vorne bringen."
"Vor zwei Jahren haben wir uns angeschaut, wie das Inhaberalter und die Nachfolgeplanung auf Bundeslandebene aussehen. Und da kann man interessanterweise ziemlich große Unterschiede sehen. So zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Dort sind die Inhaber im Durchschnitt am ältesten. Da ist fast jeder zweite Inhaber über 55 Jahre. Und dementsprechend auch der Anteil von Unternehmen, die einen Nachfolger brauchen, viel, viel höher, als im Bundesdurchschnitt."
Demnach suchen in Schleswig-Holstein binnen der nächsten drei Jahre 21 Prozent aller Firmeninhaberinnen- und -inhaber eine Nachfolge. Soviel wie in keinem anderen Bundesland. In Hamburg seien es dagegen nur vier Prozent. Auch in Sachsen-Anhalt lag der Anteil mit 14 Prozent beziehungsweise zehn Prozent in Rheinland-Pfalz und dem Saarland klar hinter Schleswig-Holstein, so die KfW-Umfrage.
In Schleswig-Holstein zählen über 90 Prozent aller 130.000 Betriebe zu den sogenannten KMU, also zu kleinen und mittleren Unternehmen. In den nächsten fünf Jahren stelle sich bei 5.400 Unternehmen die Nachfolgefrage. Davon seien 83.000 Beschäftigte betroffen, sagt Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von der FDP.
"Und wir wollen, dass diese 83.000 Beschäftigungsverhältnisse nicht einfach wegfallen, weil die Unternehmen schließen. Sondern wir wollen möglichst dafür sorgen, dass Unternehmen in neue Hände kommen, die dann gegebenenfalls auch was Neues aus diesen Unternehmungen machen oder jedenfalls das Baby, das ein Unternehmer mal kreiert hat, weiterentwickeln, nach vorne bringen."
Programme vermitteln bei der Suche
Deutschlandweit versuchen unterschiedliche Programme auf Bundes- und Landesebene beide Seiten zusammenzubringen. Es gibt ein großes Angebot an Förderprogrammen oder Vermittlungsbörsen wie allen voran das Portal nexxt-change. Mit ihr haben sich mehrere wichtige Akteure auf dem Feld zusammengetan: das Bundeswirtschaftsministerium, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Zentralverband des Deutschen Handwerks, der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken und der Deutsche Sparkassen- und Giroverband.
Rund 16.000 Unternehmensnachfolgen seien durch die Plattform nexxt-change angestoßen worden, so das Bundeswirtschaftsministerium. Derzeit stünden etwa 6.300 Verkaufsangebote knapp 1.700 Kaufgesuche gegenüber. Mit der im Sommer vorgestellten Initiative "Unternehmensnachfolge aus der Praxis für die Praxis" will die Bundesregierung neue Modellprojekte fördern.
Doch gegen das Grundproblem – den demografischen Wandel – können auch diese Unterstützungsangebote nur bedingt helfen. Dass wissen auch Unternehmensberater und die Industrie- und Handelskammern, die auf lokaler Ebene aktiv sind. Heike Hörmann arbeitet bei der IHK zu Kiel im Bereich Nachfolgebetreuung und Beratung.
"Auf uns kommen Mitglieder zu, die sagen, ich bin in einem Alter, wo ich mich mit dem Thema Nachfolge beschäftigen muss und möchte und weiß gar nicht so recht, wie ich vorgehen soll."
Sie versucht, Firmen auf Nachfolgesuche mit Interessenten zusammenzubringen. Immer wieder gelingt ihr das und Heike Hörmann kann bei der Übergabe eines Betriebs helfen. Doch sie hat auch schon andere Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel die Begegnung von zwei Interessierten, wo schon beim ersten Treffen sehr schnell klar war: Es klappt nicht.
"Und da war plötzlich Eiszeit. Und in diesem Raum plötzlich eine Kälte, da habe ich dann nach fünf Minuten als Moderatorin des Gesprächs gesagt, bevor wir weiter einsteigen, ich glaube, ich bin mal diejenige, die sagt, das wird nichts mit Ihnen beiden. Denn eine Unternehmensnachfolge gemeinsam anzugehen ist ein totales Vertrauensthema. Und wenn man sich schon da nicht mag und schätzt und vertraut, dann kommt man auch nicht in die weiteren Schritte mit hinein."
Rund 16.000 Unternehmensnachfolgen seien durch die Plattform nexxt-change angestoßen worden, so das Bundeswirtschaftsministerium. Derzeit stünden etwa 6.300 Verkaufsangebote knapp 1.700 Kaufgesuche gegenüber. Mit der im Sommer vorgestellten Initiative "Unternehmensnachfolge aus der Praxis für die Praxis" will die Bundesregierung neue Modellprojekte fördern.
Doch gegen das Grundproblem – den demografischen Wandel – können auch diese Unterstützungsangebote nur bedingt helfen. Dass wissen auch Unternehmensberater und die Industrie- und Handelskammern, die auf lokaler Ebene aktiv sind. Heike Hörmann arbeitet bei der IHK zu Kiel im Bereich Nachfolgebetreuung und Beratung.
"Auf uns kommen Mitglieder zu, die sagen, ich bin in einem Alter, wo ich mich mit dem Thema Nachfolge beschäftigen muss und möchte und weiß gar nicht so recht, wie ich vorgehen soll."
Sie versucht, Firmen auf Nachfolgesuche mit Interessenten zusammenzubringen. Immer wieder gelingt ihr das und Heike Hörmann kann bei der Übergabe eines Betriebs helfen. Doch sie hat auch schon andere Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel die Begegnung von zwei Interessierten, wo schon beim ersten Treffen sehr schnell klar war: Es klappt nicht.
"Und da war plötzlich Eiszeit. Und in diesem Raum plötzlich eine Kälte, da habe ich dann nach fünf Minuten als Moderatorin des Gesprächs gesagt, bevor wir weiter einsteigen, ich glaube, ich bin mal diejenige, die sagt, das wird nichts mit Ihnen beiden. Denn eine Unternehmensnachfolge gemeinsam anzugehen ist ein totales Vertrauensthema. Und wenn man sich schon da nicht mag und schätzt und vertraut, dann kommt man auch nicht in die weiteren Schritte mit hinein."
Viele Firmeninhaber haben Angst vor Kündigungen
In der Regel laufen die Gespräche unter größter Verschwiegenheit ab. Denn viele Firmeninhaber hätten Angst vor Kündigungen ihrer Beschäftigten, wenn die Nachfolgesuche öffentlich wird. Immer wieder verdrängten aber auch Chefinnen und Chefs das Thema. Manchen falle es schwer, von den Privilegien loszulassen, anderen brächten den Abschied vom Betrieb einfach nicht übers Herz, sagt die IHK-Beraterin.
Zurück in das schleswig-holsteinische Ascheberg. Nur wenige Schritte entfernt von der Kunststofffertigung von Elisabeth Gill hat Peter Kayser seine Kfz-Werkstatt. 30 Jahre ist es her, dass er sich selbstständig gemacht hat. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut. Der 68-Jährige sagt, dass er seine Arbeit liebt.
Zurück in das schleswig-holsteinische Ascheberg. Nur wenige Schritte entfernt von der Kunststofffertigung von Elisabeth Gill hat Peter Kayser seine Kfz-Werkstatt. 30 Jahre ist es her, dass er sich selbstständig gemacht hat. Eine Entscheidung, die er bis heute nicht bereut. Der 68-Jährige sagt, dass er seine Arbeit liebt.
"Ich schraube für mein Leben gerne. Ich brauche auch den Geruch. Ich brauche mein Öl, ich brauche die Abgase. Das hat man einfach drin nachher."
Mehrmals hat Kfz-Meister Kayser seinen Betrieb in den letzten Jahrzehnten erweitert. Heute beschäftigt er sechs Mitarbeiter. Rund zehn Jahre hat er Ausschau nach einem Nachfolger gehalten. Erfolglos. Dabei laufe der Betrieb sehr gut.
"Wir haben Umsätze ohne Ende. Aber es traut sich keiner, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt."
Auf die Hilfe von IHK oder anderen Beratern vor Ort hat Kayser verzichtet und selbst versucht, einen Nachfolger zu finden. Doch der erste Kandidat habe Geld aus der Unternehmenskasse für eigene Zwecke entwendet. Der nächste habe ein Alkoholproblem gehabt. Und der dritte habe Probleme gehabt, den entsprechenden Kredit zu bekommen. So reifte am Ende bei Peter Kayser eine Idee: Er übergibt den Betrieb an seine Beschäftigten.
"Von meinen Mitarbeitern schicke ich einen zur Meisterschule, der macht die Meisterschule, kann als Meister mit den Betrieb übernehmen. Und alle anderen zusammen machen so eine GmbH, übernehmen das komplett und zahlen monatlich einen kleinen Abtrag und dann war es das."
Damit wolle er sich bei seinen Mitarbeitern bedanken. Auf die habe er sich immer verlassen können, hebt Kayser hervor. Ihm gehe es nicht ums Geld.

Immer mehr entscheiden sich gegen eine Lehre
Dass die Suche nach einem Nachfolger aber auch generell nach Fachkräften für seinen Betrieb inzwischen so schwer ist, führt er auch darauf zurück, dass immer mehr Menschen sich gegen eine Lehre und für ein Studium entscheiden.
"Der Beruf ist schmutzig, es ist kalt. Wir sind oft mal draußen auch. Im Winter stehen Sie unter dem Auto, von oben tropft der Schnee. Ist nicht unbedingt das Angenehmste. Und da sind bestimmt viele dabei, die sagen, nein, will ich nicht. Merkt man auch so an den Ausbildungszahlen in den Berufsschulen. Die gehen ja so rapide zurück. Da werden Klassen zusammengelegt, schon weil die gar nicht mehr voll werden. Ist schwierig!"
Till Proeger ist Geschäftsführer des Volkswirtschaftlichen Instituts für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen. Er sagt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Fachkräftemangel und Engpässen bei der Unternehmensnachfolge. Denn bei beiden Themen zeigten sich sowohl Effekte des demografischen Wandels wie auch der wachsenden Akademisierung. Allerdings könne der Bedarf an Fachkräften sinken, wenn die Konjunktur sich eintrübe und die Arbeitslosigkeit steige, so Proeger.
"Der Beruf ist schmutzig, es ist kalt. Wir sind oft mal draußen auch. Im Winter stehen Sie unter dem Auto, von oben tropft der Schnee. Ist nicht unbedingt das Angenehmste. Und da sind bestimmt viele dabei, die sagen, nein, will ich nicht. Merkt man auch so an den Ausbildungszahlen in den Berufsschulen. Die gehen ja so rapide zurück. Da werden Klassen zusammengelegt, schon weil die gar nicht mehr voll werden. Ist schwierig!"
Till Proeger ist Geschäftsführer des Volkswirtschaftlichen Instituts für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen. Er sagt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Fachkräftemangel und Engpässen bei der Unternehmensnachfolge. Denn bei beiden Themen zeigten sich sowohl Effekte des demografischen Wandels wie auch der wachsenden Akademisierung. Allerdings könne der Bedarf an Fachkräften sinken, wenn die Konjunktur sich eintrübe und die Arbeitslosigkeit steige, so Proeger.
"Also, es sind weniger Aufträge da, weniger Aufträge zu bearbeiten, ich brauche weniger Personal, um diese Aufträge zu bearbeiten. Und dadurch wird dieses Problem zunächst weniger drängend. Es wird aber so bleiben, dass aufgrund des zu geringen Fachkräftepotenzials im beruflichen Bereich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, diese Grundproblematik bei uns bleiben wird, unabhängig von der konjunkturellen Situation."
Im Handwerksbereich gebe es inzwischen mehr Betriebsinhaber, die studiert hätten. Doch die meisten hätten immer noch eine duale Ausbildung durchlaufen und einen Meistertitel. Das spiele auch bei der Nachfolgersuche eine Rolle.
"Es ist schwieriger, je kleiner die Betriebe werden. Und je größer die Betriebe werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass akademischer Personal eingestellt werden kann."

Gesamtwirtschaftlicher Schaden nur schwer bezifferbar
Die Frage nach dem gesamtwirtschaftlichen Schaden sei nur schwer zu beantworten. Sicher sei dagegen, dass die Konsequenzen vor allem auf dem Land spürbar werden.
"Insofern als diese kleineren und Kleinstbetriebe im ländlichen Raum verankert sind, dort eine wichtige Rolle spielen. Und in dem Moment, wo diese Betriebe nicht weitergegeben werden, diese Betriebe wegfallen, weil dann vielleicht ein größerer Betrieb die bestehenden Fachkräfte an sich bindet. Dieser größere Betrieb wird dann aber im Zweifelsfall näher an den Zentren liegen und dort Arbeitsplätze bereitstellen. Insofern kann es durchaus sein, dass dieses demografisch bedingte Aufgeben des Betriebsbestands durchaus für die regionale Verteilung von Wohlstand und von Arbeitsplätzen eine Rolle spielen kann."
Und noch ein anderer Effekt könne auftreten, wenn kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Raum verschwinden. Denn traditionell würden viele dieser KMU das Thema Ausbildung sehr ernst nehmen.
"Und das hätte dann natürlich gesamtwirtschaftliche Folgen, die wir nicht haben möchten. Weil insgesamt es schwieriger wird, junge Leute adäquat auszubilden."
Vor negativen Folgen für Gemeinden und Regionen warnt auch Heike Hörmann von der IHK in Kiel. Doch vor allem mahnt sie die Unternehmen zur Geduld. Fünf Jahre könne es schon mal dauern, ehe eine Betriebsnachfolge unter Dach und Fach sei, versucht sie immer wieder auch in ihren Beratungsgesprächen klar zu machen.
"Das ist eine Suche, die eben halt nicht wie ein Hauskauf funktioniert, wo ich einfach hingehen kann und sagen kann, das ist es! Sondern das muss passen, und ich muss das Gefühl haben, dass der auch versteht, was ich mache, und das braucht seine Zeit. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich innerhalb des nächsten Jahres einen Nachfolger habe inklusive Finanzierung, unterschriftenreife Vertragsgestaltung und, und, und. Da hängt ja so vieles mit dran."
"Insofern als diese kleineren und Kleinstbetriebe im ländlichen Raum verankert sind, dort eine wichtige Rolle spielen. Und in dem Moment, wo diese Betriebe nicht weitergegeben werden, diese Betriebe wegfallen, weil dann vielleicht ein größerer Betrieb die bestehenden Fachkräfte an sich bindet. Dieser größere Betrieb wird dann aber im Zweifelsfall näher an den Zentren liegen und dort Arbeitsplätze bereitstellen. Insofern kann es durchaus sein, dass dieses demografisch bedingte Aufgeben des Betriebsbestands durchaus für die regionale Verteilung von Wohlstand und von Arbeitsplätzen eine Rolle spielen kann."
Und noch ein anderer Effekt könne auftreten, wenn kleine und mittlere Unternehmen im ländlichen Raum verschwinden. Denn traditionell würden viele dieser KMU das Thema Ausbildung sehr ernst nehmen.
"Und das hätte dann natürlich gesamtwirtschaftliche Folgen, die wir nicht haben möchten. Weil insgesamt es schwieriger wird, junge Leute adäquat auszubilden."
Vor negativen Folgen für Gemeinden und Regionen warnt auch Heike Hörmann von der IHK in Kiel. Doch vor allem mahnt sie die Unternehmen zur Geduld. Fünf Jahre könne es schon mal dauern, ehe eine Betriebsnachfolge unter Dach und Fach sei, versucht sie immer wieder auch in ihren Beratungsgesprächen klar zu machen.
"Das ist eine Suche, die eben halt nicht wie ein Hauskauf funktioniert, wo ich einfach hingehen kann und sagen kann, das ist es! Sondern das muss passen, und ich muss das Gefühl haben, dass der auch versteht, was ich mache, und das braucht seine Zeit. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich innerhalb des nächsten Jahres einen Nachfolger habe inklusive Finanzierung, unterschriftenreife Vertragsgestaltung und, und, und. Da hängt ja so vieles mit dran."
Nicht jeder ist der geborene Unternehmer
Nicht jeder sei der geborene Unternehmer. Wer wegen hoher Kredite nicht gut schlafen könne, solle besser keinen Betrieb übernehmen, rät Hörmann. Andererseits gebe es neben vielen Beratungs- auch Förderprogramme. Ein hohes Eigenkapital sei also keine automatische Bedingung, um eine Firma übernehmen zu können. Insgesamt seien für die Nachfolgerfrage zuallererst Unternehmer selber verantwortlich, betont KfW-Experte Michael Schwartz. Dabei gerate neben der Frage nach dem Erhalt der Jobs ein Aspekt häufig aus dem Blickfeld:
"Umso älter die Unternehmer werden, desto weniger investieren sie in ihre Unternehmen. Und wenn noch dazu kommt, dass sie einen Nachfolger wünschen, dann investieren sie so gut wie gar nicht mehr. Solange, bis sie den Nachfolger gefunden haben. Das heißt, was da an Kapitalstock nicht investiert oder erneuert wird in der Unternehmenslandschaft, ist enorm. Und das ist eigentlich wahrscheinlich das größere Problem als die Erwerbstätigkeit."
Elisabeth Gill bereut nicht, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben. Schlaflose Nächte hätte sie seit der Entscheidung, sich selbstständig zu machen, noch nicht gehabt. Aber die würden sicherlich noch kommen, sagt Gill. Das weiß sie auch von ihren Eltern, die einen Dachdeckerbetrieb in Ascheberg führen.
"Das soll jetzt hier eigentlich mein Leben sein. Und daher ist es eigentlich ganz schön, das auch zu Hause zu haben und nicht fernab von der Familie und der Heimat."
Peter Daugallis, ihr Vorgänger, der jetzt als Angestellter im Betrieb arbeitet, findet es gut, dass er loslassen kann.
"Und es macht mir auch kein Problem, jetzt auch mit Frau Gill zusammenzuarbeiten und Entscheidungen auch ihr zu überlassen. Ich denke, ich muss nicht alles selbst entscheiden. Und ich finde sogar, dass das ein Vorteil ist, auch alles nicht selbst entscheiden zu müssen. Und es ist entspannt, beraten zu können und nicht entscheiden zu müssen. Also, ich finde das schon ganz angenehm."
"Umso älter die Unternehmer werden, desto weniger investieren sie in ihre Unternehmen. Und wenn noch dazu kommt, dass sie einen Nachfolger wünschen, dann investieren sie so gut wie gar nicht mehr. Solange, bis sie den Nachfolger gefunden haben. Das heißt, was da an Kapitalstock nicht investiert oder erneuert wird in der Unternehmenslandschaft, ist enorm. Und das ist eigentlich wahrscheinlich das größere Problem als die Erwerbstätigkeit."
Elisabeth Gill bereut nicht, den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt zu haben. Schlaflose Nächte hätte sie seit der Entscheidung, sich selbstständig zu machen, noch nicht gehabt. Aber die würden sicherlich noch kommen, sagt Gill. Das weiß sie auch von ihren Eltern, die einen Dachdeckerbetrieb in Ascheberg führen.
"Das soll jetzt hier eigentlich mein Leben sein. Und daher ist es eigentlich ganz schön, das auch zu Hause zu haben und nicht fernab von der Familie und der Heimat."
Peter Daugallis, ihr Vorgänger, der jetzt als Angestellter im Betrieb arbeitet, findet es gut, dass er loslassen kann.
"Und es macht mir auch kein Problem, jetzt auch mit Frau Gill zusammenzuarbeiten und Entscheidungen auch ihr zu überlassen. Ich denke, ich muss nicht alles selbst entscheiden. Und ich finde sogar, dass das ein Vorteil ist, auch alles nicht selbst entscheiden zu müssen. Und es ist entspannt, beraten zu können und nicht entscheiden zu müssen. Also, ich finde das schon ganz angenehm."