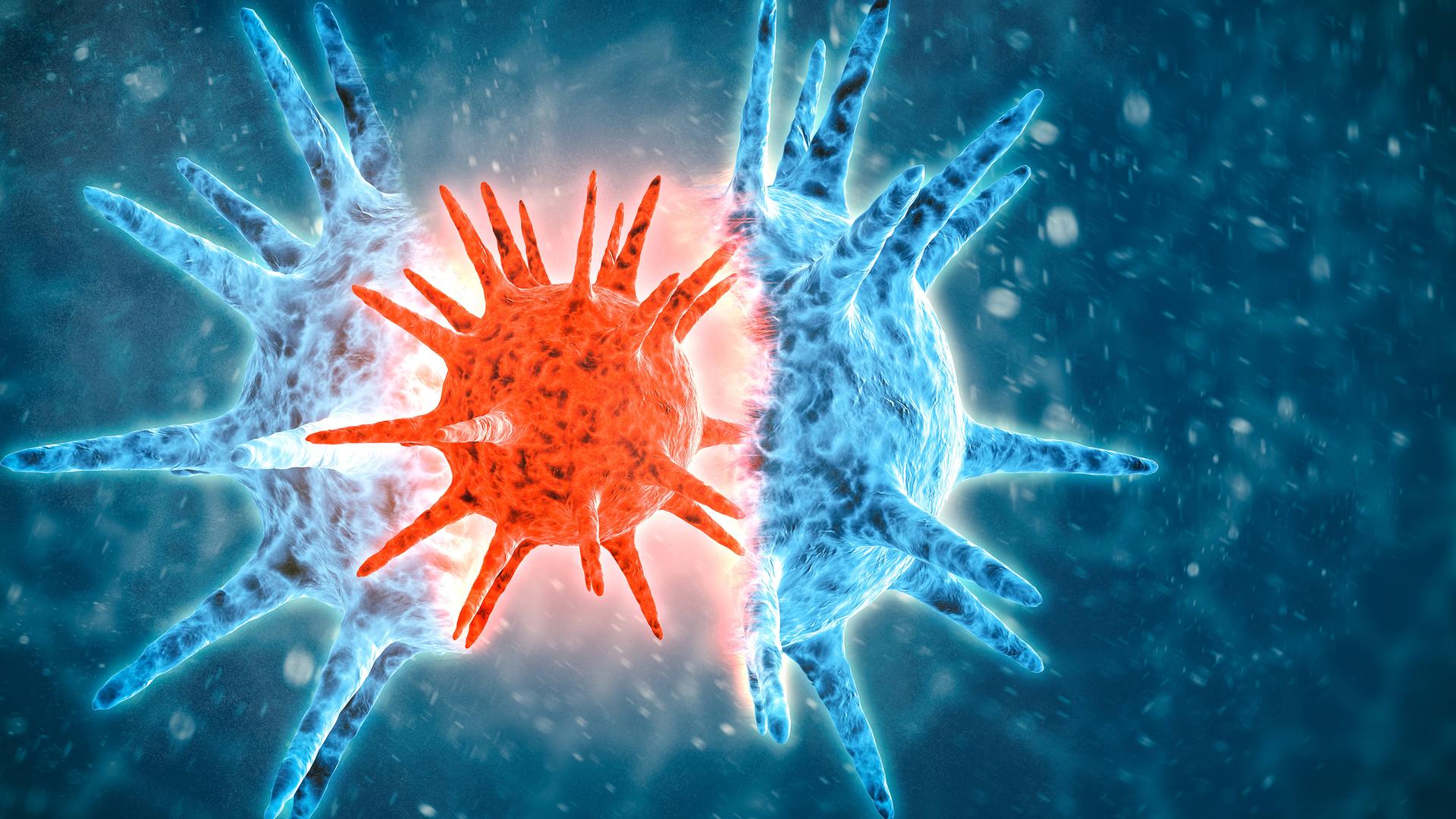Es war zu schön, um wahr zu sein: Die schwedische Gesundheitsbehörde hatte auf ein schnelles Ende der Pandemie gesetzt, weil viele Schweden schon immun gegen das Coronavirus seien. Doch Experten waren bei ihren Studien offenbar grundlegende Fehler passiert. Auch andere wissenschaftliche Studien in der Coronakrise sind in die Kritik geraten.
Am 9. April 2020 stellte Hendrik Streeck, Leiter des Lehrstuhls für Virologie am Universitätsklinikum Bonn, Zwischenergebnisse seiner Untersuchungen im Corona-Hotspot Gangelt im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen vor. Auf Basis von 500 auf Antikörper untersuchten Personen kam er zu dem Schluss, dass bei 15 Prozent von ihnen Antikörper gegen das neue Coronavirus nachweisbar seien. Die Ergebnisse zeigten, dass mit ersten Lockerungen der Kontaktsperren und strengen Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland bei gleichzeitiger Sicherung der Hygiene-Maßnahmen begonnen werden könne, sagte Streeck in Düsseldorf.
Kurz darauf bezweifelten Experten, darunter der Virologe Christian Drosten, die Aussagekraft der vorgestellten Ergebnisse - und damit auch die aus der Studie hergeleiteten Handlungsempfehlungen an die Politik. Sie bemängelten vor allem fehlende Angaben über Methodik und Zusammensetzung der Stichprobe. Die Wissenschaftsgemeinschaft warte auf genauere Informationen.
Die Kritik der öffentlichkeitswirksamen, aber vorschnellen Präsentation von Ergebnissen, die noch keinen wissenschaftlichen Prüfungsprozess durchlaufen haben, trifft nicht nur die sogenannte Heinsberg-Studie: Auch die Erkenntnisse des Aerodynamikers Bert Blocken zur Infektionsgefahr beim Joggen stießen auf Kritik, weil sie nicht in einer von Fachleuten begutachteten Studie veröffentlicht wurden.
Im Fall Heinsberg kommt allerdings noch hinzu, dass es offiziell erklärtes Ziel der Studie war, Lösungsansätze für eine Reduzierung der umfangreichen Kontaktverbote zu liefern. Wissenschaftsjournalisten weisen darauf hin, dass die Studie daher offenbar nicht ergebnisoffen angelegt gewesen sei. Auch der das Forschungsvorhaben begleitende Social-Media-Auftritt, verantwortet von der PR-Agentur "Storymachine", legte der Kritik zufolge nahe, die Erkenntnisse würden automatisch zu einer Lockerung der Corona-Auflagen führen. Auf Lockerungen hatte insbesondere Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schon länger gedrängt. Die nordrhein-westfälische Landesregierung unterstützt das Forschungsvorhaben mit rund 65.000 Euro.

Auftragsforschung stellt innerhalb der Wissenschaftswelt eine Selbstverständlichkeit dar. Es ist Forschung nicht aus eigenem Antrieb, sondern im Auftrag von Dritten - von Wirtschaftsunternehmen und öffentlichen beziehungsweise staatlichen Einrichtungen. Die Fraunhofer-Gesellschaft etwa versteht sich als weltweit führende Organisation für anwendungsorientierte Forschung und erbringt im Kern ihrer Leistungen Auftragsforschung für Wirtschaft und Staat, fokussiert auf Schlüsseltechnologien und innovative Entwicklungen.
Auftragsforschung, wie sie zur Klärung von epidemiologischen Fragestellungen zur Verbreitung von Sars-CoV2 in Gangelt im Kreis Heinsberg erfolgte, ist auch im universitären Bereich völlig üblich und Bestandteil dortiger wissenschaftlicher Tätigkeit und Leistungen. Dazu gehört, dass hierzu Verträge abgeschlossen werden, die Ziele und Umfang der vereinbarten Leistung sowie die entsprechenden finanziellen oder infrastrukturellen Gegenleistungen vereinbaren. Hier besteht im Rahmen bestehender Gesetze und Vorschriften Vereinbarungsfreiheit. Immer wieder allerdings gibt es Probleme, wenn Auftraggeber sich ein Genehmigungsrecht oder gar ein Geheimhaltungsrecht ausbedingen wollen. Dieses kann dann im Widerspruch zur Wissenschaftsfreiheit stehen.
Wenn Auftraggeber dann ihrerseits die eingeholten Ergebnisse präsentieren, ersetzt das nicht die übliche "Währung" der Wissenschaft: eine wissenschaftliche Publikation, die im Regelfall "peer reviewed" sein muss - also extern und unabhängig begutachtet. Üblich sind hierbei mindestens zwei Gutachten. Das ist die ausschließliche Basis, auf der eine wissenschaftliche Diskussion innerhalb der "scientific community" stattfindet. Diese ist unter bestimmten Bedingungen auch im Rahmen eines wissenschaftlichen Kongresses möglich, auf dem gerade erzielte Ergebnisse vorgestellt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ganz aktuelle Beobachtungen als Diskussionsbeitrag zu einem Artikel in einem wissenschaftlichen "Journal" mitzuteilen.
Die Wissenschaft soll raus aus ihrem Elfenbeinturm - vor Corona war das eine zentrale Forderung. Wissenschaftsministerin Anja Karliczek verlangte mehr Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, als sie im vergangenen November ihr "Grundsatzpapier Wissenschaftskommunikation" vorstellte. Das Bundesbildungsministerium will demnach die Wissenschaftskommunikation als integralen Bestandteil seiner Förderung ausbauen. Mit anderen Worten: Staatliche Drittmittel gibt es bald nur noch, wenn schon aus dem Antrag klar wird, wie die Forschungsergebnisse auch den Weg in eine breite Öffentlichkeit finden sollen.
In ganz Deutschland haben Hochschulen ihre Medienarbeit in den vergangenen Jahren bereits verbessert. Schon die Exzellenzinitiative zur Förderung der Spitzenforschung hat der Wissenschaftskommunikation in Deutschland einen ordentlichen Schub verpasst. Dank dieser Gelder konnten Exzellenzcluster Journalistinnen einstellen und eigene Kommunikationsabteilungen gründen. Hochschulkommunikation ist längst Pressearbeit und Marketing. Es geht nicht nur um Dialog mit einer Gesellschaft, die sich für wissenschaftliche Erkenntnisse interessiert – es geht auch und vor allem um Positionierung in einem Wettbewerb. Um Studierende und Wissenschaftler, um Drittmittel und um Aufmerksamkeit.
Und immer häufiger passiert auch das: Presseabteilungen führen Interviews mit ihren Wissenschaftlern selber. Dort wird nicht kritisch nachgefragt, wird nicht infrage gestellt, ob die Erkenntnisse der Forschung nutzbringend sind, ethisch vertretbar oder ähnliches. Zwar sind die Pressereferenten oft journalistisch ausgebildet. Journalisten sind sie aber in diesem Moment nicht. Ein bisschen wäre das, als wenn die Bundesregierung ein Interview mit Angela Merkel veröffentlichen würde, das Steffen Seibert geführt hat. Eine undenkbare Vorstellung – in der Wissenschaftskommunikation keine Seltenheit mehr.
Wenn die Wissenschaft raus soll aus dem Elfenbeinturm, stellt sich – nicht nur in der aktuellen Debatte um den Virologen Streeck – die Frage: Wo verläuft die Grenze zwischen Dialog mit der Gesellschaft auf der einen und PR auf der anderen Seite? Holger Wormer, Professor für Wissenschaftsjournalismus an der TU Dortmund, findet es nicht verwerflich, wenn Forscherinnen und Forscher sich bei der Publikation ihrer Ergebnisse von PR-Agenturen unterstützten lassen. "Das Wichtige dabei ist aber, dass der Kern der Wissenschaft oder der wissenschaftlichen Aussagen und Arbeiten nicht verloren geht."
Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Professionalisierung der Wissenschaftskommunikation ist noch sehr ungleich verteilt. Es gibt Hochschulen wie etwa die FU Berlin, die einen sogenannten Expertenservice betreibt. Zu aktuellen Themen werden dort Fachleute aus der Professorenschaft gelistet, die bei Bedarf für Medien zur Verfügung stehen – Anfragen werden zentral koordiniert. Es gibt aber auch Hochschulen, wo man an manchen Instituten teils tagelang niemanden erreicht.
Und: Nicht jede Wissenschaftlerin, jeder Wissenschaftler fühlt sich im Umgang mit Medien gleichermaßen wohl. Das zeigt nicht zuletzt die Debatte um die Medienschelte des Virologen Christian Drosten. Viele empfinden es als Problem, ihre komplexen Forschungsergebnisse in Interviews oder Pressemitteilungen so runter zu brechen, dass Journalisten sie auch verstehen. Anderen fehlt es an Übung im Umgang mit Medien – in ihrer wissenschaftlichen Ausbildung spielt das in der Regel keine oder nur eine kleine Rolle.
Wissenschaftliche Erkenntnisse stellen für Journalistinnen und Journalisten immer eine Herausforderung dar: Sie müssen aus komplexen Studien voller Fachbegriffe verständliche Meldungen zu machen, ohne dabei die wissenschaftliche Kernaussage zu sehr zu verkürzen oder gar zu ändern. Während das für Wissenschaftsredaktionen erprobter Alltag ist, kommen Wissenschaftsthemen in der Coronakrise auch in anderen Medien gehäuft vor. Wie gut ihnen die Berichterstattung zum Thema gelingt, wird derzeit diskutiert.
Deutliche Kritik äußerte zuletzt der Berliner Virologe Christian Drosten. In seinem NDR-Podcast warf er den Medien pauschal vor, in der Coronakrise ein falsches Bild von Wissenschaft zu vermitteln: "Ein Wissenschaftler ist kein Politiker, die Wissenschaft hat kein politisches Mandat." Formate wie Talkshows würden zudem versuchen, eine Rivalität unter Forschenden zu provozieren. Für Wissenschaftler sei es außerdem "karriereschädigend, sich zu sehr in die Öffentlichkeit zu begeben", wo es darum gehe, "Dinge zu simplifizieren".
Der Verband der Wissenschaftsjournalisten WPK wies diese Kritik zurück. Der Virologe schieße damit "weit über das Ziel hinaus", sagte der WPK-Vorsitzende Franco Zotta im Dlf. Einige Medien sollten sich Drostens Kritik tatsächlich zu Herzen nehmen und darüber nachdenken, welche Verantwortung sie tragen. Doch das müsse man am konkreten Beispiel tun, forderte Zotta.
Die Medienjournalistin Antje Allroggen befürwortete in einem Dlf-Kommentar hingegen mehr kritische Selbstreflektion der Medien. Corona sei eine gute Gelegenheit, das eigene Verhalten zu hinterfragen: "Wenn wir auch systemrelevant sein mögen, sollten wir unsere gesellschaftliche Rolle in Zeiten wie diesen sehr selbstkritisch reflektieren", sagte die Journalistin.
Der Journalismusforscher Holger Wormer warnte vor Verlautbarungsjournalismus. "Es ist ein generelles Problem bei der Berichterstattung über Studien, dass das Ergebnis einer Studie am Schluss als Wahrheit dargestellt wird", sagte der Professor für Wissenschaftsjournalismus im Dlf. Journalistinnen und Journalisten müssten in Zeiten von Corona mehr leisten als sonst. Manche Studien, die in der Eile der Coronakrise an die Öffentlichkeit gelangten, hätten noch keinen wissenschaftlichen Prüfungsprozess durchlaufen: "Da im Moment alles so schnell gehen muss, ist diese wissenschaftliche Qualitätsprüfung zum Teil ausgehebelt. Und ein Teil dieses Überprüfungsauftrags liegt jetzt tatsächlich bei den Journalistinnen und Journalisten", sagte Wormer. Sie müssten die gleichen Fragen stellen, die sonst eine Wissenschaftlerin oder ein Gutachter zu einer Studie stellen würde, zum Beispiel, ob gezogene Stichproben repräsentativ seien und ob es widersprüchliche Ergebnisse gebe. Ihre Aufgabe sei es außerdem, weitere Fachleute zu Wort kommen zu lassen: "Alles andere wäre ein journalistischer Kunstfehler."
Journalistinnen und Journalisten hätten allerdings das Problem, dass täglich neue wissenschaftliche Publikationen zum Coronavirus erschienen, sagte Wissenschaftsjournalist Volker Stollorz vom Science Media Center schon im Februar im Dlf. In dieser Informationsflut sei es schwierig, "die Perlen von den schlecht gemachten Studien zu trennen". Und selbst wenn Informationen als falsch entlarvt würden, könnten sie sich in den sozialen Medien dennoch weiterverbreiten.
(Redaktion: Annika Schneider, Benedikt Schulz, Christian Floto, Daniela Kurz, Nina Voigt)