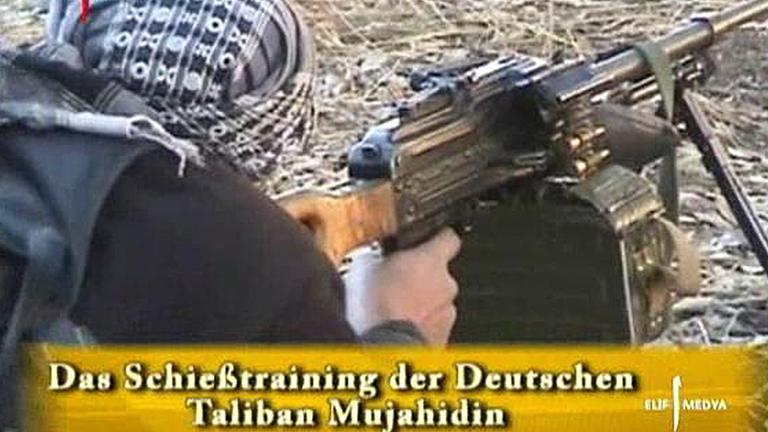
Reinhard Bieck: Markus Kaim leitet die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Kaim, drei Anschläge innerhalb weniger Stunden. Aber spricht nicht doch eher vieles dafür, dass es sich, was Datum und Zeitpunkt angeht, eher um einen Zufall handelt?
Markus Kaim: Ehrlich gesagt, ich glaube, die Ermittler und die breitere Öffentlichkeit wissen es im Moment schlicht und einfach nicht. Dafür spricht, dass es einfach statistisch hochgradig unwahrscheinlich ist, dass drei Anschläge dieser Art, dieser Größenordnung genau an einem Tag oder innerhalb von wenigen Stunden stattfinden. Dagegen spricht auch die unterschiedliche Ausrichtung dieser Anschläge. Wir haben in Tunesien einen Anschlag, der sich gegen die touristische Infrastruktur und damit gegen die ökonomische Basis der Regierung richtet und damit letztlich gegen den gesamten Transformationsprozess des Landes im Kontext des Arabischen Frühlings. Wir haben einen Anschlag in Frankreich, der eher die Handschrift trägt einer Einzelperson, der sich über Wege, die noch herauszufinden sind, selber radikalisiert hat, der vergleichsweise auch schlecht vorbereitet war. Und wir haben einen Anschlag in Kuwait, in dem sich die Spannungen zwischen Schiiten und Sunniten, also die wichtigste Bruchlinie innerhalb der islamischen Welt, manifestiert. Also drei Anschläge, die doch sehr unterschiedlich gelagert sind. Jetzt muss man einfach die Ergebnisse der Ermittlungen abwarten.
Bieck: Sie haben gerade Kuwait erwähnt. In diesem Fall muss man ja fast schon von so etwas wie trauriger Routine sprechen. So was erleben wir ja leider häufiger. Am schwierigsten ist es wohl, die Hintergründe der Tat in Frankreich zu erahnen. Aber mal ganz generell: Warum gibt es so viel Terror in Frankreich? Ist das Land in der islamistischen Szene besonders verhasst? Oder sind möglicherweise die Sicherheitsmaßnahmen und die Sicherheitskräfte zu lasch?
Kaim: Die Gründe dafür sind sicher vielfältig. Sie haben auch sicher mit einer Einwanderungspolitik zu tun in Frankreich seit den 50er-, 60er-Jahren, die bestimmte Integrationsleistungen, die im Vergleich dazu in der Bundesrepublik gelungen erbracht worden sind, nicht erbracht hat. Auch in der Bundesrepublik sind viele Muslime in den 50er- und 60er- und 70er-Jahren eingewandert, die aber letztlich doch ökonomisch wie politisch weitgehend integriert sind. Wir haben weniger damit zu tun mit diesem sogenannten heimischen Terrorismus, als das in Frankreich der Fall ist, und dementsprechend stellen wir fest, dass sich ein Grundmuster wiederholt von in der Regel jungen Männern, die vergleichsweise lange unterhalb des Radars der Sicherheitsbehörden bleiben, oder, wie es heute aufgeschienen ist, auf diesem Kurs aufgetaucht sind und dann wieder verschwunden sind, die sich dann häufig selber sehr zügig radikalisieren, über das Internet oder über einzelne Moscheen, und dann, ausgelöst durch bestimmte Ereignisse, zur Tat schreiten. Das war bei Charlie Hebdo im Januar der Fall und das scheint jetzt wieder der Fall zu sein, und für diese Art von Anschlägen scheint Frankreich einen besonders guten Nährboden zu bereiten. Und vor allen Dingen ein Problem tritt hinzu: Je geringer der Organisationsgrat, je geringer die Vernetzung, desto schwieriger ist es dann für Sicherheitsbehörden, auf diese Täter aufmerksam zu werden.
Bieck: Kann ich das mal so zuspitzen: Sagen Sie, die gewaltbereiten Islamisten hier in Deutschland, die gehen nach Syrien, die in Frankreich schlagen im eigenen Lande zu?
Kaim: Das wäre etwas verkürzt. Aber bislang - die Betonung ist auf bislang - ist die Analyse eigentlich ganz zutreffend. Die Urangst der deutschen Bevölkerung oder auch der deutschen Sicherheitskräfte, dass wirklich das wahr würde, was viele befürchten, nämlich dass einer der Rückkehrer, die im Irak und in Syrien Kampferfahrungen erworben haben, ihre Fertigkeiten hier in Deutschland zu einem groß angelegten Anschlag nutzen, das ist ja glücklicherweise bislang nicht der Fall gewesen. Deutsche werden, wenn ich das so in Anführungsstrichen sagen darf, "verheizt" für Selbstmordanschläge im Irak und in Syrien. Das mag sich in den nächsten Monaten und Jahren ändern, aber das ist der Stand von heute - und das unterscheidet den Befund signifikant von dem in Frankreich.
"Ziel ist Instabilität"
Bieck: Sie haben den Befund, was Tunesien anbetrifft, ja gerade schon genannt. Das Land lebt vom Tourismus, es geht also offenbar darum, dem Land die wirtschaftliche Basis zu entziehen. Nur fragt man sich, mit welcher Absicht eigentlich. Zerstören kann man alles. Aufbauen wäre doch das Stichwort.
Kaim: Wir sehen ja, wenn wir mal den Blick über die arabische Welt schweifen lassen, dass der IS oder ihm zugeordnete, sich ihm verbundene Gruppierungen insbesondere dort Fuß fassen können und aktiv sein können, wo Staatlichkeit schwach ist oder im Rückzug begriffen oder ganz zerfallen ist. Das sehen wir in Libyen, das sehen wir jetzt jüngst noch mal ganz deutlich im Jemen, wo der Bürgerkrieg, den wir jetzt sehen seit einigen Monaten, den Nährboden für einen Vormarsch von Al-Kaida auf der arabischen Halbinsel bereitet hat. Von daher kann man die Gleichung umdrehen. Ziel von islamistischen Gruppierungen muss, um sich auszubreiten, um in Gesellschaften, in Staaten Fuß zu fassen, die Instabilität sein, die Instabilität im ökonomischen Sinne als Voraussetzung für die Instabilität im politischen Sinne. Und das erklärt auch, weshalb gerade Sicherheitskräfte häufig im Visier von islamistischen Anschlägen stehen, jetzt aber auch - Sie haben es ja gerade zurecht angesprochen - Touristen, weil damit die ökonomische Basis dieses Neubeginns in Tunesien der Boden entzogen wird.
Bieck: Tunesien, Frankreich, Kuwait - eines ist diesen drei Anschlägen gemeinsam: Sie haben alle einen islamistischen Hintergrund. Keiner will den 1,6 Milliarden friedliebenden Moslems irgendwas. Aber ist der Terror nicht doch ein Problem des Islam?
Kaim: So weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass viele islamische Würdenträger es sich ein bisschen zu einfach machen, den Islam vom Islamismus abzuscheiden und darauf zu verweisen, dass das dem Islam ja fremd sei, was wir in den letzten zehn Jahren erlebt haben - ich hebe jetzt insbesondere auf die Zeit seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ab -, dass das dem Islam fremd sei. Ich glaube, diese Zweiteilung oder Dichotomie ist so nicht durchzuhalten. Und ich glaube, das was dem Islam bevorsteht, ist doch in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, ein gewisser Prozess der Selbstfindung in der Konfrontation mit der Moderne. Aber ich glaube, wir dürfen uns für eines nicht den Blick verstellen lassen: Quantitativ die meisten Opfer des islamistischen Terrors finden wir in der islamischen Welt. Wenn wir die nackten Opferzahlen dahinterlegen, dann ist es vor allen Dingen ein Kampf innerhalb der islamischen Welt, der tobt.
Bieck: Drei Anschläge mit islamistischem Hintergrund an diesem Freitagvormittag - ich sprach darüber mit dem Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Danke nach Berlin, Markus Kaim.
Kaim: Gerne!
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.


