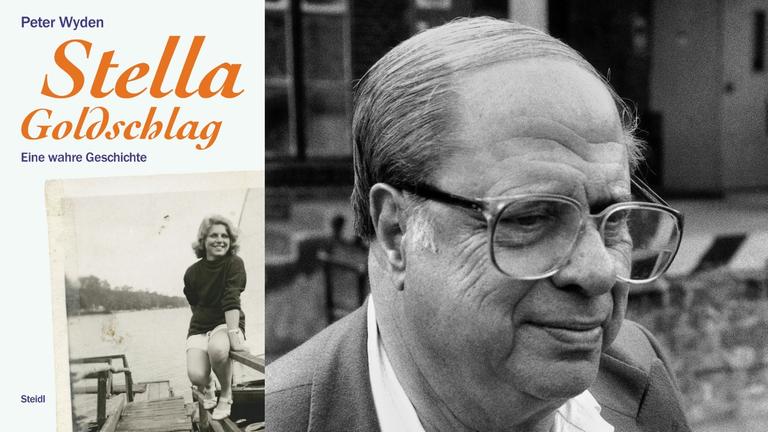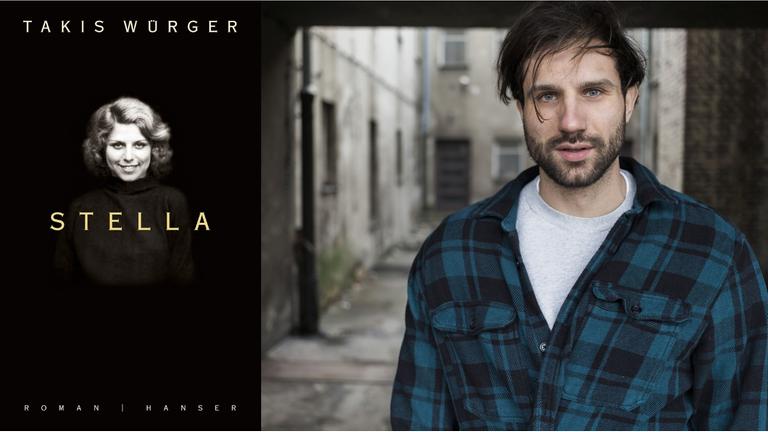Ein Mann kehrt zurück in seine alte Wohnung. Wie es scheint in ein Haus, das von einem nicht näher genannten Krieg an einem nicht näher genannten Ort unversehrt gelassen wurde. Ein Teleskop und ein astronomisches Standardwerk befinden sich dort, ein paar alte Möbel. In der Abwesenheit des Eigentümers hat sich ein hilfsbereiter Nachbar um den Leerstand gekümmert. Und er kümmert sich jetzt auch um den Rückkehrer. Das heißt, er versorgt ihn trotz herrschender Lebensmittelknappheit mit Kartoffeln und Brot. Seine Frau leert den Eimer mit Exkrementen. Eine distanzierte Erzählerstimme spricht zu uns:
"Dein Haus steht noch. Du hattest die Hoffnung, dass es eingestürzt wäre. Vielleicht ist Hoffnung nicht das angemessene Wort, doch wenn nicht, welches dann? Du hattest, so viel kannst du sagen, die Gewissheit, dass es dein Haus nicht mehr gab, und gleichzeitig die Gewissheit, dass dies überhaupt keine Rolle spielte."
Der Nachbar, nicht der Heimkehrer, ist die Hauptfigur über die ersten Kapitel dieses Kammerspiels, in dem Erzähler wie Leser identifikatorisch mit Du angesprochen werden. Der Nachbar im alten Haus ist ein guter Nachbar. Einer, der die Dinge in die Hand nimmt. Einer der aus Menschlichkeit handelt. Ein Nachbar, der Vorkehrungen getroffen hat, um den apathischen Rückkehrer am Leben zu erhalten. Aber:
"Der Nachbar ist ein viel beschäftigter Mann. Immer länger dauert es, bis er wiederkommt, und wenn es geschieht, tut er es mit jener Miene der Ungeduld oder des Überdrusses, die zu einem Mann mit vielen Verpflichtungen passt."
Ein Überlebender kehrt Heim
Ein Jahr ist inzwischen vergangen, der – wie alle – namenslose Erzähler verbringt seine Zeit in einem Raum namens Büro. Dort lebt er wie ein Tier im Winterschlaf, wie ein Untoter, der die Nahrungsaufnahme weitgehend verweigert, kein Lebender, sondern ein "Überlebender".
Das erste Stichwort wäre damit gefallen. Offensichtlich handelt es sich um einen traumatisierten Menschen, der nach großem Leid die Überreste seiner bürgerlichen Existenz besichtigt und naturgemäß nichts mehr damit anzufangen weiß. Nach und nach bekommen Raum und Zeit dann im Roman Kontur. Wir befinden uns im Ungarn der Nachkriegszeit. Kommunisten haben das Ruder übernommen. Antikommunistische Agitation brodelt im Untergrund. Auch der Nachbar scheint darin involviert. Und er hat handfeste Interessen:
"Er könnte nicht leugnen, dass ihm während der schlimmsten Zeit des Krieges der Gedanke durch den Kopf gegangen sei, ein Zimmer oder vielleicht zwei zu vermieten, und sei es nur, um diese Möbel zu nutzen, die er mit so viel Mühe zusammengesucht habe. Zumindest bis zu deiner Rückkehr, denn er habe stets gewusst, dass du am Ende zurückkehren werdest. Er habe nämlich einen Neffen, welch ein Zufall, der gerade jetzt eines dieser Zimmer gut gebrauchen könne."
Die Koffer bleiben in "Kanada"
Der Neffe wird also einquartiert. Später irgendwelche Männer, die Waffen verstecken. Der Erzähler verlässt sein "Büro" nicht und wird wie ein Gefangener nur über die Geräusche aus der Nachbarswohnung am Leben gehalten. Und während in der Wohnung ein antikommunistischer Aufstand vorbereitet zu wird, vermischen sich Alltagseindrücke nun immer stärker mit Erinnerungen an die unmittelbare Vergangenheit. Nach und nach enthüllt sich, dass der Rückkehrer ein nach Auschwitz deportierter Naturwissenschaftler war. Dort konnte er sich mit vom Mund abgesparten Essensrationen eine Versetzung in das weniger barbarische Effektenlager "Kanada" erkaufen. In "Kanada" wurden die Habseligkeiten der Neuankömmlinge inventarisiert und umverteilt. Die Koffer der zukünftigen Leichen.
"Um die Fuhren zu organisieren, benötigt ihr viele Hände und viele Baracken, einen ganzen Tag oder mehrere Tage, denn die Besucher führen alle möglichen Dinge mit sich, und ein jedes verlangt seinen eigenen Raum: Zigarettenpackungen, Konserven, Marmeladengläser, silberne Feuerzeuge, Schmuck, Pelzmäntel, Silberbestecke, Geigen. Ganz zu schweigen von den Dingen, die sie in ihren Koffern untergebracht haben und die trotzdem in Kanada gelandet sind: Brillen, Haarballen, Goldzähne, orthopädische Beinprothesen, Glasaugen. Die Artikel werden Haufen zugeordnet, die über die ganze Länge einer jeden Baracke verteilt sind, immer mehrere Meter voneinander getrennt. Doch das ist eine unnötige Vorsichtsmaßnahme. Mit jedem Zug, der kommt und wieder abfährt, wachsen die Haufen ins Unermessliche, erobern immer mehr Platz, bis ein Berg schließlich die Flanke eines anderen einnimmt, und so kann es geschehen, dass zum Beispiel der Unterwäscheberg sich über den Schuhberg oder den Mantelberg ergießt, oder sogar über den kleineren Brillenhügel."
Kommando "Kanada" hat seinen Preis
Bald wird deutlich, dass "Kanada" zwar einem Naturwissenschaftler, dem man zutraute "gut mit Zahlen" zu sein, das Leben retten konnte. Dass Schuldgefühle und Scham aber dieses gerettete Leben ein zweites Mal für unwert erklären. Neben stoischen Schilderungen des Lageralltags verhandelt der Mitte der achtziger Jahre geborene Juan Gómez Bárcena jene Gewalt des Lagers, die immateriell ist. Viele Holocaust-Überlebende haben in Zeitzeugenaussagen von Schuldgefühlen gegenüber den Toten gesprochen. Zu überleben war eine Hypothek. Das Kommando "Kanada" bedeutete auch, dass ein anderer beim Kohleschippern tot zusammenbrechen musste. Das Lager, so verstehen wir Leser dieses erschütternden kleinen Buchs, hatte seine eigene Dialektik. So wie auch unsere alternativlose Erinnerungskultur. Der Roman scheut sich nicht, auch ihre Widersprüche zu nennen:
"Alles steht noch, Öfen, Schienen und Zäune – wie ein lebendes Museum, als wäre die Zeit ein Traum, und du würdest im nächsten Moment daraus erwachen. Auch die Pyramiden von Kanada sind noch da: tonnenweise Schuhe, Brillen, Haarsträhnen – Touristen einer anderen Zeit werden sie betrachten, sie tun es bereits, fasziniert von der Größe der Henker und der Bedeutungslosigkeit ihrer Opfer."
Juan Gómez Bárcenas zweiter Roman "Kanada" ist eine eindringliche Meditation über die Natur des Lagers und die Funktion des Erinnerns. In einer so kargen wie präzisen Sprache, vergegenwärtigt er die Hölle des zwanzigsten Jahrhunderts – und macht deutlich, weswegen sie nicht in den Erinnerungskatakomben der Gegenwart verschlossen werden darf. Und nie ist es, als spräche da einer bloß aus der informierten der Distanz der Nachgeborenen. Die ganze menschenverachtende Logik des Lagers, die noch aus Opfern Tätern macht, wird in einem atemberaubenden Gedankenstrom offenbart. Nebenbei ereignet sich Weltgeschichte, die am Erzähler wie ein Hintergrundrauschen vorbeizieht. Der Aufstand von 57. Und seine blutige Niederschlagung. Ganz am Schluss erst taucht jener hilfsbereite Nachbar in einer Erinnerungsvolte noch einmal auf. An einem anderen, früheren Punkt der Geschichte. Als Mann auf der Straße, der seinen Denunziantenfinger auf die Wohnung des Deportierten richtet. Bárcena hat einen Roman über die Spiegelungen der Geschichte geschrieben. Darüber, dass die Vergangenheit kein Vogelschiss ist, auch wenn es heute wieder möglich ist, dies zu einer legitimen öffentlichen Meinung zu stilisieren.
Juan Gómez Bárcena: "Kanada"
Aus dem Spanischen von Steven Uhly
Secession Verlag, Zürich, 192 Seiten, 22 Euro
Aus dem Spanischen von Steven Uhly
Secession Verlag, Zürich, 192 Seiten, 22 Euro