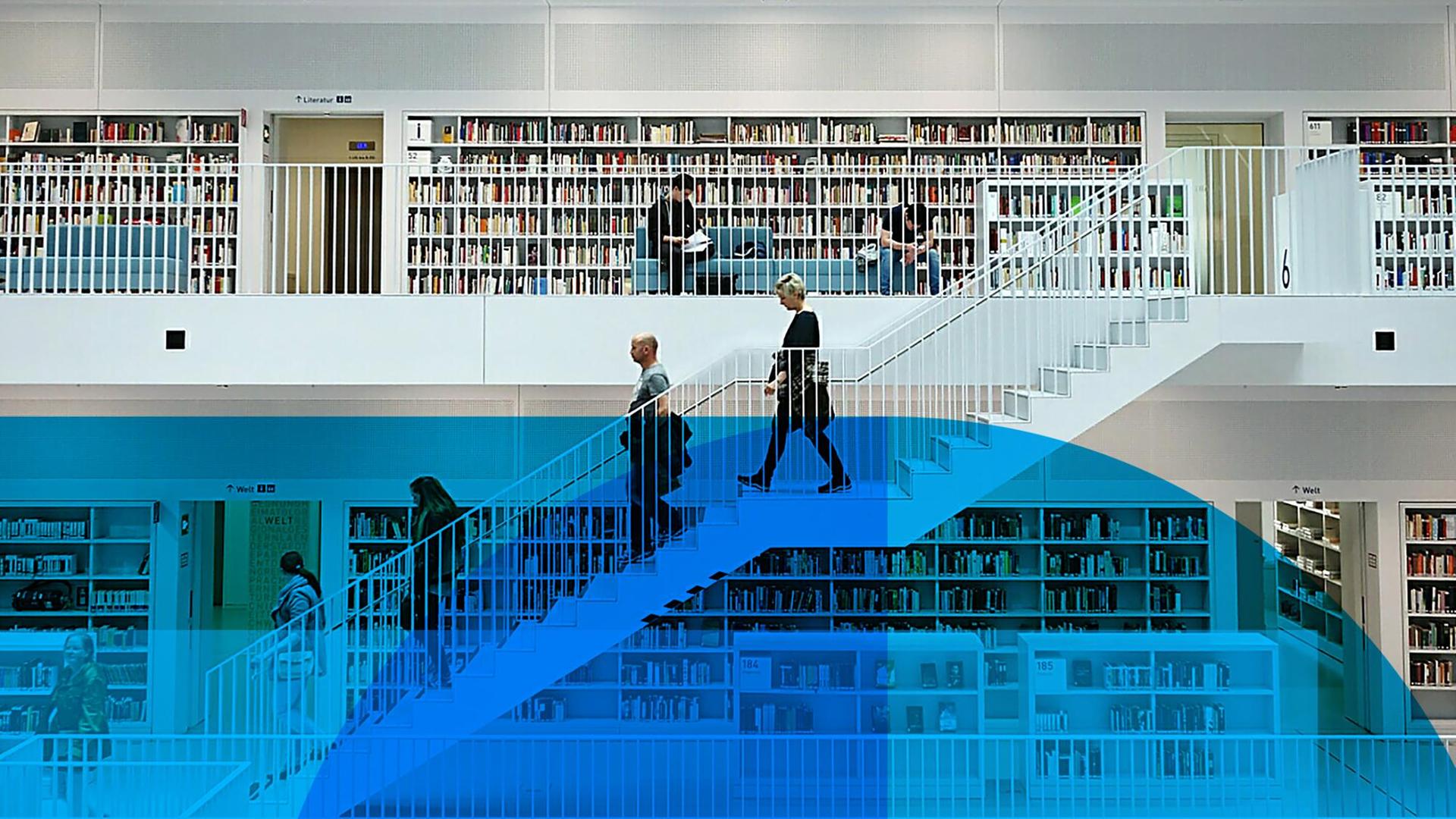Juri Rosov ist stolz auf seine große jüdische Gemeinde in Rostock.
"Heute haben wir 620 Mitglieder, das ist eigentlich fast zweimal mehr, als die Vorkriegsgemeinde hat gehabt. Und 97 Prozent unserer Mitglieder sind Einwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion."
So wie Juri Rosov, der Mitte der 90er-Jahre aus der Ukraine kam, und heute Vorsitzender der jüdischen Gemeinde in Rostock ist.
"Wir sind auch stolz: In der Synagoge haben wir vier Gottesdienste pro Woche."
Zum Schabat-Gottesdienst am Freitagabend kommen rund 40 Gemeindemitglieder. Vor dem Gemeindezentrum überquert Juri Rosov die Rostocker Augustenstraße: ein Weg in die Vergangenheit.
"Wir befinden uns jetzt an der Gedenkstelle für die Rostocker Synagoge. Hier stand die größte Synagoge von Mecklenburg, stand aber nicht sehr lange, von 1902 bis 1938. Dann, am 10. November '38, wurde die Synagoge angezündet. Für uns ist wichtig, dass die Synagoge stand ganz nah zu dem Haus, wo sich befindet jetzt die jüdische Gemeinde. Für uns ist das eine geistige Brücke zu der damaligen jüdischen Gemeinde hier in der Stadt."
Zu DDR-Zeiten arrangierten sich die ostdeutschen Juden mit dem real existierenden Sozialismus. Der Beginn der jüdischen Gemeinden nach 1945 deutete schon an, dass die Koexistenz von Judentum und Sozialismus nicht immer einfach sein würde.
"1948 – die Zulassung der jüdischen Landesgemeinde Mecklenburg war hier insofern sehr schwierig, weil es von staatlicher Seite Widerstand gab. Kulturminister Grünberg hat sich da ganz entschieden dagegen ausgesprochen. Und es waren dann SED-Genossen, die sich nach Berlin gewandt haben, an das SED-Zentralkomitee. Und haben sich darüber beschwert, wie die Genossen mit ihnen umgegangen sind."
Vorwurf der Nähe zur USA
Berichtet der Schweriner Journalist und NDR-Redakteur Axel Seitz, der ein Buch über die jüdische Landesgemeinde in Mecklenburg geschrieben hat. Der damalige mecklenburgische Minister für Volksbildung und Kultur, Gottfried Grünberg, hielt der jüdischen Gemeinde vor, dass sie Hilfspakete aus den USA erhielt:
"Ihr seid keine jüdische Gemeinde, sondern eine amerikanische Speckpakete-Empfängerorganisation."
Und in der Tat sorgten die sogenannten Joint-Pakete für Begehrlichkeiten. Joint – das war eine amerikanische Hilfsorganisation zur Unterstützung bedürftiger Juden. Die begehrten Pakete mit Büchsenmilch und Butter, Käse und Kaffee, Zigaretten und Zahnpasta hatten zur Folge, dass die jüdischen Gemeinden Anträge auf Neuaufnahmen kritisch durchleuchten mussten, um nicht Trittbrettfahrer, die keine Juden waren, aufzunehmen. Joint-Mitarbeiter warnten vor sogenannten Paketjuden.

Nach dem Krieg gab es in Mecklenburg und Vorpommern rund 150 Jüdinnen und Juden. Die meisten von ihnen hatten die KZs überlebt, einige führten sogenannte Mischehen, andere kamen aus dem Exil zurück. Einer der wenigen, der sich damals religiös engagierte und jüdische Gottesdienste organisierte, war der heute 87 Jahre alte Oljean Ingster. Er erinnert sich an die Anfänge.
"Es war sehr schwierig, Thora-Rollen haben wir von der evangelischen Kirche, die waren versteckt da, bekommen."
Oljean Ingster war als Jugendlicher in mehreren Konzentrationslagern. Er strandete dann 1945 mit 17 Jahren in Schwerin.
"Jeden Freitag und Sonnabend fanden Gottesdienste statt. Und 90 Prozent der Leute sind gekommen, wenn sie nicht gerade krank waren."
Da es aber keinen Rabbiner gab, übernahm der junge Oljean Ingster diese Aufgabe:
"Zum Gottesdienst braucht man nicht unbedingt einen Rabbiner. Ich hatte Kenntnisse. Und dann habe ich mich zur Verfügung gestellt."
Viele nicht-Religiöse zog es zunächst in den Osten
Die meisten Juden, die den Holocaust überlebten und in Deutschland blieben oder dorthin zurückkehrten, gingen nach Westdeutschland. Doch einige Hundert, vor allem nicht-religiöse Juden, zog es in den Osten Deutschlands, weil sie als Opfer des Faschismus dort das bessere Deutschland wähnten. Viele wurden von der SED enttäuscht, sagt der Publizist Micha Brumlik:
"Die Juden waren eine Gruppe zweiter Klasse. Sie waren nicht Widerstandskämpfer gegen den Faschismus, waren aber als Opfer des Faschismus anerkannt. Und das mag ein gewisses Gemeinschaftsgefühl gestiftet haben."
Die meisten, die aus dem Exil kamen, wollten sich oft auch nicht öffentlich zum Judentum bekennen. Ein Grund, warum sich gerade kommunistische Juden immer mehr von den Gemeinden entfernten, war wohl der Druck der SED. In der Sowjetunion wurde Anfang der 50er-Jahre ein neuer Antisemitismus sichtbar, vor allem in der sogenannten Ärzteverschwörung: einem angeblichen Komplott jüdischer Mediziner gegen Stalin. Der sowjetische Diktator beschimpfte Juden pauschal als "zionistische Verschwörer" und "wurzellose Kosmopoliten". Es folgten antisemitische Schauprozesse in Bulgarien und Ungarn. Der Potsdamer Historiker Mario Keßler erläutert:
"Es ist richtig, dass ein im starken Maße von der Sowjetunion initiierter Antisemitismus dazu führte, dass im Winter 1952/53 die jüdischen Gemeinden pauschal als potenzielle Agentenzentren westlicher Geheimdienste galten. Es gab Verhaftungen, es gab Fluchtbewegungen in den Westen."
Betroffen von Verfolgungen waren auch jüdische Spitzenfunktionäre wie Julius Meyer, Vorsitzender des Verbandes der Jüdischen Gemeinden in der DDR. Er wurde tagelang verhört und sollte eine Erklärung unterschreiben, dass es in der DDR keinen Antisemitismus gebe und die DDR ein antifaschistischer Staat sei. Meyer, seit 1930 in der KPD und Auschwitz-Überlebender, floh daraufhin im Januar 1953 in den Westen.
"Ein religiös gebundener Jude, das war gewissermaßen ein durchaus zu duldendes Überbleibsel aus der vor-sozialistischen Vergangenheit, aber ein Jude, der seine "konterrevolutionäre Gesinnung" mit dem Parteibuch tarnte, der wurde in der Regel noch härter verfolgt."
Stalin befeuerte Antisemitismus
Und ein weiteres Beispiel für den aufkommenden Antisemitismus in der DDR war Friedrich Broido. Er war Mitglied der jüdischen Landesgemeinde und Leiter des Arbeitsamtes in Schwerin. Broido wurde kurz nach Gründung der DDR verhaftet und zu zehn Jahren Zwangsarbeit in einem sowjetischen Gulag verurteilt. Nach Stalins Tod entließ man ihn im Dezember 1953 aus dem Arbeitslager. Er wurde erst 1991 nach seinem Tod vollständig rehabilitiert. Friedrich Broido blieb nach seiner Rückkehr aus dem Gulag in der DDR und engagierte sich weiter in der SED. In den 80er-Jahren wurde er Vorsitzender der kleinen mecklenburgischen Landesgemeinde. Er starb wenige Monate vor der friedlichen Revolution im Juni '89.
Die Folge des Antisemitismus in der Stalin-Ära: Vor allem die engagierten Mitglieder der jüdischen Gemeinden verließen den deutschen Arbeiter- und Bauernstaat. Die Zahl der Gemeindemitglieder schrumpfte in der gesamten DDR radikal:
"In dieser Zeit der Angst haben viele Juden die jüdischen Gemeinden verlassen, sind ausgetreten. Oder wirklich religiöse Juden sind in den Westen gewandert, das waren über 500 Juden. Und wenn man sich dann überlegt, dass in DDR insgesamt nur 1.500 in einer jüdischen Gemeinde waren, ein Drittel ist dann gegangen in den Westen – hat die jüdische Gemeinde auch viel an Personen verloren."

Erzählt Jascha Lina Jennrich, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Max-Samuel-Hauses in Rostock. Nach Stalins Tod 1953 ließ der Druck der SED auf jüdische Bürger nach. SED-Parteigenossen durften auch wieder Mitglied der jüdischen Gemeinden werden. Doch der Aderlass war unübersehbar. Aus dem gesamten Norden der DDR kamen Juden nun nach Schwerin, um den Minjan zu erfüllen: Das heißt, die Vorschrift, dass mindestens zehn religionsmündige Männer anwesend sein müssen, um einen Gottesdienst zu feiern.
"Dort traf man sich mit der ganzen Gemeinde, aber auch nur zweimal im Jahr, zu den großen Feiertagen, weil es doch einen großen Aufwand bedeutet, wenn man von Greifswald nach Schwerin kommen muss, um mal an einem Gottesdienst teilzunehmen. Deswegen wurde das auch zu einem großen Familienfest, wenn man dann auch die ganze Familie, die ja größtenteils nicht-jüdisch war, mitgebracht hatte. Dann gab es die kurze religiöse Feier. Und danach hat man sich ins Gasthaus gesetzt und hat miteinander gequatscht und gegessen."
Nach dem jüdischen Religionsgesetz ist nur der ein Jude, dessen Mutter Jüdin ist. Der Verband der jüdischen Gemeinden in der DDR sah die Mitgliedschaft allerdings sehr locker. Dessen Definition: Jude ist, wer Mitglied einer Gemeinde ist. Und dazu gehörten dann auch Familienangehörige, die gar nicht jüdisch waren.
Mitgliederschwund in den 50er- und 60er-Jahren
Auch in den späten 50er- und den 60er-Jahren hatten alle jüdischen Landesverbände in der DDR mit einem Mitgliederschwund zu kämpfen – durch Flucht in den Westen, aber auch durch Überalterung. Im Landesverband Mecklenburg sank die Zahl der Mitglieder auf unter 40. Von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde die jüdische Gemeinschaft erst wieder 1967 – beim Sechstagekrieg zwischen Israel und den drei arabischen Staaten Ägypten, Syrien und Jordanien.
Der DDR-Verband der jüdischen Gemeinden hatte beschlossen, keine antizionistischen Erklärungen abzugeben, obwohl die SED Druck ausübte, dass die jüdischen Gemeinden sich gegen Israel positionieren sollten:
"Während des Sechs-Tage-Krieges 1967 initiierte die DDR-Führung eine Erklärung jüdischer Bürger, die sich mit dem "Kampf der arabischen Völker gegen das imperialistische Israel" solidarisierten."
Es unterschrieben aber nur acht mehr oder wenige prominente jüdische DDR-Bürger diese Erklärung. Einer der wenigen war Alfred Scheidemann, von 1962 bis '72 Vorsitzender des Landesverbandes in Mecklenburg. Die Formulierung der DDR-Führung, Israel sei die Speerspitze des Imperialismus im vorderen Orient, stieß nicht nur bei den meisten Juden in der DDR auf Ablehnung, sagt der Historiker Mario Keßler.
"Das wurde in Israel auch von der Linken sehr schockiert wahrgenommen. Und sogar die Minderheit unter den linken Israelis, die die DDR als den besseren deutschen Staat sahen, wandte sich danach zunehmend von der DDR ab."
Auch in den 70er-Jahren stand die Israel-Politik der SED zwischen den jüdischen Gemeinden und der Staatsführung der DDR. Irene Runge, die seit den 60er-Jahren Mitglied der jüdischen Gemeinde im Osten Berlins war, erzählt von der Empörung in den Gemeinden, als damals eine Karikatur in einem SED-Parteiblatt eine jüdische Menora als Flammenwerfer gegen unschuldige Palästinenser darstellte.
"Ich erinnere mich noch, dass wir gemeinsam einen Brief verfassten an das ZK und dagegen protestierten. Ab Mitte der 70er-Jahre gab es da einen klaren Widerspruch seitens der Gemeinden."
Nie Hort der Opposition
Trotz dieser Proteste: Die jüdischen Gemeinden waren nie, wie später Teile der evangelischen Kirche, ein Hort der Opposition, betont der Publizist Micha Brumlik:
"Die waren völlig angepasst, die waren überhaupt nicht oppositionell. Die haben sich als eine Religionsgemeinschaft verstanden und waren froh, dass man sie hat das vollziehen lassen."
"Etwa in den 70er-Jahren gab es eine Haltung der DDR, die antireligiös war, aber die die jüdischen Gemeinden schon duldete, aber sich eher gleichgültig zu ihnen verhielt."
Jascha Lina Jennrich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Max-Samuel-Hauses in Rostock. In der Öffentlichkeit tauchten jüdische Gemeinden fast nicht auf. Viele Juden waren seit den 70er-Jahren vor allem auf der Suche nach einer Identität, sagt die Soziologin Irene Runge:
"Das war die Zeit, wo man sagte: Wenn die Thüringer Thüringer und die Sachsen Sachsen sind, wer sind wir. Ich glaube, damit begann es."
Irene Runge war damals nicht religiös und eher irritiert, als sie die Berliner Gemeinde besuchte, die sie als sehr kleinbürgerlich empfand:
"Die Religion, die Leute, der Ritus, dieses sehr Deutsche des Umgangs. Sie waren nicht die lebendigen, spritzigen Intellektuellen, von denen ich immer dachte, dass Juden so sind."
Auch ohne religiöse Ambitionen suchte Irene Runge die Gemeinschaft der Juden. So ging sie regelmäßig in das einzige Geschäft der DDR, in dem man koscher einkaufen konnte:
"Ich habe da Fleisch gekauft, weil es damals schwierig war, gutes Rindfleisch in der DDR zu kriegen. Und dieses Gefühl, dazu zu gehören, war ja immer wichtig. Wenn man so in einer Schlange steht, dann wird man sich ja auch vertrauter. Dann haben sie Matze verkauft und koscheren Wein. Nicht, dass man wusste, wozu das nötig ist. Ich glaube, wir haben alle angefangen einen Davidstern um den Hals zu tragen, was ja völlig Quatsch war. Man sucht ja etwas, womit man sich nach außen hin auch definiert. Und dann will man sich eigentlich abgrenzen, aber eigentlich will man natürlich immer noch dazugehören."
In den 80er-Jahren entspannte sich das Verhältnis der SED zum Judentum.
"Die DDR ging allgemein in den 80er-Jahren viel unbefangener mit dem jüdischen Erbe deutscher Geschichte um. Es gab zwei Tabus: Das eine war die Kampagne der Jahre 52/53, darüber wurde geschwiegen. Das andere Tabu war die Rolle dissidenter jüdischer Marxisten in der Arbeiterbewegung, wie zum Beispiel Paul Levy, wie Arthur Rosenberg oder wie August Thalheimer. Und fast bis zuletzt war natürlich der Name des größten kommunistischen Dissidenten, der zugleich Jude war, nämlich Leo Trotzki, ein Tabuthema."
80er-Jahre: Neue Ausrichtung der SED
Die neue Ausrichtung der SED war auch in Schwerin zu spüren. Dort übernahm nach dem personellen Niedergang der jüdischen Gemeinde in Mecklenburg der 80-jährige Friedrich Broido die Leitung – jener Broido, der Anfang der 50er-Jahre im sowjetischen Gulag gesessen hatte.
"Der war eigentlich auch nicht religiös, hat sich aber darum gekümmert, dass die Geschichte aufgearbeitet wird, und man die Juden nicht vergisst."
Mitte der 80er-Jahre wird so aus dem jüdischen Gemeindehaus am Schweriner Schlachtermarkt ein kleines Museum.
"Es war das erste Museum in der DDR, das sich mit der Judenverfolgung auseinandergesetzt hat."
Dass die SED das Judentum in der DDR entdeckte und auf einmal förderte, hatte einen handfesten Grund: Der Staatsratsvorsitzende wollte als außenpolitische Aufwertung seines Staates eine Einladung von Präsident Ronald Reagan in die USA. Welchen antisemitischen Vorurteilen auch Erich Honecker aufsaß, zeigte sein Kalkül:
"Er hat sich gesagt, Juden regieren doch die Welt. Das sind die, die Spitzen der Organisationen führen, und deswegen möchte er für die Juden was Gutes tun und hat dann viel Geld darein gesteckt, Denkmäler zu errichten. Das Centrum Judaicum wurde gegründet, sodass sich im ganzen Land mit dem Thema mehr beschäftigt wurde, Friedhöfe wieder hergerichtet, solcherlei Dinge, dir vorher wirklich vernachlässigt wurden."
Trotz dieses Engagements wurde Honecker nicht ins Weiße Haus eingeladen. Geholfen hat die finanzielle Unterstützung den Gemeinden.
"Was in ganz Mecklenburg an jüdisches Leben erinnert, sind die Friedhöfe. Dadurch, dass es früher in jedem kleineren Dorf eine jüdische Gemeinde gab, gibt es auch überall einen jüdischen Friedhof."
Allerdings waren viele in einem traurigen Zustand:
"In der DDR ging man damit nicht gerade feinfühlig um. Man hat dadurch, dass es keine jüdischen Gemeinden mehr gab in den Orten, vielfach gesagt, dass diese Friedhöfe ja nicht mehr nötig sind oder dass Anderes wichtiger ist. Und dann hat man die platt gemacht hat und dort neue Wohnhäuser errichtet, was natürlich sehr schade ist."
Noch 50 jüdische Friedhöfe in Mecklenburg-Vorpommern
Noch heute finden sich rund 50 jüdische Friedhöfe in Mecklenburg-Vorpommern; 20 wurden zu DDR-Zeiten zweckentfremdet, meist ohne Protest des Landesverbandes.
"Bei den Friedhöfen ist es ganz interessant, dass sich die jüdische Landesgemeinde Mecklenburgs mehrfach von Friedhöfen getrennt hat, Gelände verkauft hat, was heute undenkbar wäre. Die haben gesagt: Wir brauchen Geld, wir brauchen das Gelände nicht mehr, verkaufen wir. Wäre heute undenkbar, aber zu DDR-Zeiten wurde das öfter gemacht hier oben."
Undenkbar, da die ewige Totenruhe nach den jüdischen Gesetzen unantastbar ist. Eigentlich darf kein Grab eingeebnet, dürfen keine Gebeine umgebettet werden. Doch in einem Verband, der jahrzehntelang ohne Rabbiner auskommen musste, in dem seit den 1960er-Jahren kein Gottesdienst mehr stattfand und in dem nur die Hälfte der wenigen Mitglieder nach halachischer Vorschrift Juden waren, in so einem Verband war das Verständnis für religiöse Tradition nicht sehr ausgeprägt.
Am Ende der DDR gab es in den Nordbezirken keine zehn jüdischen Gemeindemitglieder mehr. Doch nach der friedlichen Revolution kamen Anfang der 90er-Jahre Zigtausende jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland – auch nach Mecklenburg-Vorpommern. Heute leben dort in den jüdischen Gemeinden mehr als doppelt so viele Menschen wie vor dem Holocaust.