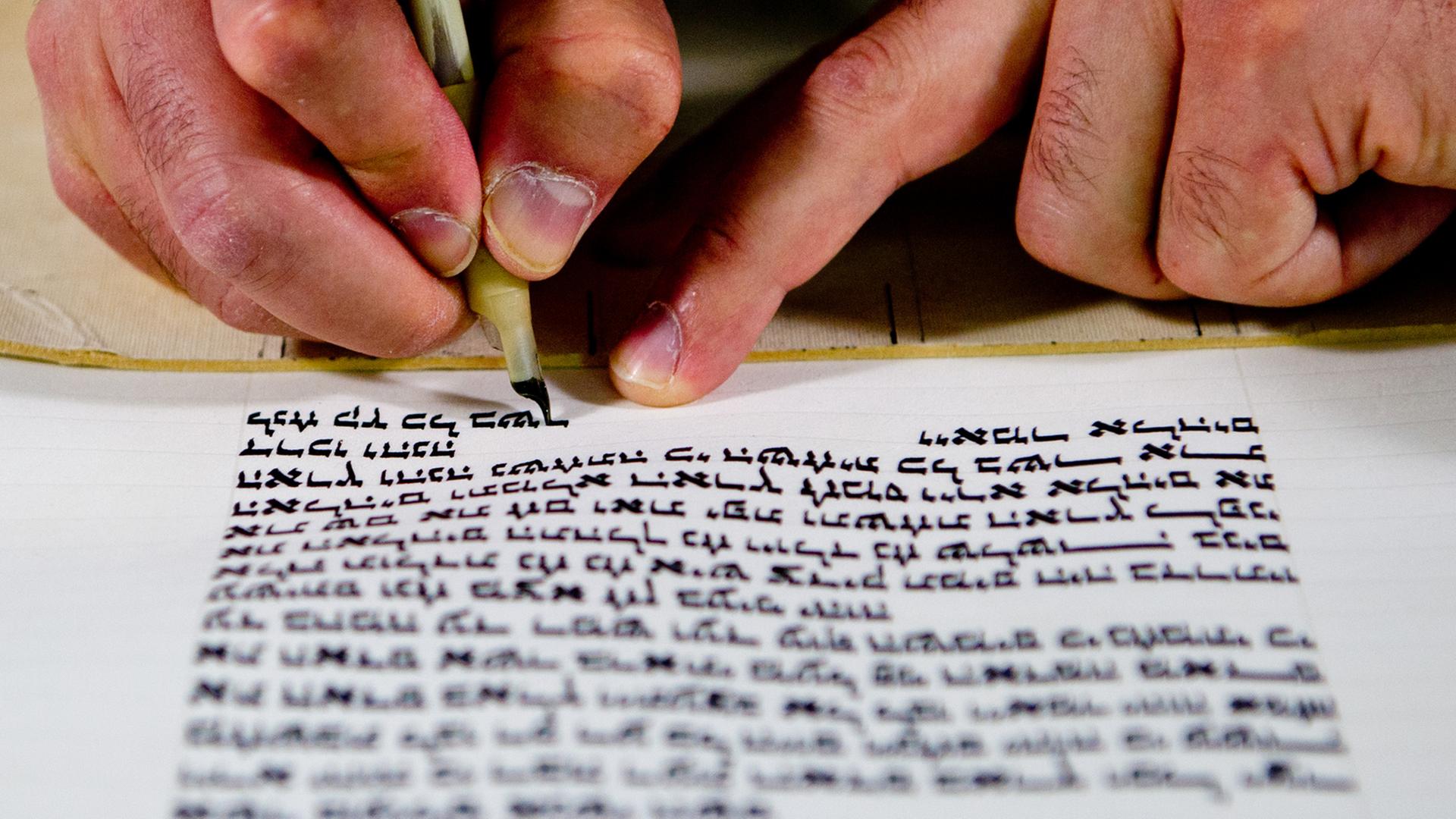"Ich bin Cecilia. Ich bin in Italien geboren und ich bin nach Berlin gekommen mit meinem Mann Yair. Er ist Israeli. Und nach unserer Hochzeit sind wir nach Berlin gekommen, weil wir waren so ein neues Paar und ich denke, wir hatten diese Idee, dass wir unser Judentum bauen. Und Berlin sah aus für uns wie ein ganz offener Ort und interessant."
Cecilia Haendler ist 30 Jahre alt und promoviert an der FU Berlin. Als verheiratete orthodoxe Jüdin trägt sie in der Öffentlichkeit immer eine Kopfbedeckung. An diesem Herbsttag eine schwarze Mütze. Dazu ein langer traditioneller Rock – und Turnschuhe. Cecilia und ihr Mann Yair sind auf dem Weg zu einer Diskussionsrunde über jüdischen sozialen Aktivismus.
"Es gibt diesen Wunsch nach jüdischen Sachen, aber nicht die Strukturen von der Gemeinde. Also interessiert es mich zu sehen, was hier gesagt wird."
Sozialer Aktivismus mit jüdischen Akzenten
Das Paar setzt sich in die letzte Reihe. Yair nimmt seine Baseball-Mütze ab, darunter trägt er eine Kippa. Unter den rund 15 Männern im Raum ist das eine Ausnahme. In der Diskussion geht es um Partys zum jüdischen Lichterfest Chanukka genauso wie um den Mitzvah Day – den Tag der guten Tat. Die Referenten berichten von dem Wunsch vieler junger jüdischer Menschen, sich einzubringen – in ihre Gemeinschaft genauso wie in die Gesellschaft.
"Ich hatte den Eindruck, dass viele dieselbe Frage hatten, nämlich: Wie kann ich den Laden am Laufen halten? Mir wurde klar beim Gespräch, dass das Wichtige ist, dass irgendetwas gemacht wird – dass man nach dem Motto verfährt: Was hilft, ist gut. Und das ist eine schöne Sache."
Levi Israel Ufferfilge ist Leiter einer jüdischen Schule in München und einer der Teilnehmer der Diskussionsrunde. Mit dabei ist auch Dalia Grinfeld. Sie ist die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Ihr kommt es beim sozialen Aktivismus vor allem darauf an, positive jüdische Akzente zu setzen:
"Also nicht nur Judentum im Rahmen von Holocaust und Antisemitismus und Nahost-Konflikt erleben und darüber sprechen und aktiviert werden wollen, sondern darüber hinaus: Wie kann ich das mit meinem Alltag verbinden? Warum bringt mir mein jüdisches Leben etwas Positives? Und wie kann ich das in der deutschen Gesellschaft auch zeigen?"
Das Gespräch kommt dennoch auf das Thema Antisemitismus.
"Vielfach wird von den Gemeinden und von jüdischen Individuen ausgemacht, dass gerade Menschen mit arabischem Migrationshintergrund und vermehrt auch Menschen mit türkischem Migrationshintergrund problematisch sind in Bezug auf Antisemitismus. Und man braucht den Dialog, damit das besser wird."
Dialog durch verbindende Erfahrungen
Wie dieser Dialog aussehen soll, bleibt offen. Klar ist für Levi Israel Ufferfilge, dass es nicht allein um Konflikte zwischen Juden und Muslimen gehen kann. Es gelte, gemeinsam etwas Gutes zu bewirken – etwa in der Flüchtlingshilfe, zumal viele Geflüchtete muslimisch sind.
"Wie kann man da den benachteiligten Menschen, die vor Krieg und Folter und Tod flüchten, helfen? Immerhin haben viele von uns Familien, die nur zwei Generationen zuvor ebenfalls schlimme Kriegs- und Fluchterfahrungen gemacht haben."
Diese verbindende Erfahrung ist beim Jüdischen Zukunftskongress auch Thema einer eigenen Veranstaltung: Da geht es um die Bedingungen für Juden, die vor 80 Jahren fliehen wollten aus Deutschland und Europa – und um die heutigen Fluchtbedingungen nach Europa. Und auch dem jüdisch-muslimischen Dialog ist eine eigene Diskussionsrunde gewidmet – unter dem Titel "Neue Allianzen". Möglichkeiten für solche Allianzen erkennt auch Cecilia Haendler.
"Also ich sehe diesen muslimisch-jüdischen Dialog in einer ganz positiven Art und Weise. Weil das ist mir passiert, dass ich junge muslimische Leute getroffen habe, und wir hatten eigentlich ganz viel gemeinsam. Über Speisegebote: Ah, bei Euch ist das so. Also das war ganz lustig. Und Kopftuch auch, dass jüdische orthodoxe Frauen auch Kopftuch tragen. Dann ist es sofort – es gibt ein Verständnis dafür."
In Deutschland allgemein sei das Verständnis für die jüdische Orthodoxie hingegen oft nicht so stark ausgeprägt.
"Was ich mir wünschen würde von der Mehrheitsgesellschaft, dass auch berücksichtigt wird, dass das Judentum auch ausgemacht wird durch koscheres Essen, Beschneidung, Kopftuch. Das ist ein Teil davon und das muss, denke ich, mehr hier eingebracht werden."
Judentum zwischen Paris und Berlin
Doch nicht nur in der Gesamtgesellschaft vermisst Cecilia Haendler jüdisch-orthodoxe Positionen – auch auf dem Jüdischen Zukunftskongress. Sie nimmt selbst an einer Diskussionsrunde zum Pluralismus im Judentum teil – und will sich stark machen für die Orthodoxie:
"Der Rahmen des Kongresses ist schon sehr liberal geprägt. Und wenn man von Pluralismus spricht, man sollte eigentlich vielleicht mehr – ich sage: das ist nicht einfach – aber ich hätte vielleicht mehr Orthodoxe auch eingeflochten."
Nach der Diskussion über den sozialen Aktivismus holen sich vor der Tür viele Gäste Kaffee oder Brezeln. Cecilia und Yair Haendler laufen am Buffet vorbei – denn sie gehen davon aus, dass das Catering auf dem jüdischen Kongress nicht koscher ist. Die beiden haben sechs Jahre in Berlin gelebt – und sind jetzt seit Kurzem in Paris, weil Yair da einen Job hat. Und Paris könnte sich für das orthodoxe Paar möglicherweise als attraktiver erweisen als Berlin.
"Gerade bin ich in diesem Moment – vielleicht werde ich das in einiger Zeit anders sehen – dass ich zwischen Paris und Berlin bin und das vergleiche. Und in Paris hatten wir das Gefühl: Endlich haben wir viel koscheres Essen. Und das war ein gutes Gefühl, was mir in Berlin gefehlt hat. Aber andererseits, was wir in Berlin mögen und was für uns wichtig war, ist, dass man hier eigentlich auch das eigene Judentum aufbauen kann."
In Paris gibt es zwar mehr orthodoxe Infrastruktur, in Berlin dafür mehr Raum, selbst etwas zu gestalten, sagt Cecilia Haendler. Deswegen kehren sie und ihr Mann Yair vielleicht auch eines Tages hierher zurück.