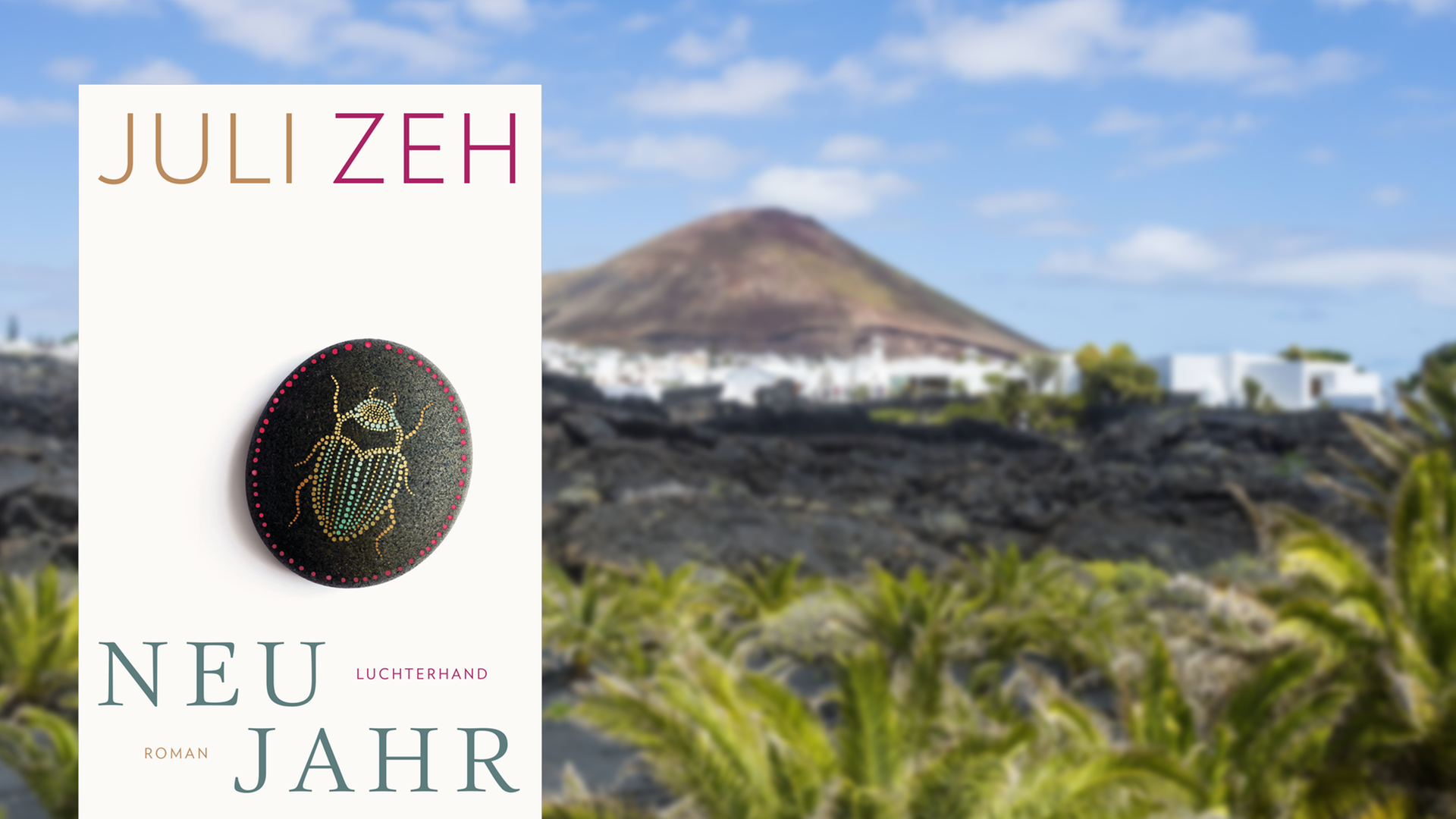
Man wird Juli Zeh nicht zu nahe treten, wenn man sie als engagierte Autorin bezeichnet. Das gilt im doppelten Sinne. Die promovierte Juristin ist bekannt für wirkungsvoll vorgetragene Debattenbeiträge vor allem in der Auseinandersetzung mit staatlicher Überwachung. Als Schriftstellerin hat die Vierundvierzigjährige in ihren bisher sieben Romanen immer wieder Themen aufgegriffen, die der Republik auf den Nägeln brennen: Sterbehilfe, Terrorismus, bröckelnder gesellschaftlicher Zusammenhalt, Verrohung der Jugend, Rechtsruck und Politikverdrossenheit ganz allgemein.
Vor allem aber ist Juli Zeh eine Autorin, die in den Begriffen "literarischer Anspruch" und "Genre" kein Gegensatzpaar erkennen mag. Zeh macht aus aktuellen Themen Literatur, und dazu diente ihr vor und nach ihrem erfolgreichen Gesellschaftsroman "Unterleuten" von 2016 zuweilen die Science Fiction, vor allem aber der Thriller als Vehikel; beides verband sich in ihrem bis dato jüngsten Roman, "Leere Herzen" von 2017, zum dystopischen Bild einer demokratiemüden Bundesrepublik.
Eine schmale Schneise
Auch in ihrem aktuellen Buch "Neujahr" baut Juli Zeh mit gewissem erzählerischem Aufwand ein Rätsel auf, das auf Lösung drängt. Dabei beginnt der Roman denkbar harmlos: Ein junges deutsches Paar mit zwei kleinen Kindern verbringt den Jahreswechsel auf der Kanareninsel Lanzarote, es gibt die üblichen alltäglichen Nervereien, und am Neujahrsmorgen tut der Familienvater das, was Familienväter so tun, wenn Sie grad keine Lust mehr auf Familie haben und die Selbstzweifel wachsen: Er schwingt sich aufs Rad.
"Ihm tun die Beine weh. Auf der Unterseite, wo Muskeln liegen, die man selten beansprucht und deren Namen er vergessen hat. Bei jedem Tritt stoßen seine Zehen an das Innenfutter der Turnschuhe, die fürs Joggen, nicht fürs Radfahren gemacht sind. Die billige Radlerhose schützt nicht ausreichend vor dem Scheuern, Henning hat kein Wasser dabei, und das Fahrrad ist definitiv zu schwer. Dafür ist die Temperatur fast perfekt. Radfahren ist pure Entspannung, beim Radfahren erholt er sich, auf dem Rad ist er mit sich selbst allein. Eine schmale Schneise zwischen Beruf und Familie. Die Kinder sind zwei und vier."
Das wird nicht gutgehen, denn Henning hat eine harte Strecke gewählt: Den Vulkan hinauf bis in Bergdorf Femés zieht es ihn, aus zunächst unerfindlichen Gründen. Im Rhythmus seines leicht erbarmungswürdigen Gestrampels lässt er sein Leben als moderner Mann Revue passieren, der sich die Erziehungsarbeit mit seiner tatkräftig-lebenstüchtigen Frau teilt, in seinem Beruf als Sachbuchlektor deshalb zurücksteckt und dennoch ein Gefühl des Ungenügens, ja, der Verlustangst entwickelt hat.
Dehydriert und unterzuckert
Nach und nach zeigt sich jedoch, dass Hennings Problem jenseits der üblichen männlichen Identitätskrisen liegen muss. Seit einer Weile plagen ihn dramatische Panikattacken, und der kundige Leser kapiert schnell, dass der Grund in Hennings früher Kindheit liegt. An die hat der Mittdreißiger bezeichnenderweise keine Erinnerungen. Er weiß nicht, was passiert war, bevor der Vater sich von der Mutter trennte, und unter welchen Umständen seine jüngere Schwester Luna, heute eine hübsche Frau ohne Halt im Leben, schon als Zweijährige ihre Schneidezähne eingebüßt hat. Klarer Fall: Trauma.
In Femés angekommen, bricht Henning dehydriert und unterzuckert neben einem Anwesen zusammen, das ihm seltsam bekannt vorkommt. Anstatt ihre Leser nun mit einer unerwarteten Auflösung zu überraschen, erzählt Juli Zeh in der zweiten Hälfte ihres achten Romans genau die Geschichte dieser traumatischen Kindheitserfahrung. Als Henning und Luna so klein waren, wie Hennings eigene Kinder jetzt sind, waren sie nämlich mit den Eltern auf Lanzarote, in genau diesem einsam gelegenen Haus bei Femés. Eines Morgens waren die Eltern verschwunden - und blieben es.
"Luna weint, nicht wütend, sondern leise. Ganz brav geht sie an Hennings Hand und weint dabei, und Henning spürt, dass er keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll. Dieses Nicht-Wissen ist das größte Ding, das ihm je begegnet ist, größer als die Berge, die Sonne und der Himmel, es ist ein schwarzes Nichts und so groß wie das Weltall selbst."
Nicht Fisch, nicht Fleisch
Das verzweifelte Warten der Kinder, ihren Hunger und Durst, schließlich ihre Rettung in letzter Sekunde schildert Juli Zeh aus der Perspektive des kleinen, überforderten Jungen, der nichts unversucht lässt. Das liest sich glaubwürdig, zuweilen herzergreifend. Überzeugend gelingen ihr in beiden Teilen des Buchs auch die Beschreibungen der überwältigenden Landschaft, ebenso die Familienszenen in der ersten Hälfte, aus dem heimischen Alltag wie aus dem touristischen Ausnahmezustand.
Dennoch hinterlässt die Lektüre des Romans seine Leserin unbefriedigt. Bis zum Schluss runden sich die unterschiedlichen Bestandteile nicht zu einem Ganzen. Geht es Juli Zeh um das Drama der sich selbst überlassenen Kinder? Um erschütterte männliche Selbstbilder und kippende Rollenvorstellungen? Um eine Trauma-Fallstudie? Oder einfach nur darum, die Literaturfähigkeit von Lanzarote zu erproben?
Es scheint, als habe die Autorin sich nicht recht entscheiden können, was sie eigentlich erzählen will. Um das zu kaschieren, reichen weder das landschaftlich reizvolle Setting noch die bewährten Versatzstücke der Spannungserzählung. Der Rückgriff aufs Genre schließt das Entstehen guter Literatur nicht aus. Er garantiert es aber auch nicht.
Juli Zeh: "Neujahr",
Luchterhand, München,
192 Seiten, 20 Euro
Luchterhand, München,
192 Seiten, 20 Euro



