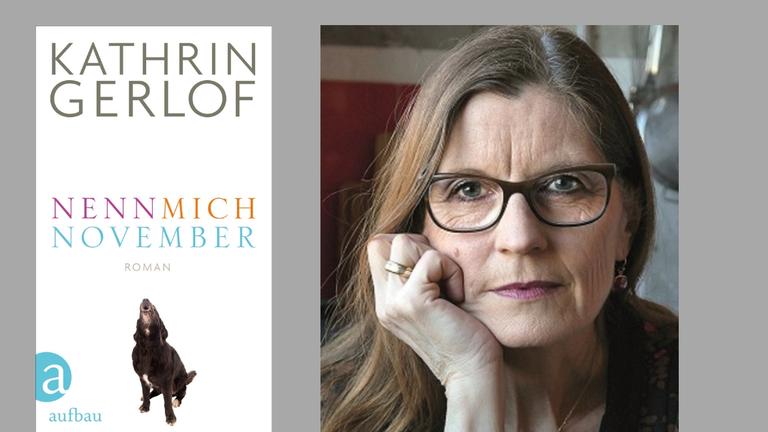
Kompostierbares Geschirr für die Wegwerfgesellschaft, das klingt nach einer zeitgemäßen Idee für ein cooles kleines Start-Up. Die beiden Berliner Marthe und David Lindenblatt wollen es aufziehen, nachdem Marthe ihre Stelle im Jobcenter frustriert gekündigt hat und ihr Mann mit dieser charmanten Gründungsidee kam. Dann ging alles viel zu schnell, um rechtzeitig die Reißleine zu ziehen: Das Zeug verkaufte sich nicht, weil es den Unternehmen für ihre Greenwashing-Kampagnen nicht spektakulär genug war, und irgendwann steht Marthe, die lieber "November" genannt werden möchte, mit zittrigen Händen am Geldautomat:
"Ich sollte mich jetzt nicht aufregen. Alles geschieht erwartungsgemäß. Erwartungsgemäß zieht mir die Bank die EC-Karte ein. Es ist nur noch ein kleines Puzzleteil im großen Panorama unseres Untergangs."
"Ich sollte mich jetzt nicht aufregen. Alles geschieht erwartungsgemäß. Erwartungsgemäß zieht mir die Bank die EC-Karte ein. Es ist nur noch ein kleines Puzzleteil im großen Panorama unseres Untergangs."
Gescheiterte Wessis im trostlosen Osten
Überschuldung, Firmenkonkurs, Privatinsolvenz. Vom Weg nach ganz unten erzählt Kathrin Gerlofs Roman "Nenn mich November". Oder genauer: Davon, wie das Leben weitergeht, wenn man dort unten angekommen ist, am Rand. Wenn man sich die Großstadt nicht mehr leisten kann und wegzieht auf ein Dorf mitten in den Mais-Wüsten Ostdeutschlands, wo es weder Arbeit noch vernünftiges Internet gibt. Dort hat David Lindenblatt vor Jahren ein altes baufälliges Haus geerbt, das jetzt die Rettung sein soll. Gescheiterte Mittelstand-Wessis im tristen Osten, wo dann auch noch - wir befinden uns im Jahr 2015 oder 2016 - zweihundert Asylbewerber in die ehemaligen Zwangsarbeiter-Baracken am Dorfrand einziehen.
Das ist die Versuchsanordnung von Kathrin Gerlofs Roman, und er hätte grandios scheitern können. Dass das nicht passiert, hat zwei Gründe: Die 1962 im ostdeutschen Köthen geborene Autorin meidet klug alle bei diesem Setting erwartbaren Klischees. Vor allem aber verfügt sie über einen Erzählton, der zwischen Lakonie und Zärtlichkeit von den ersten Sätzen an seinen eigentümlichen Sog entfaltet. Kathrin Gerlof beginnt ihre Geschichte nicht im hektischen Berlin, sondern mit einem archaisch anmutenden Bild und dem geheimen Protagonisten des Romans: das Dorf.
"Wenn das Dorf schläft, schleichen all seine Hunde über die Höfe und durch die Gärten. Ihre Schnauzen spüren dicht am Boden nach Lebendigem. Das Lebendige ist draußen. Drinnen schläft, was noch lebt."
Muss man sich so ein Elend antun?
"Im Dorf gibt es kein Begehren mehr", heißt es weiter. "Nur die Hunde steigen aufeinander, wenn die Zeit läufig ist." Nach dieser Ouvertüre ahnt man, wie es um die zweibeinige Bevölkerung steht. Man hat sich in der Lethargie eingerichtet, säuft gegen den Frust an und, wenn es unerträglich wird, hängt man sich in der Scheune auf. Landflucht, Arbeitslosigkeit, subventionierte Großbauern und Biogas-Anlagen, Umweltzerstörung und 13 Kilometer bis zum nächsten ALDI. Richtig, das liest sich über Strecken verdammt deprimierend. Muss man sich das Elend der Gegenwart auch noch in Roman-Form antun?
Nein, nicht unbedingt. Und natürlich wäre es zu wenig, würde Kathrin Gerlofs Roman einfach nur die Wirklichkeit doppeln. Stattdessen schildert sie diesen Mikrokosmos detailgenau von innen heraus, aus der Perspektive verschiedener Dorfbewohner, und spiegelt sie in der Perspektive der beiden Neuankömmlinge.
Da sind die beiden verfeindeten Großbauern Schulz und Krüger, die sich das Land unter den Nagel gerissen und im Dorf das Sagen haben. Der verrückte Prokorski, der mit sich selber spricht. Frieda, die an ihrem 82. Geburtstag beschließt, dass es genug ist mit der Einsamkeit und sich im Baumarkt zehn Meter Kälberstrick besorgt. Radomski, der immerhin noch halbherzige Zukunftsträume hat. Schließlich der pubertierende Robin mit seiner Alkoholikermutter, der clever genug zu sein scheint, irgendwann den Absprung zu schaffen.
Nein, nicht unbedingt. Und natürlich wäre es zu wenig, würde Kathrin Gerlofs Roman einfach nur die Wirklichkeit doppeln. Stattdessen schildert sie diesen Mikrokosmos detailgenau von innen heraus, aus der Perspektive verschiedener Dorfbewohner, und spiegelt sie in der Perspektive der beiden Neuankömmlinge.
Da sind die beiden verfeindeten Großbauern Schulz und Krüger, die sich das Land unter den Nagel gerissen und im Dorf das Sagen haben. Der verrückte Prokorski, der mit sich selber spricht. Frieda, die an ihrem 82. Geburtstag beschließt, dass es genug ist mit der Einsamkeit und sich im Baumarkt zehn Meter Kälberstrick besorgt. Radomski, der immerhin noch halbherzige Zukunftsträume hat. Schließlich der pubertierende Robin mit seiner Alkoholikermutter, der clever genug zu sein scheint, irgendwann den Absprung zu schaffen.
Das Dorf flaggt Schwarz-Rot-Gold
So weit, so gut gemacht - doch richtig spannend wird Kathrin Gerlofs Roman erst, als Großbauer Schulzes Plan, mit Fördergeldern die alten Baracken für zweihundert Flüchtlinge herzurichten, plötzlich zum Weckruf wird.
"Das Dorf rüstet sich zum Kampf. Damit hat es keine Erfahrung, denn wer tot ist, kämpft nicht. Nun aber droht Ungemach, das nicht einfach kleingeredet werden kann. Zweihundertfaches Ungemach. Dem Dorf ist das nicht einerlei. Drei Häuser haben eine schwarzrotgoldene Fahne gehisst, als ginge es gerade um den Sieg der Fußballnationalmannschaft. Dagegen kommt auch der größte Bauer nicht an. Sagen die Leute. Aber sie sind sich nicht sicher. Sie haben keine Erfahrung mit Kämpfen. Auch den letzten haben andere für sie gefochten, und plötzlich waren sie in ein neues Leben geschwemmt, das Wende getauft wurde. In dem haben sie sich eingerichtet, als sei es auch nur eine zweite Haut, die schlecht und recht passt."
"Das Dorf rüstet sich zum Kampf. Damit hat es keine Erfahrung, denn wer tot ist, kämpft nicht. Nun aber droht Ungemach, das nicht einfach kleingeredet werden kann. Zweihundertfaches Ungemach. Dem Dorf ist das nicht einerlei. Drei Häuser haben eine schwarzrotgoldene Fahne gehisst, als ginge es gerade um den Sieg der Fußballnationalmannschaft. Dagegen kommt auch der größte Bauer nicht an. Sagen die Leute. Aber sie sind sich nicht sicher. Sie haben keine Erfahrung mit Kämpfen. Auch den letzten haben andere für sie gefochten, und plötzlich waren sie in ein neues Leben geschwemmt, das Wende getauft wurde. In dem haben sie sich eingerichtet, als sei es auch nur eine zweite Haut, die schlecht und recht passt."
Eine Bürgerwehr wird gegründet, vorsichtshalber. Doch die Autorin begeht nicht die Dummheit, jetzt das Klischee zu erfüllen und eine Horde Brandsätze werfender Skinheads loszuschicken.
Wohltuend: Eine Ex-DDR-Geschichte ohne Klischee-Skinheads
Kathrin Gerlofs "Nenn mich November" ist kein Roman über die aktuelle Flüchtlingsthematik. Vielmehr dient das Fremde dazu, einen genauen Blick auf das Land zu werfen, in das die Fremden kommen: Auf uns selber, unsere Verunsicherung, Versäumnisse, Ängste und unsere Selbstentfremdung. Die Menschen haben vergessen, wie man lebt, heißt es im Roman. "Sie existieren, aber sie sind schwach und geben nur unnützes Wissen weiter." Und die bankrotten Lindenblatts? Das Dorf wird die beiden verschlingen und die Liebe verschütten. Während Marthe alias November weiterhin akribisch die weltweiten Katastrophen von Konsumwahn bis Klimawandel recherchiert, kapselt David sich in zunehmendes Schweigen ein.
Die Pointe und Radikalität von Kathrin Gerlofs Roman liegt darin, dass die Gewissheiten kippen. Es geht nicht um Stadt versus Provinz, Erfolg versus Scheitern, denn auch das Treiben in Berlin erscheint aus der Distanz wie ein irrer Totentanz. Vielleicht - dieser verwegene Gedanke stellt sich ein - lässt es sich im toten Winkel der Provinz sogar gut leben, wenn man alles losgelassen hat, nichts mehr erwartet, so wie David Lindenblatt?
Die Pointe und Radikalität von Kathrin Gerlofs Roman liegt darin, dass die Gewissheiten kippen. Es geht nicht um Stadt versus Provinz, Erfolg versus Scheitern, denn auch das Treiben in Berlin erscheint aus der Distanz wie ein irrer Totentanz. Vielleicht - dieser verwegene Gedanke stellt sich ein - lässt es sich im toten Winkel der Provinz sogar gut leben, wenn man alles losgelassen hat, nichts mehr erwartet, so wie David Lindenblatt?
Sieht so der neue deutsche Heimatroman aus?
So geht es in Kathrin Gerlofs Roman "Nenn mich November" um konkrete biografische Erfahrungen und die jüngste deutsche Vergangenheit. Gleichzeitig zielt dieses melancholische Requiem auf ein sterbendes ostdeutsches Dorf auf das große Ganze unserer katastrophischen Gegenwart, das Marthe in ihren Selbstgesprächen verzweifeln lässt: Die Unfähigkeit, diesen Planeten friedlich zu bewohnen, ohne anderen Menschen ihre Würde zu nehmen. Wenn das der neue deutsche Heimatroman ist, kann man nur sagen: Gerne mehr davon!
Kathrin Gerlof: "Nenn mich November"
Aufbau Verlag, Berlin. 352 Seiten, 20 Euro.
Aufbau Verlag, Berlin. 352 Seiten, 20 Euro.
