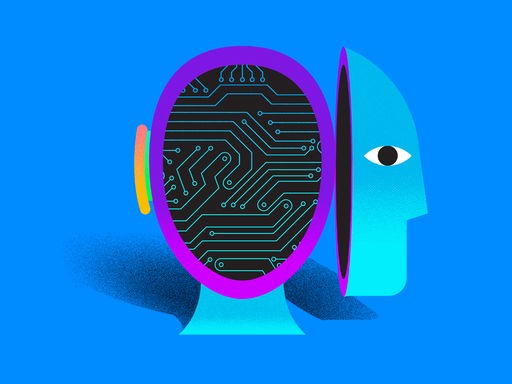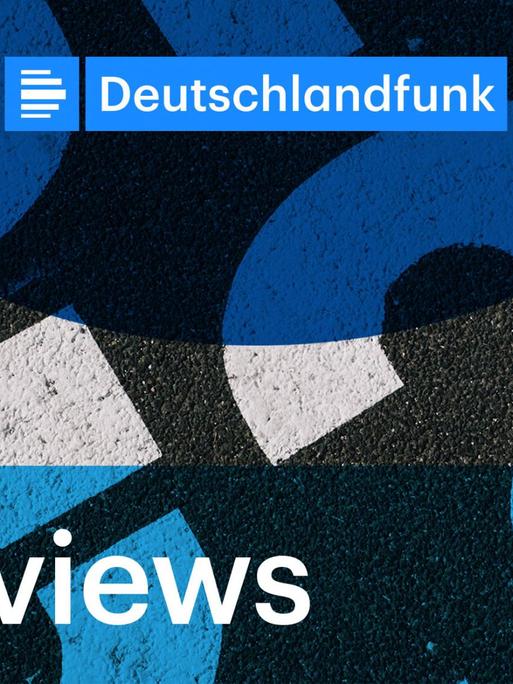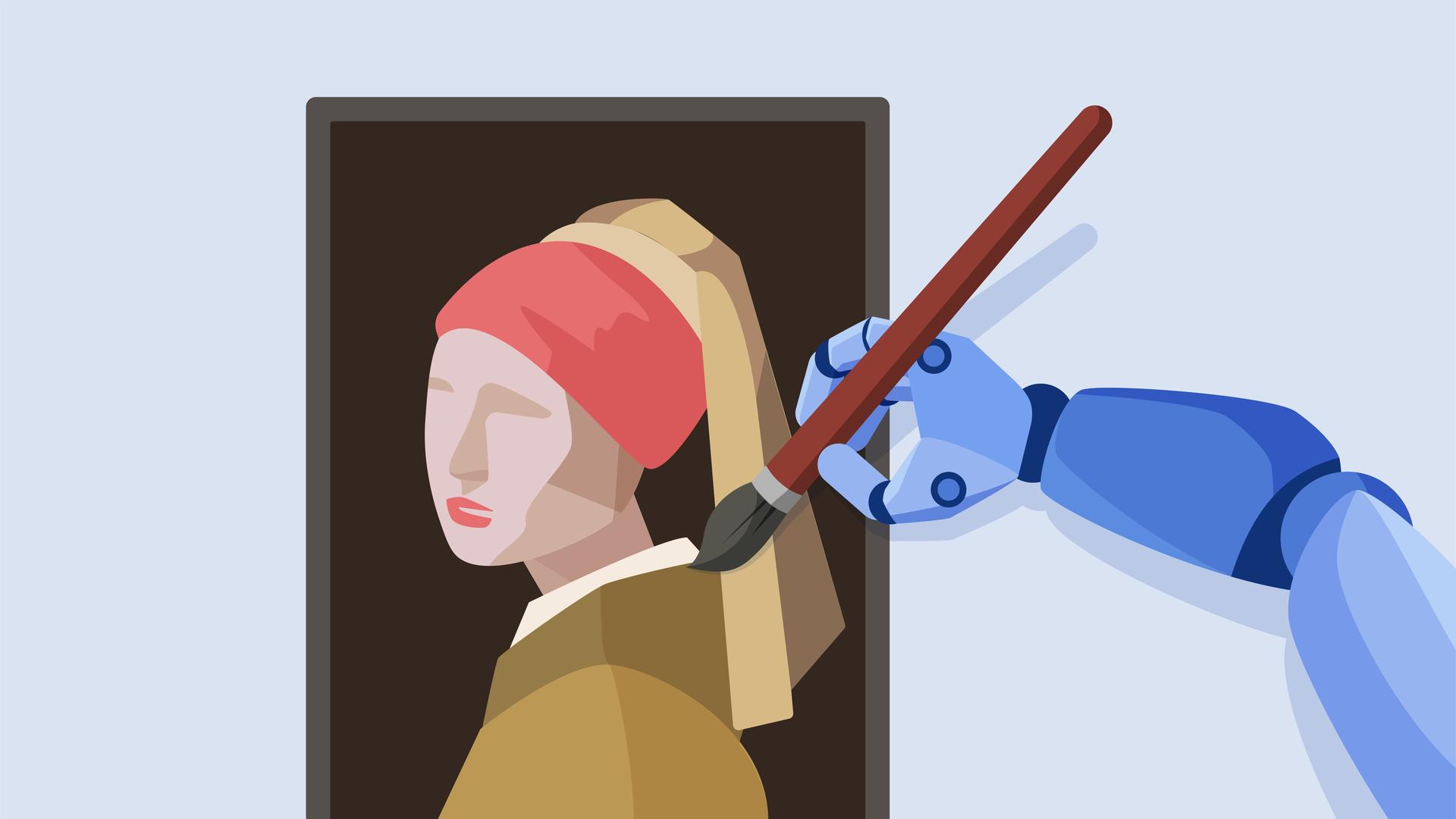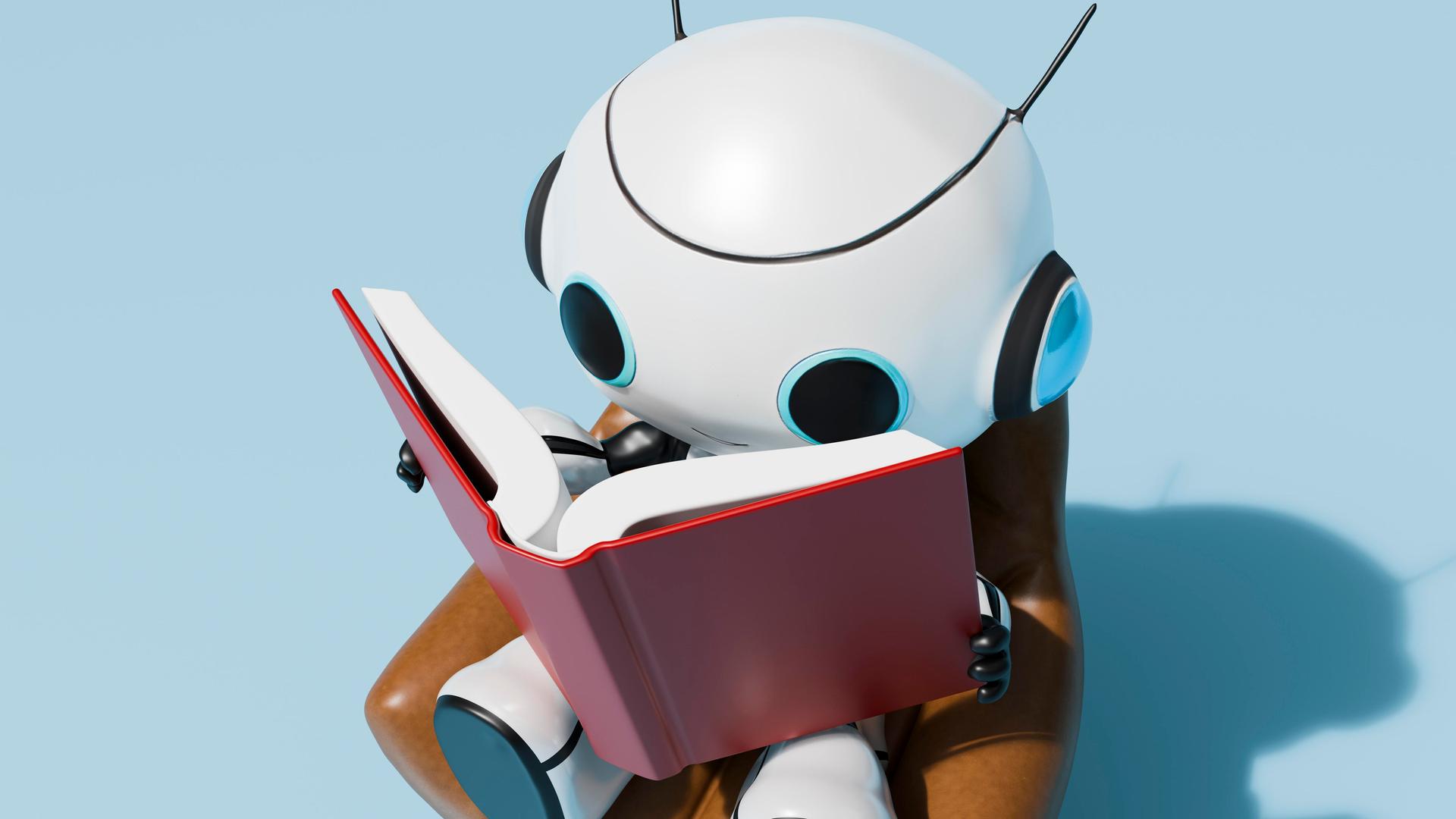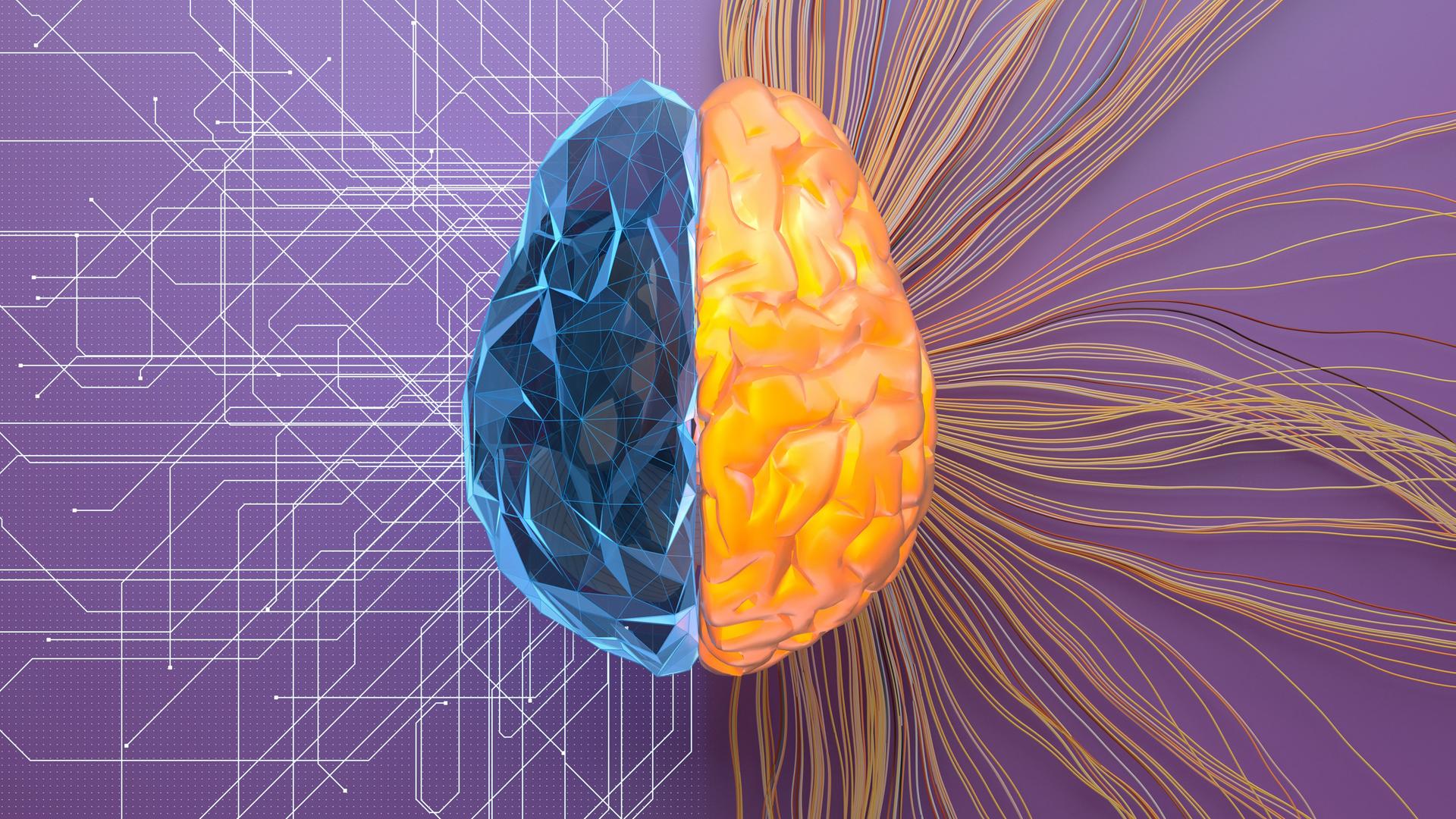Die sogenannte Künstliche Intelligenz hat sich in kürzester Zeit zu einem allgegenwärtigen Trend entwickelt, dem eigentlich niemand entgehen kann. Von KI-unterstütze Programme haben in vielen Unternehmen Einzug gehalten. Auf vielen neuen Handys sind KI-Programme inzwischen Standard. Und Millionen Menschen nutzen sie – auch für persönlichste Fragen.
Dass dabei seit rund drei Jahren gerade auch an den Börsen ein Hype entstanden ist, verschweigt auf die entsprechende Frage hin, auch ChatGPT nicht, das vielleicht bekannteste KI-Programm:
„Ja, rund um künstliche Intelligenz hat sich an der Börse eindeutig ein Hype entwickelt. Das schlägt sich in stark steigenden Kursen, enormen Bewertungen und hitzigen Diskussionen über mögliche Blasen nieder“, so die Antwort von ChatGPT.
Das KI-Unternehmen OpenAI, der Entwickler des Chatbots ChatGPT, ist mittlerweile offenbar das wertvollste Startup, das es jemals gab: Es wird mit 500 Milliarden US-Dollar bewertet. Das ist genau so viel, wie Deutschland in den kommenden Jahren an Extra-Schulden für Investitionen machen will.
Was dran ist am KI-Hype an den Börsen
Vieles, was heute als Megatrend Künstliche Intelligenz bezeichnet wird, ist nicht nur kursmäßig auf Fantasie aufgebaut, sondern tatsächlich auf einem grundsoliden Fundament, meint Chris-Oliver Schickentanz, Kapitalmarktstratege bei der Capitell Vermögens-Management AG. Die Umsatzzahlen von Nvidia etwa hätten sich binnen kürzester Zeit vervierfacht. Und das schlage sich dann auch entsprechend in den Kurssteigerungen nieder.
Auch Börsenprofi Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, sieht KI als einen Hype, der jedoch auf einem realen Fundament gründet. Die Unternehmen seien zwar sehr hoch bewertet, aber die Künstliche Intelligenz sei etwas, „was für mich gleichbedeutend ist mit der Erfindung der Dampfmaschine oder der Eisenbahn. Das wird auf jeden Fall die Produktivität der Volkswirtschaften nach vorne bringen“. KI werde immer stärker eingesetzt, auch in kleinsten Bereichen, etwa beim Arzt, und damit sei auch nach wie vor Potenzial in den Aktienmärkten.
Kritik an der Entwicklung der KI-Unternehmen
Aktuell warnen sehr viele kritische Stimmen davor, dass in Sachen Künstlicher Intelligenz in den kommenden Jahren richtig viel Geld verbrannt werden wird. Selbst Sam Altman, der Chef von OpenAI, vertritt diese Meinung - aber er meint damit selbstverständlich nicht sein eigenes Unternehmen.
Auch David Solomon, Chef der Investmentbank Goldman Sachs, ist dem eigenen Vernehmen nach beunruhigt, weil viele Unternehmen an den Börsen so gigantisch hoch bewertet würden. Denn das, was gerade passiert, ist eine große Wette auf die Zukunft. Fast täglich werden neue, riesige Investitionen angekündigt in KI-Unternehmen oder vor allem in die Infrastruktur, die sie benötigen: riesige Rechenzentren, Serverfarmen, die in den USA auf die grüne Wiese gestellt werden.
Aber noch verdient OpenAI kein Geld. Im Gegenteil, das Unternehmen verbrennt es vor allem und dabei ist offen, ob es am Ende überhaupt das Rennen machen wird. Vielleicht wird ja eine chinesische KI der große Gewinner, oder eine aus Saudi-Arabien. Die benötigen aktuell weniger Rechenpower und sind damit energieeffizienter.
Und es gibt weitere offene Fragen. Selbst OpenAI, die im Moment meistgenutzte generative KI, hat noch gar nicht so viele Nutzer. 700 Millionen sind es und nur jeder 35. von ihnen ist bereit, für sein Abo auch etwas zu bezahlen. Das heißt, die meisten nutzen die kostenlose Version der Künstlichen Intelligenz. Aber jede neue Anfrage kostet wieder Rechenleistung und damit Energie und Geld. Deswegen ist noch unklar, womit die Unternehmen überhaupt Profit machen werden.
Marktkonzentration in den USA
Mittendrin im Börsenboom sind etwa der Chiphersteller Nvidia und auch sonst praktisch alle IT-Platzhirsche in den USA wie Amazon, Google, Microsoft oder die Facebook-Mutter Meta. Sie alle haben ihren Teil zu den jüngsten Rekorden an den US-Aktienmärkten beigetragen. Hier liegt aber auch eines der Probleme: die sehr hohe Marktkonzentration. Dadurch sind die Technologieunternehmen, die sich mit KI beschäftigen, möglicherweise viel zu abhängig voneinander.
Ein Beispiel: Der Chiphersteller Nvidia investiert 100 Milliarden Euro in OpenAI. Mit dem Geld von Nvidia baut OpenAI neue Rechenzentren. In denen werden genau die Prozessoren verwendet, die Nvidia liefert. Das Ganze ist also eine Art Ringtausch. Die Unternehmen machen Geschäfte untereinander, steigern damit ihren Umsatz und treiben so ihre Bewertungen in die Höhe. Doch wenn eines von beiden finanzielle Probleme bekommen sollte, dann wackelt das andere gleich mit. Und in der Folge möglicherweise noch viele weitere kleinere Unternehmen, die ebenfalls involviert sind.
Erinnerungen an die Dotcom-Blase
Das Szenario erinnert an die letzte große Börsenblase, die sogenannte Dotcom-Bubble vor 25 Jahren. Damals wurde auch sehr viel Geld in eine Infrastruktur investiert, für die es noch keine Nachfrage gab.
In der frühen Phase des Internets kurz vor der Jahrtausendwende gingen fast täglich neue Firmen an die Börsen, und ihre Kurse schossen oft sofort steil nach oben. Manch einer dachte damals, dass das Internet so revolutionär sei, dass die gewöhnlichen Bewertungsmaßstäbe für Aktien, wie der Umsatz oder der Gewinn eines Unternehmens, nicht mehr zählen.
Alles, was im Namen die Endung .com (Dotcom) führte, war als Investitionsobjekt begehrt. Es entstand eine Welle der Euphorie. Klaus Nieting hat lebhafte Erinnerungen an diesen Börsenhype. Er ist Anwalt und Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. „Damals konnten sie nicht zum Friseur gehen, ohne dass sie vom Friseur gefragt wurden, ob sie diese oder jene Aktie bei der Neuemission zugeteilt bekommen haben oder nicht.“
Das heißt: Aktien waren damals wirklich in aller Munde. Viele investierten ihr Geld in Papiere von Unternehmen, oftmals ohne zu wissen, was die eigentlich machten. Und fast alle diese Unternehmen zeichnete aus, dass sie kaum Umsätze, geschweige denn Gewinne machten.
Bei vielen blieb das so – und die Blase platzte im Jahr 2000. Der Kurs der Aktie von Amazon zum Beispiel brach um 94 Prozent ein. Und es dauerte Jahre, bis er sich wieder erholte.
Die Folgen eines möglichen Endes des KI-Hypes
Ein Ende des KI-Hypes in den USA hätte enorme Auswirkungen. Denn ohne die brummende KI-Branche würde die Wirtschaft der USA derzeit nicht wachsen, sondern schrumpfen. Die Ausgaben für den Bau von Rechenzentren sind so groß, dass die US-Wirtschaft laut der Deutschen Bank nur wegen der Ausgaben für diese Rechenzentren wächst.
Wenn die Wirtschaft der USA nicht mehr wachsen würde, wären die Folgen weltweit spürbar. Noch größer wird das Problem dadurch, dass anders als sonst bei Startups oder Risikoinvestments auch viele Banken und Pensionsfonds in KI-Unternehmen investiert haben. Diese verwalten auch Geld von Menschen in Europa und Deutschland.
Darüber hinaus sind auch in vielen Indexfonds, den Exchange Traded Funds (ETFs), automatisch Aktien von Technologieunternehmen aus den USA enthalten. ETFs sind vor allem bei Kleinaktionären und für die Altersvorsorge beliebt. Ein Crash bei den Technologiewerten würde also auch sie hart treffen.
Was tun als Anleger?
Wer meint, jetzt noch schnell einsteigen und sich Unternehmenspapiere von KI-Unternehmen in sein Depot legen zu müssen, sollte lieber noch einmal überlegen. Denn die Börsen befinden sich gerade auch wegen des KI-Hypes auf Rekordniveau.
Anleger sollten es vermeiden, sich von Hypes anstecken zu lassen. Denn die haben die unangenehme Eigenschaft, wie der Dotcom-Hype um die Jahrtausendwende, wie eine Blase zu platzen. Die vermeintliche Trauminvestition in KI-Unternehmen könnte sich dann als Luftnummer erweisen.