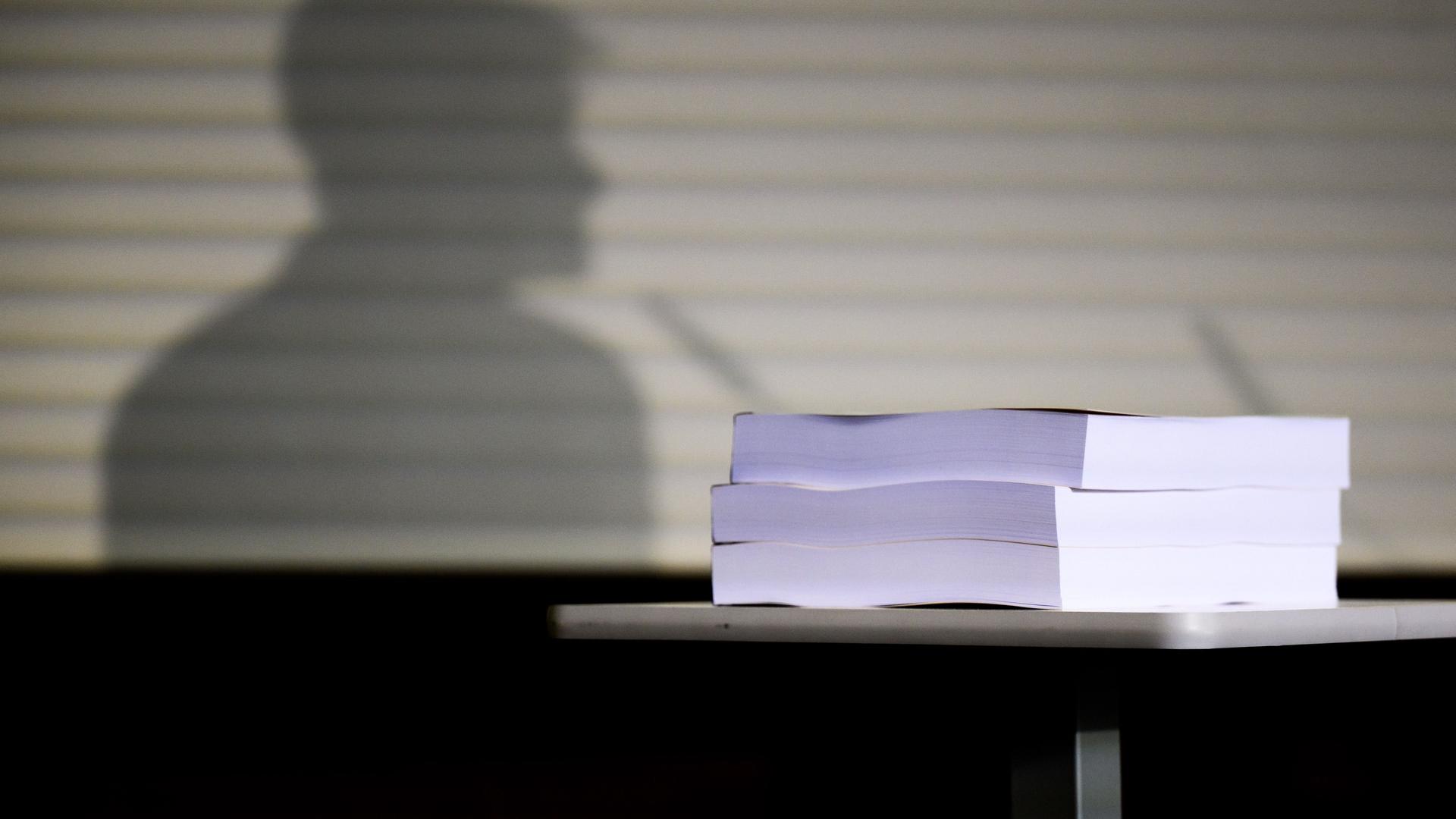
Die ehemalige Landesbischöfin und Ratsvorsitzende der EKD, Käßmann, sagte im Deutschlandfunk, es sei eine bittere Erkenntnis, dass Missbrauch in diesem Ausmaß möglich gewesen sei. Sie habe zugleich einen "Zorn auf die Täter" und auf diejenigen, die die Taten vertuscht hätten. Bisher habe sie geglaubt, ihre Generation sei mit dem Thema anders umgegangen, müsse jetzt aber sehen, dass auch ihre Generation die Taten vertuscht habe; die Täter seien mitten unter ihnen gewesen. Die Missbrauchsfälle und der Umgang damit würde die Kirche in ihren Grundfesten erschüttern.
Gebrande: Staat muss Betroffenen Recht auf Aufarbeitung geben
Käßmann forderte, jetzt klare Strukturen zur Aufarbeitung zu schaffen. Man müsse die Machtstrukturen hinterfragen und eine unabhängige Ombudsstelle einrichten, an die Betroffene sich wenden könnten. Auch die Vorsitzende der von der Bundesregierung eingesetzten Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, Gebrande, hat Konsequenzen gefordert. Sie sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, es sei klar, dass hier auch der Staat versagt habe. Die Aufarbeitung gehöre in staatliche Hand und es sei notwendig, dass es eine gesetzliche Grundlage gebe, die Betroffenen das Recht auf Aufarbeitung gebe. Gleichzeitig sollten Institutionen wie die Kirche verpflichtet werden, die Vorgänge aufzuarbeiten.
Größtenteils nur Auswertung von Disziplinarakten
Kritik gibt es vor allem, dass im Rahmen der Studie nicht flächendeckend Personalakten ausgewertet werden konnten, sondern größtenteils auf Disziplinarakten zurückgegriffen werden musste. Die Autoren der Studie sprachen daher davon, dass es sich bei den Zahlen, die man konkret habe greifen können nur "die Spitze der Spitze eines Eisbergs" handele. Laut der Studie ist das Ausmaß der sexualisierten Gewalt dennoch deutlich höher als bislang angenommen. Seit 1946 zählte man mindestens etwa 2.200 Opfer und 1.259 Beschuldigte.
Einzelne Landeskirchen wollen weitere Studien in Auftrag geben
Der Präses der evangelischen Landeskirche im Rheinland, Latzel, hat als Reaktion auf die Studie jetzt eine weitere wissenschaftliche Aufarbeitung angekündigt. Er sagte der "Kölnischen Rundschau", die rheinische Landeskirche wolle gemeinsam mit den Landeskirchen von Westfalen und Lippe eine eigene große Regionalstudie in Auftrag geben. Latzel nahm auch zur von den Studienautoren beklagten schleppenden Aktenbereitstellung Stellung. Er sagte, man habe im Rheinland alle Personal- und Disziplinarakten auf landeskirchlicher Ebene durchgesehen und die Informationen dazu auch weitergegeben.
Religionssoziologe rechnet mit weiter hohen Austrittszahlen
Der Münsteraner Religionssoziologe Pollack geht davon aus, dass sich die Kirchenkrise nach Bekanntwerden der Studienergebnisse ausweiten wird. Die Ergebnisse würden vor allem die treffen, die viel von der Kirche hielten, erklärte er in einem Interview der Katholischen Nachrichten-Agentur. Als Folge rechne er mit weiterhin hohen Kirchenaustrittszahlen auch aus der evangelischen Kirche.
Zugleich zeigte sich Pollack überrascht davon, dass auch der Missbrauch in der evangelischen Kirche ein Männlichkeitsphänomen ist. Die Taten seien demzufolge nicht in erster Linie auf den Zölibat in der katholischen Kirche zurückzuführen. Mit der Studie könne man jetzt auch zwischen den Geschlechtern sowie zwischen Verheirateten und Unverheirateten vergleichen. Laut der Studie waren fast 65 Prozent der Opfer männlich. Bei den Beschuldigten handelt es sich fast nur um Männer (99,6 Prozent). Rund drei Viertel von ihnen seien bei der ersten Tat verheiratet gewesen.
Weitere Informationen
Diese Nachricht wurde am 26.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
