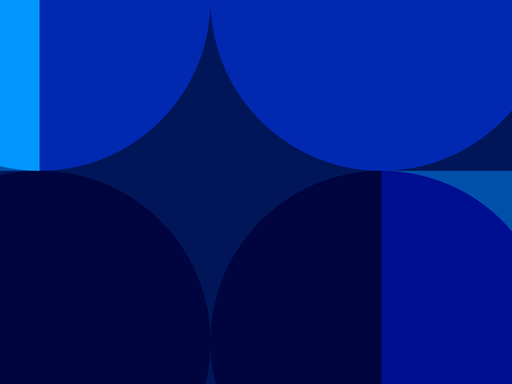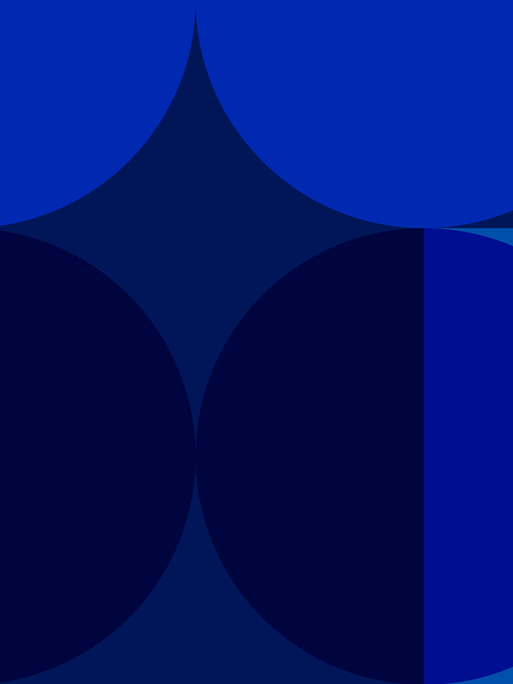Irgendwann musste es wahrscheinlich auch hier passieren - im größten Museum der Welt. Schließlich haben nicht nur Einbrüche in Museen seit einigen Jahren Konjunktur, sondern genau die Art von Einbrüchen, wie er nun den Louvre getroffen hat: sehr unauffällig ausspionieren, wo und wie man schnell rein- und wieder wegkommt. Sehr schnell zur Beute. Sehr brutal Wand- oder Standvitrinen zertrümmern. Und dann sehr schnell wieder abhauen. So war es in Berlin und in Dresden, in Drente und in Cardiff, in Köln und in Manching. Und immer ging es um Gold, Silber und Juwelen.
Frankreich trifft der Überfall auf den Louvre - nach dem Brand der Kathedrale Notre Dame, nach dem Goldraub aus dem Pariser Naturkundemuseum erst kürzlich, nach einer permanenten Regierungskrise – in seinem Innersten: Nicht einmal die glorreiche Vergangenheit der Grande Nation scheint noch unangreifbar.
Sicherheitsprobleme und fehlendes Personal
Auf Sicherheitsprobleme im Louvre, auf fehlendes Personal und schlechte Bezahlung haben im in den vergangenen Monaten nicht nur die Gewerkschaften immer wieder hingewiesen. Auch Louvre-Präsidentin Laurence des Cars hatte wegen des schlechten Zustands des Gebäudes regelrecht Alarm geschlagen. Staatspräsident Macron hat danach zwar hunderte Millionen Euro für die Sanierung genehmigt. Ausgegeben wurden sie bislang aber nur zu einem Bruchteil.
In Deutschland ist das nicht anders. Spätestens seit den Überfällen auf das Bode-Museum in Berlin und das Grüne Gewölbe in Dresden haben Länder und Kommunen die Gefahr für die meist von ihnen getragenen öffentlichen Museen zwar erkannt. Angesichts leerer Kassen überall fließen Gelder für Sicherheit aber auch bei uns nach wie vor nur unangemessen spärlich.
Einen mysteriösen Auftraggeber gibt es wohl nicht
Und die Beute aus dem Louvre? Sie ist auch diesmal so berühmt, dass sie sich nicht verkaufen lässt. Und den immer wieder vermuteten reichen Auftraggeber für solche Diebstähle haben die internationalen Polizeibehörden seit Jahrzehnten nirgends gefunden. Die Wahrheit ist wohl viel profaner: Juwelen können umgeschliffen werden, Edelmetalle lassen sich ganz leicht einschmelzen und dann problemlos verkaufen.
In Frankreich wird die Polizei deshalb schnell handeln müssen. Teile des sächsischen Staatsschatzes, die vor sechs Jahren auf ganz ähnliche Weise aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen wurden, fehlen bis heute. Vom kulturell bedeutenden Keltenschatz, der vor drei Jahren aus dem Museum im bayerischen Manching gestohlen wurde, sind bislang nur einige wenige Münzen wieder aufgetaucht – eingeschmolzen, als Goldklumpen. Eine Chance, unermessliche Kulturschätze wieder zu bekommen, besteht nur dann, wenn man sie vor der Zerstörung wiederfindet.