
Andreas Main: Christian Lehnert schreibt. Er schreibt zum Beispiel Libretti für Opern und er schreibt Bücher. Nehmen wir mal die Titel von zwei Büchern, die zuletzt von ihm erschienen sind und die diesem Gespräch mit ihm zugrunde liegen und die deutlich machen, dass Christian Lehnert in keine Schublade passt. Da ist zum einen "Der Gott in einer Nuß - Fliegende Blätter von Kult und Gebet" oder der zweite Titel – "Cherubinischer Staub: Gedichte". Das ist natürlich keine ganz einfache Kost, jedenfalls nicht für Leser popkultureller Massenbuchware. Diese Texte berühren, sie verunsichern, sie trösten, sie hauen einen womöglich auch aus der Bahn.
Das wird womöglich ein Gespräch, das ein bisschen schwierig wird, weil seine Texte so wunderbar schillern, schweben und oszillieren. Aber ein Gespräch bei "Tag für Tag – Aus Religion und Gesellschaft" darf auch mal schwierig sein, darf irritieren. Das führen wir, indem wir es aufzeichnen und indem wir uns in die Augen schauen können. Deswegen sitzen Christian Lehnert und ich zusammen in einem MDR-Studio in Leipzig. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, guten Morgen, Herr Lehnert.
Christian Lehnert: Guten Morgen, ich freue mich.
Main: Herr Lehnert, ganz sicher sind Sie also Lyriker, Schriftsteller, Dichter, evangelischer Theologe. Sie sind ordinierter Pfarrer. Sie sind wissenschaftlicher Geschäftsführer des Liturgiewissenschaftlichen Instituts der VELKD an der Universität Leipzig. Womit verbringen Sie die meiste Zeit? Oder lässt sich das gar nicht trennen?
Lehnert: Das lässt sich schwer sagen. Die Dinge fließen so ineinander und die schriftstellerische Tätigkeit und die Theologie sind miteinander verzahnt. Und oft schreibe ich Essays, die teils für die Lehrer sind, teils für manchmal wissenschaftliche Bände und teils literarischer Natur. Ich bin da ja immer in so einem Zwischenfeld.
Ich bin ja auch streng genommen kein wirklicher Wissenschaftler. Der Schuh ist zu groß für mich. Also, ich habe ja keine universitäre Karriere in dem Sinne, sondern ich bin ja in die Liturgiewissenschaft gekommen, weil ich Gedichte geschrieben habe, weil ich Libretti geschrieben habe, weil ich was von Theater verstehe, von Sprachklang. Und das ist im evangelischen Raum, wo Gottesdienstbücher und Agenden ja doch in rhythmischen Abständen neu geschrieben werden und neu durchdacht werden und neu gestaltet werden, wichtig.
"Große Kluft zwischen Literatur und Kirche"
Main: Aber diese Kombination, Sie verstehen sich offensichtlich als Dichter und Theologe, diese Kombination haben wir nicht so oft?
Lehnert: Ja, ich wüsste jetzt gar keinen anderen, genau. Aber es ist natürlich auch eine prekäre Situation, weil sie von wechselseitigen Missverständnissen geprägt ist. Also, gerade in der Vergangenheit gab es das ja oft. Bis ins 19. Jahrhundert, bis Mörike oder so, ist es ja eine ganz klassische Kombination gewesen, dass man Theologe ist und Dichter. Es war ja überhaupt nichts Ungewöhnliches. Für unsere heutige Zeit ist es extrem ungewöhnlich. Seit die Literatur gewissermaßen komplett aus den Kirchen ausgewandert ist und sich so seit der Nachkriegszeit eine große Kluft zwischen Literatur und Kirche und Theologie geöffnet hat.
"Ich bin nicht kirchlich sozialisiert"
Main: Das vertiefen wir später nach dieser Ouvertüre. Gehen wir mal einen Schritt zurück, gut 30 Jahre zurück: Sie haben damals den Wehrdienst in der DDR verweigert, wurden Bausoldat. Wie sehr haben Sie sich damals als Oppositioneller empfunden, in der Endphase der DDR, kurz vor der friedlichen Revolution?
Lehnert: 1986 fiel die Entscheidung. Da war ich 17 Jahre alt. Da ist das Wort Oppositioneller zu groß. Es war eine Lebensentscheidung, die ganz sachlich begründet war. Ich bin zunehmend damals als 16-Jähriger in kirchlichen Kreisen in Kontakt gekommen, war viel in Jungen Gemeinden und war da zuhause – mehr und mehr geworden. Ich bin ja nicht kirchlich sozialisiert.
Es ergab sich dann die ganz reale Sachfrage, also die Existenzfrage: Kann ich in einer Armee dienen, die mit einem Bein im Krieg steht? Es war Solidarność in Polen. Alle redeten davon, dass möglicherweise Warschauer-Pakt-Truppen in Polen einmarschieren. Es war in Russland eine brüchige Situation entstanden. Es gab ja die innerdeutsche Grenze mit einem Schießbefehl.
Es war einfach die Entscheidung: Kann ich auf einen Menschen schießen? Das habe ich für mich verneint. Ich war ja dann Bausoldat. Das war ja gewissermaßen schon ein kleiner Kompromiss, den man mit dem System machte. Ich hätte ja auch total verweigern können und ins Gefängnis gehen, wenn ich denn eingezogen worden wäre. Die Bausoldaten, das war ja so eine Zwischenposition. Man arbeitete in der NVA, schwere körperliche Arbeit, und wir waren nicht vereidigt, hatten aber Uniformen an, waren kaserniert, Schulterstücke mit so einem kleinen Spaten drauf.
Main: Wie so viele Bausoldaten haben Sie dann evangelische Theologie studiert. Haben Sie diese Entscheidung letzten Endes der evangelischen Kirche zu verdanken, weil Sie in Berührung gekommen sind mit den jungen Gemeinden?
Lehnert: Die evangelische Kirche gab es damals für mich als Größe eigentlich gar nicht. Es gab für mich die kleine Gemeinde - da gegenüber im Stadtteil von Dresden Pieschen, wo ich irgendwann als 15-Jähriger abends beim Pfarrer klingelte und sagte, ich möchte gerne konfirmiert werden, ohne dass ich genau wusste, was das eigentlich bedeutet, noch, was ich eigentlich will. Nur eine gewisse Neugier.
Ich bin dann in eine für mich ganz skurrile, fremdartige Welt geraten, wo alle Wörter etwas anderes bedeutet haben, wo alles einen anderen Klang hatte, wo ich ganz neu anfangen musste zu denken. Das war für mich so eine Erweckung. Damit war ich beschäftigt. Also, die evangelische Kirche kam viel, viel später. Dass ich dann evangelische Theologie studiert habe, war auch eher der Not geschuldet. Mein Traum war eigentlich immer, Medizin zu studieren.
Main: So wie Ihre Eltern.
Lehnert: Genau. Ich wollte Mikrobiologe werden. Ich hatte da zu Hause auch Mikroskope stehen und Petrischalen und habe Bakterien und so was gezüchtet. Da schlug mein Herz …
Main: Aber man ließ Sie wahrscheinlich nicht.
Lehnert: Das ging nicht. Das war in der DDR nicht möglich. Also, in dem Moment, wo ich den Wehrdienst verweigert hatte, war das vorbei, gab es genau noch zwei Möglichkeiten: Theologie zu studieren oder mit einer gewissen Unsicherheit Verfahrenstechnik. Das waren die einzigen beiden Wege.
"Die plötzlich lockende Weite nach allen Seiten"
Main: Sie haben noch in der DDR mit dem Theologiestudium begonnen. Später haben Sie dann auch in Jerusalem studiert. Dann haben Sie als freischaffender Künstler in Santiago de Compostela gelebt. War das der Sehnsucht des jungen Mannes geschuldet, der nicht damit gerechnet hatte, dass noch Reisefreiheit möglich sein würde? Oder ging es da um die spirituell-theologische Bedeutung dieser Orte?
Lehnert: Ja, beides. Auf der einen Seite war es natürlich die Öffnung der Grenze, die plötzlich lockende Weite nach allen Seiten. Damals im Vollzug waren das eher zufällige Entscheidungen. Im Nachhinein merkt man, dass es nicht zufällig war.
Sowohl Jerusalem als auch Santiago de Compostela waren für mich ganz, ganz wesentliche und wichtige Orte, die im Übrigen beide in einer spezifischen geografischen Situation sind, nämlich eigentlich in einer Art Wüste, in der Nähe der Wüste sind. Also, ich bin von Jerusalem ganz viel in die Wüste gefahren. Das war für mich die inspirierendste Landschaft, die ich mir denken konnte.

Main: Die Wüste Negev.
Lehnert: Negev. Dann bin ich auch viel in Sinai gefahren und nach Jordanien rüber. Und in Santiago de Compostela ist ja diese ganz karge Felslandschaft direkt am Atlantik. Kap Finisterre ist ein kahler Berg, der da in den Atlantik ragt. Auch das war für mich eine unglaublich inspirierende Landschaft.
"Die Antriebskraft meiner Lyrik ist das Staunen"
Main: Christian Lehnert, Dichter und evangelischer Theologe in Leipzig, in der Sendung "Tag für Tag – Aus Religion und Gesellschaft". Herr Lehnert, nicht alle Menschen lesen Lyrik. Nicht alle verstehen Gedichte. Und womöglich weigern Sie sich, Ihr eigenes Werk zu kommentieren, aber jetzt mal ganz grundsätzlich: Was treibt Ihre Lyrik an?
Lehnert: Also, ganz grundsätzlich gesagt: Die Antriebskraft meiner Lyrik ist das Staunen: das Staunen über Dinge, die ich vorfinde, die nicht sein müssten, aber sind, wie sie sind, und bei denen ich merke, dass meine Sprache, die ich gewöhnlich spreche, nicht ganz ausreichend, nicht ganz zureichend ist, sie zu verstehen, zu durchdringen und sie zu benennen, gewissermaßen sie wirklich werden zu lassen. Die Lyrik ist eigentlich eine Suche nach einer Sprache, die mir die Welt eröffnen kann, wie ich sie staunend wahrnehme.
Main: Ist sie so etwas wie eine Königsform?
Lehnert: Für die Literatur gewiss, weil sie an der unmittelbaren Grenze lebt, wo die Dinge, die ich wahrnehme, erst in die Sprache hineinkommen, also, an dieser Grenze, wo die Sprache ausfranst in das noch Ungesagte, wo die Sprache beginnt, sich zu bewegen, flüssig zu werden, vorwärts zu kriechen in unbekannte Räume. Das ist der Ort, wo Gedichte zu Hause sind.
Im Übrigen haben Sie am Anfang in Ihrer Frage eine für meine Begriffe steile These aufgestellt, dass nicht alle Menschen Lyrik verstehen. Ich bin da sehr unsicher, ob das stimmt. Grundsätzlich, glaube ich, verstehen alle Menschen Lyrik, weil alle Menschen auch Grunderfahrungen kennen, dass die eigene Sprache nicht ausreicht, um etwas auszudrücken. Spätestens, wenn man als Jugendlicher einem jungen Mädchen seine Liebe gesteht, dann merkt man das. Und in dieser Situation ist man permanent und fortwährend.
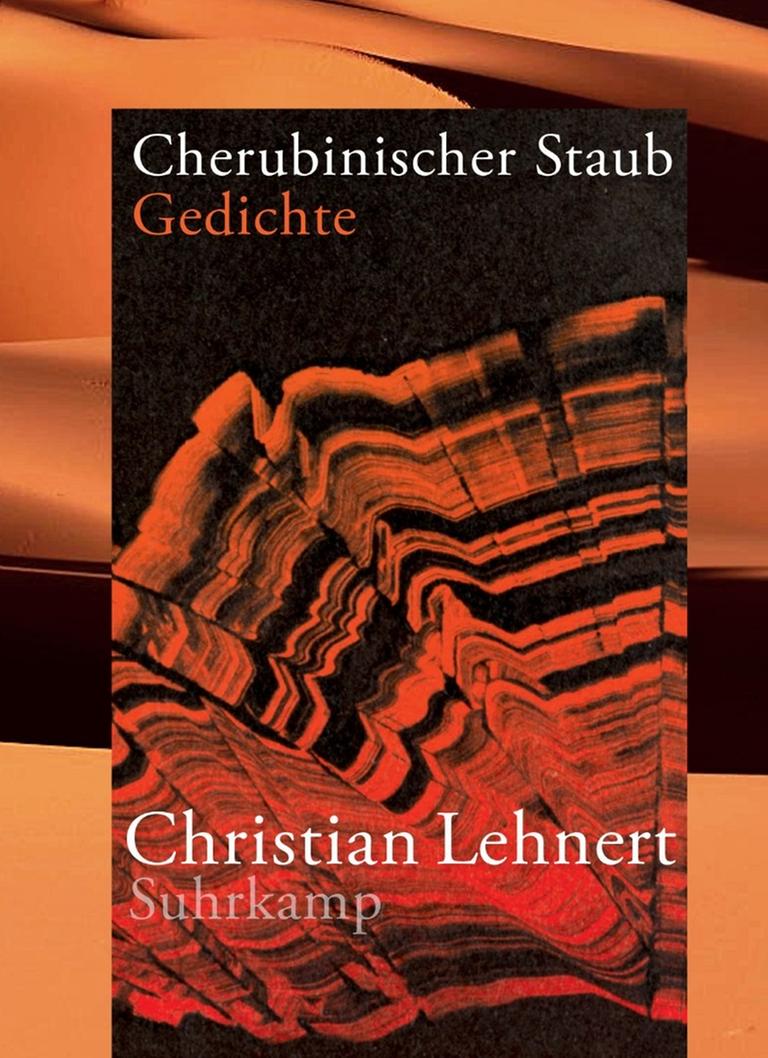
Nur sind meistens unsere Rezeptionsbedingungen und die Art, wie wir Gedichte lesen, durch Schule, Literaturunterricht so überformt worden, dass wir mit der Meinung an Gedichte herangehen, sie wären erstens hochintellektuell, zweitens per se immer dunkel und drittens, man müsste viel wissen und viel verstanden haben, um diese komplizierten Texte zu entschlüsseln, statt dass man sie erst mal einfach hört, wie ein Klang, wie Musik, von dem ich noch nicht ganz weiß, wo sie mich hinführen.
"Wer bist du und wie antwortest du?"
Main: Dann lege ich mal noch eine steile These nach: Ihre Gedichte sind fromm.
Lehnert: Fromm – was ist fromm? Ja, das ist eine interessante Sache. Fromm heißt ja zunächst erst einmal, also vom Wortsinn her: gehorsam, brav. Das sind meine Gedichte erst mal nicht. Wenn Sie mit dem Begriff fromm stärker das Religiöse meinen und dann vielleicht sogar dieses praktiziert Religiöse, dann ja. Aber da muss man auch schon wieder fragen: Worin besteht eigentlich das Fromme dann? Und worin besteht das Religiöse?
Ich glaube, das Religiöse besteht in meinen Texten nicht darin, dass ich irgendwelche vorgefassten, dogmatischen oder ideologischen oder weltanschaulichen Aussagen gewissermaßen in Verse bringe, denn das läuft dem Wesen des Gedichtes, wie ich es eben auch beschrieben habe, komplett zuwider. Wie auch politische Lyrik gewissermaßen dem Wesen von Lyrik eigentlich, der Energie zuwiderläuft. Sondern religiös in dem Sinne vielleicht, dass ich erwarte, dass in den Dingen, die mir begegnen, etwas spricht, dass da bereits eine Sprache drin ist, die mich anspricht, dass da eine Frage an mich ist, auf die ich antworten muss, dass die Wirklichkeit mich meint und danach fragt: Wer bist du hier an deinem Ort, in dieser Welt? Wer bist du und wie antwortest du? Wie reagierst du auf diese Ansprache?
"Die etablierten Sprachformen verlassen"
Main: "Ich bin, der ich bin", "Die Auferstehung des Eisvogels", "Dorfkirche" – das sind drei x-beliebige Titel aus Ihrem jüngsten Gedichtband "Cherubinischer Staub". Es ist ja schon ein interessantes Phänomen: Ein Dresdner Protestant gibt in einem weitgehend säkularen Literaturbetrieb Religionsthemen Raum. Wollen Sie in der Lyrik eine neue Sprache des Religiösen etablieren und umgekehrt in der Welt der Kirchen eine neue Sprache befördern? Oder ist das zu platt formuliert?
Lehnert: Also, was heißt neue Sprache? Also, in der Lyrik eine neue religiöse Sprache zu etablieren, ist kein Programm von mir. Halte ich auch nicht für ein sinnvolles Programm. Es geschieht ganz naturgemäß allerdings, weil ich in dem Moment, wo ich mich im Gedicht religiösen Themen nähere, zwangsläufig die vorgefundenen etablierten Sprachformen verlassen muss, wenn ich denn poetische Energie und einen poetischen Funken zünden will. Sonst bewege ich mich ja in einer rein gewohnheitsmäßigen traditionellen Sprache.
Im Übrigen ist der Zug zur neuen Sprache der Religion ja immanent, weil nämlich auch der Betende oder der Liturgiefeiernde nicht hat, wovon er spricht, sondern sich gewissermaßen betend in das Geheimnis des unsagbaren Gottes hineinspricht. Das heißt, alles, was er sagt, sind Bilder, Geschichten, eigene Erzählungen, Gedankengänge, die hineinragen in eine Offenheit.
"Die Unbehaustheit in den eigenen Worten"
Main: Wenn wir noch mal anknüpfen an das, was Sie am Anfang gesagt haben, dass Sie Dichter und Theologe sind, da interessiert mich, inwieweit sich das gegenseitig befruchtet – von der Wirkung her. Was könnte also Predigt, was könnte Liturgie, Gottesdienst, Verkündigung lernen von Lyrikern?
Lehnert: Also, was Liturgie, Gebetssprache, Predigt von Lyrikern lernen kann, ist zuallererst die Verunsicherung, die Unbehaustheit in den eigenen Worten. Der Punkt, wo die Verstörung so tiefgreift, dass mir die Worte fehlen. An diesem Punkt entsteht die zündende Predigt. Es gibt den schönen Aphorismus von Franz Kafka: "Es gibt den Punkt, von dem aus es kein Zurück mehr gibt. Dieser Punkt ist zu erreichen." Das gilt gewissermaßen in der Predigt. Und das ist in der Predigt sehr einfach zu finden, wenn man sich nämlich auf die höchstverstörenden biblischen Texte einlässt. Und da kommt man unweigerlich immer wieder an solche Punkte, wo die eigene Sprache versagt. Also, ich glaube, das lernt der Theologe vom Dichter.
Main: Und umgekehrt, was könnte der Dichter lernen vom religiösen Erfahrungsschatz der Jahrhunderte?
Lehnert: Ja, ein unglaublich kreatives Bild-Reservoir, eine unglaublich reiche Literaturgeschichte. Das ist einfach ein Schatz, wovon man als Lyriker nur lernen kann, ja.
"Der Gottesdienst ist die entscheidende Kraft"
Main: Christian Lehnert im Deutschlandfunk. Nun haben wir eben mehr den Lyriker Lehnert betont. Lassen Sie uns nun zum Liturgiewissenschaftler und Theologen und Essayisten kommen. Auch, wenn Sie das ja nicht trennen können, Sie haben es betont. Ganz direkt an den Liturgiewissenschaftler gefragt: Kommt die Erneuerung des Christentums aus der Liturgie, aus dem Gottesdienst?
Lehnert: Ja, das ist ein großer Gedanke. Sicher nicht ausschließlich, aber der Gottesdienst ist ein wesentliches Element, weil der Gottesdienst die zentrale Lebensform der Begegnung zwischen Gott und Mensch ist. Gerade in einer Zeit, wo Institutionen brüchig werden und Institutionen per se ihre unmittelbare Überzeugungskraft verlieren, gerade in dieser Situation haben es Kirchen schwer. Und da ist der Gottesdienst, das unmittelbare Feiern und Erleben einer jenseitigen Wirklichkeit die entscheidende Kraft.
Main: Nun gibt es Überlegungen in Ihrer Kirche, in der EKD, den Sonntagsgottesdienst dort, wo er nicht mehr funktioniert, zugunsten anderer Formen von Seelsorge ausfallen zu lassen oder zumindest diese Option zu ermöglichen. Ist das eine gute Idee?
Lehnert: Das halte ich für keine gute Idee, weil man damit eine ganz wichtige kulturelle Verankerung des Christentums verlässt und damit gewissermaßen den Anspruch des Christentums verlässt, erstens Zeit zu strukturieren. Also, Zeit ist ja nicht etwas, was einfach so da ist, sondern Zeit wird strukturiert. Und die Arbeitswelt strukturiert Zeit natürlich völlig anders als eine Religion, die sagt, es gibt gewissermaßen unter der linear verlaufenden tickenden Zeit der Uhren und der Arbeit und der Arbeitsvollzüge eine andere Zeit, in der Sinn und Geheimnisse verborgen sind. Das verlässt man. Man verlässt einen großen kulturellen Hallraum, der mit dem Sonntagsgottesdienst gegeben ist und man verlässt, glaube ich, ein wesentliches Organum der eigenen Existenz.
"Den Sonntagsgottesdienst nicht nach Quantitäten beurteilen"
Main: Was empfehlen Sie jungen Frauen und Männern, die bei Ihnen studieren? Worauf sollten die sich mit Blick auf Liturgie, Gebet, Gottesdienst besinnen, damit es demnächst mehr sind als sieben Gottesdienstbesucher?
Lehnert: Ich empfehle ihnen zunächst erst einmal, mit dem Zählen aufzuhören und den Gottesdienst nicht nach Quantitäten zu beurteilen und nicht nach diesem gängigen und überall und in jedem Daseinsvollzug prägenden ökonomischen Blick der Abwägung von Aufwand und Nutzen, von Zahlen, und ob es sich rechnet.

Ich empfehle ihnen möglichst in großer Aufrichtigkeit und ehrlich gegenüber sich selbst ihre Spiritualität zu leben und die gewissermaßen vorbildhaft im Gottesdienst zu zeigen und zu inszenieren und zu feiern. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Kraft, dieses primäre Erleben von Spiritualität.
"Sachsen können über sich lächeln"
Main: Christian Lehnert, Dichter, Liturgiewissenschaftler, Theologe, im Deutschlandfunk. Sie sind in Dresden geboren. Sie leben und arbeiten in Sachsen. Sie haben auch eine große Nähe zum Land, zum Erzgebirge südlich von Dresden. Sie leben also in beiden Welten, schauen dem Volk auf dem Land und den Intellektuellen in der Stadt aufs Maul. Welche gesellschaftlichen Tendenzen in Sachsen machen Ihnen Freude?
Lehnert: Das ist ja eine interessante Frage. Meistens fragt man ja anders herum. Was mir in Sachsen Freude macht, ist die Ehrlichkeit, mit der Leute zu sich selbst, auch zu ihren Beschränkungen, auch zu ihren kulturellen Beschränkungen gelegentlich stehen, wie sie dieses ganz unideologische Leben mit einer eigenen kulturellen Identität, die manchmal auch ein bisschen merkwürdig ist und … und darüber auch lächeln können – ja.
"Segmentierung von Öffentlichkeit besorgt mich"
Main: So, jetzt kommt natürlich die zweite Frage: Was besorgt Sie?
Lehnert: Ja, was mich besorgt, ist eine zunehmende Polarisierung, die mit Misstrauen einhergeht und die mit gegenseitigem Unverständnis einhergeht und vor allen Dingen besorgt mich dabei die Segmentierung von Öffentlichkeit.
Main: Da wird ja nicht mehr gelächelt.
Lehnert: Da wird nicht mehr gelächelt, nein. Segmentierung von der Öffentlichkeit, dass sich konträre Personen in ihren politischen Ansichten eigentlich kaum mehr begegnen, sondern sich einigeln in eigenen Informationszusammenhängen und nur noch in Bestätigungsschleifen sind.
Main: Und das ist ein Phänomen, das definitiv nicht nur in Sachsen passiert.
Lehnert: Das ist nicht nur in Sachsen so.
"Ein verwundeter Sozialkörper mit Entzündungsreaktionen "
Main: Aber wieso ist die Polarisierung hier vielleicht noch auffälliger?
Lehnert: Ja, die Polarisierung ist deshalb auffälliger, weil die Verstörung und die Verwundung der Gesellschaft durch die Jahrzehnte der Diktatur im Grunde genommen noch da sind. Es ist ein verwundeter Sozialkörper, in dem mühsam Heilungsprozesse wirkten, aber nach der Wende dann auch Prozesse kamen, die die Wunden eher vertieft und verstärkt haben. Das Gefühl, abgehängt zu sein, ist ja nicht einfach nur ein Gefühl, sondern eine Realität. Also, das ist ein verwundeter Körper. Und dadurch sind die Entzündungsreaktionen auch schärfer und die Emotionen und die sozialen Kräfte sind stärker an dieser Stelle, zeigen sich radikaler, zeigen sich unversöhnlicher.
"Große Sehnsucht nach Beständigkeit"
Main: Und dieser verwundete Körper drückt seinen Schmerz hier in Sachsen viel stärker aus, weil der Sachse – jetzt mal platt gesagt – mehr spricht als ein Norddeutscher.
Lehnert: Das ja. Und auf der anderen Seite ist eine ganz große Sehnsucht nach Beständigkeit, nach Beheimatung, nach Ruhe, nach Stabilität und Verlässlichkeit da. Und die gesellschaftliche Dynamik ist genau konträr, ist genau eine andere, führt in permanent neue Verunsicherung, eine neue Infragestellung. Also, ein Ostdeutscher meines Alters, der jetzt so um die 50 ist, hat massive Brüche erlebt in seinem Leben. Und da bin ich ja relativ begnadet und leicht durchgekommen. Ich habe zwar den harten Bruch des Zusammenbruchs der Diktatur erlebt und die schweren Monate als Bausoldat, aber ich habe nach der Wende relativ schnell Fuß gefasst.

Bei der Mehrzahl der Ostdeutschen passieren ja die wesentlichen Brüche nach der Wende – mit Arbeitslosigkeiten, mit dem Gefühl, nicht anzukommen. Das verlangt ja eine unheimlich große Flexibilisierung, Neudefinition von Lebensentwürfen. Und jetzt ist man angekommen - und jetzt ist wieder alles neu. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum sich das so stark in Sachsen zeigt.
"Der Boden unter den Füßen ist brüchig geworden"
Main: Was ist denn jetzt wieder neu?
Lehnert: Die ganze Wirtschaft stellt sich um, die Gesellschaft stellt sich um. Wir leben plötzlich in globalisierten Zusammenhängen, wo Kulturen sich auflösen und in ganz neue Mischungen gehen. Der Boden unter den Füßen ist brüchig geworden. Und damit können flexible Großstädter aus dem Westen leichter umgehen als die Leute, die ich jetzt in meinem Dorf vor Augen habe, im Erzgebirge, die einfach ein starkes Ruhebedürfnis haben.
Main: Können Sie denn mit denen reden?
Lehnert: Ja – ja, ungebrochen.
Main: Könnte ich mit denen reden?
Lehnert: Ja – ja, ungebrochen, warum nicht? Ja, da sind ja auch so viele Feindbilder im Raum. Der entscheidende Punkt ist ja nicht die Herkunft, sondern die Fähigkeit, wirklich das Gespräch zu suchen und zuzuhören. Ein Teil der Verwundung ist ja – das sage ich jetzt wieder als einer, der mit Sprache viel zu tun hat – ein Teil der Verwundung ist ja ein Sprachverlust, ja, also, dass gewissermaßen die eigene Erzählung, die eigene Lebenserzählung in den großen Erzählungen der Gesellschaft und der Medien über Jahrzehnte nicht vorkam oder ganz anders erzählt wurde, aber das Sprachvermögen dafür nicht da ist. Also, in dem Moment, wo Sie dort hinkommen, so wie Sie jetzt zu mir und man sich offen unterhält und zuhört, sehe ich da kein Problem.
Main: Christian Lehnert war das, Theologe und Dichter. Zwei seiner jüngsten Bücher nochmal genau erwähnt. Christian Lehnert "Der Gott in einer Nuß", 237 Seiten und "Cherubinischer Staub" 112 Seiten, beide erschienen im Suhrkamp-Verlag, beide kosten 20 Euro. Danke Ihnen, Christian Lehnert, für Ihre Zeit und für Ihre Eindrücke.
Lehnert: Danke schön.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.
Christian Lehnert: "Cherubinischer Staub - Gedichte"
Suhrkamp 112 Seiten, 20 Euro
Suhrkamp 112 Seiten, 20 Euro
Christian Lehnert: "Der Gott in einer Nuß - Fliegende Blätter von Kult und Gebet"
Suhrkamp, 237 Seiten, 20 Euro
Suhrkamp, 237 Seiten, 20 Euro








