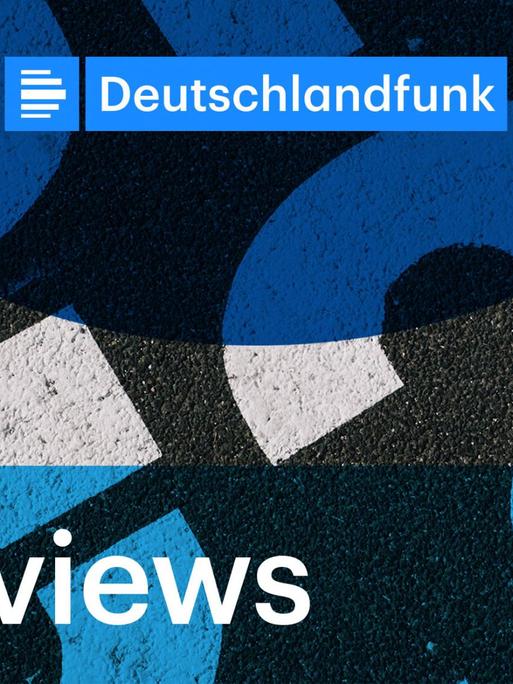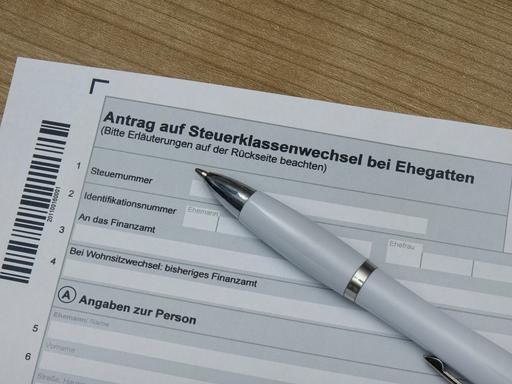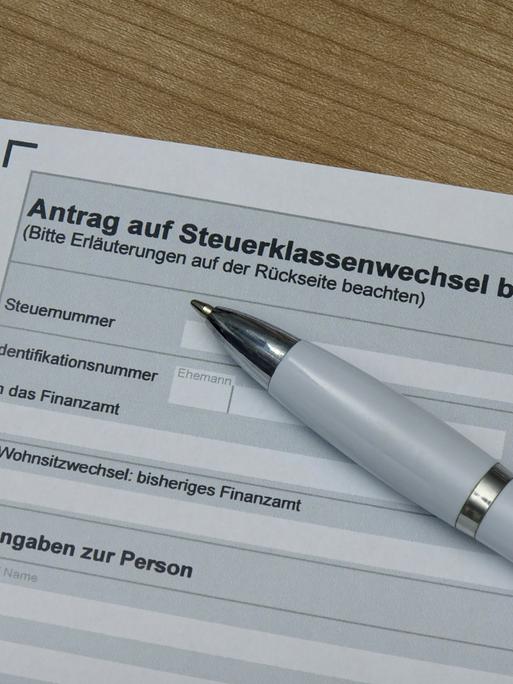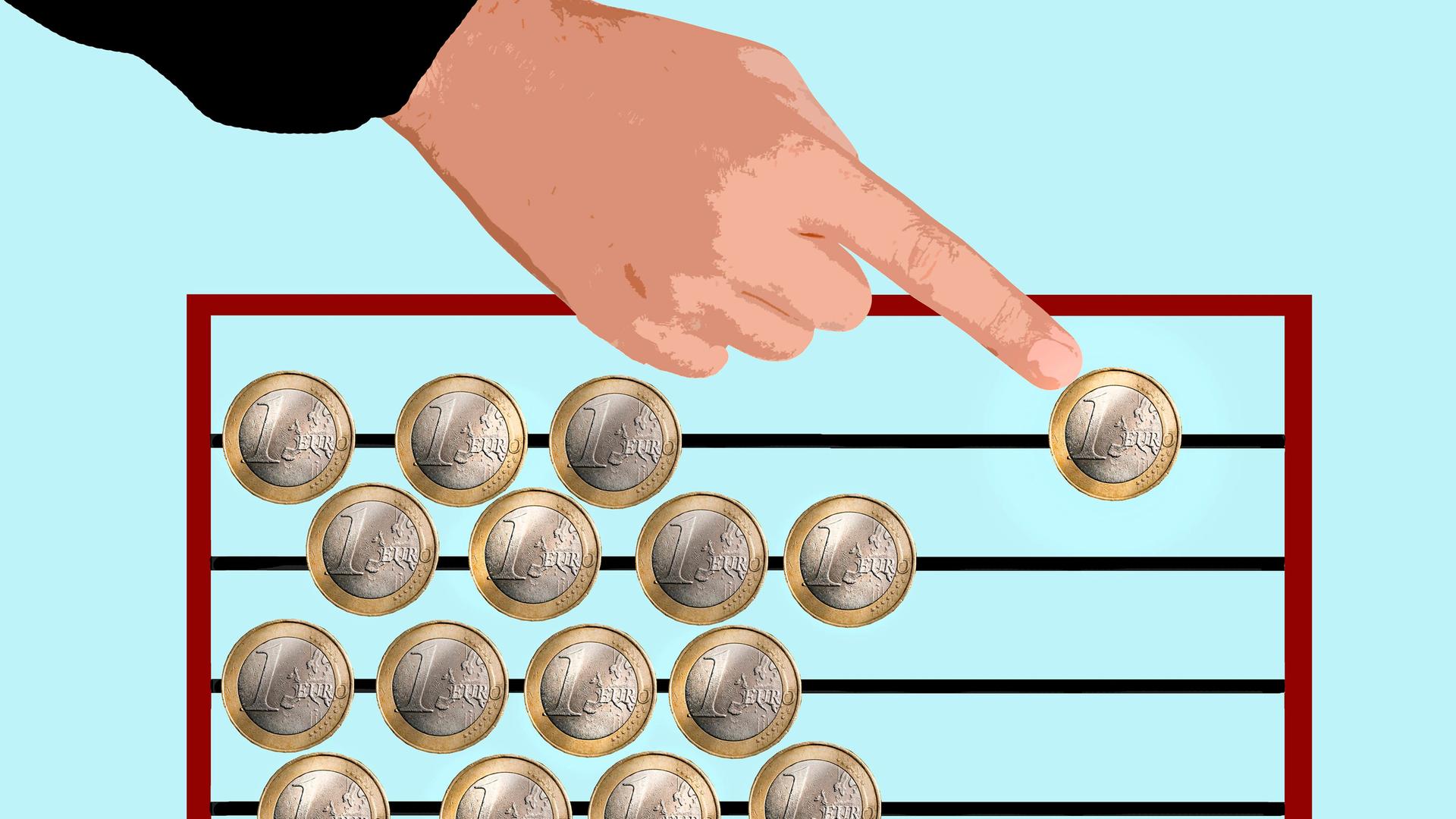Minijobs sollten ursprünglich als Sprungbrett in die reguläre Beschäftigung dienen. Doch in manchen Branchen wie dem Handel und der Gastronomie sind sie zur Dauerlösung geworden. Insgesamt gibt es zwischen sechs und acht Millionen Minijobberinnen und Minijobber in Deutschland, die Zahlen variieren. So oder so: Das Arbeitsmodell ist beliebt – aber seit Jahren umstritten.
Laut der Bundesagentur für Arbeit ist gut die Hälfte der Minijobberinnen und Minijobber ausschließlich geringfügig beschäftigt. Sie haben also nicht genug Einkommen, um eigenständig ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und sich eine Altersvorsorge aufzubauen. Dazu kommt: Minijobs verdrängen sozialversicherungspflichtige Jobs.
Im Arbeitnehmerflügel der Union regte sich zuletzt Widerstand gegen das Modell: Stefan Nacke, Chef der sogenannten Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, forderte im November 2025 ein weitgehendes Ende für Minijobs. Sie gehörten, so Nacke, auf ihren ursprünglichen Zweck zurückgeführt: als Übergangsform für Schüler oder Rentner, nicht als Ersatzstruktur für reguläre Beschäftigung.
Der Vorstoß des CDU-Politikers stieß auf ein geteiltes Echo: Die Gewerkschaft Verdi äußerte Zuspruch. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hingegen lehnt eine Abschaffung der Minijobs ab.
Was ist ein Minijob?
Es gibt zwei Arten von Minijobs. Einerseits den Minijob mit Verdienstgrenze: Dabei dürfen Beschäftigte seit dem 1. Januar 2025 maximal 556 Euro pro Monat verdienen. Früher waren es einmal 450 Euro. Daher kommt die Bezeichnung „450-Euro-Job“. Eine Stundenbegrenzung gibt es für diese Art von Minijob nicht. Wegen des gesetzlichen Mindestlohns von 12,82 Euro pro Stunde ist aber klar, dass Beschäftigte maximal gut 40 Stunden pro Monat arbeiten können.
Daneben gibt es die sogenannte kurzfristige Beschäftigung. Bei dieser Art von Minijob gilt es keine Verdienstgrenze, aber eine zeitliche Frist. Maximal dürfen Beschäftigte drei Monate oder 70 Tage pro Jahr arbeiten. Solche Minijobs haben oft Erntehelfer.
Wer macht Minijobs?
Laut dem Quartalsbericht der Minijob-Zentrale für das zweite Quartal 2025 sind rund 18 Prozent der Minijobber im Gewerbe über 65 Jahre alt. Viele Menschen nutzen also offenbar das Einkommen aus einem Minijob, um ihre Rente aufzustocken. Rund 19 Prozent der geringfügig Beschäftigten sind jünger als 25. In diese Gruppe fallen also auch Studierende sowie Schülerinnen und Schüler, die sich Geld dazuverdienen.
Minijobs sind darüber hinaus beliebt bei Erwerbstätigen, die insgesamt nur wenige Stunden arbeiten können oder wollen, zum Beispiel, weil sie Kinder großziehen oder Angehörige pflegen. Andere machen einen Minijob neben ihrem Hauptjob, um ihr Einkommen aufzubessern. Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen, dass zuletzt knapp die Hälfte der Minijobber den Minijob als Nebenjob ausübte.
Der Großteil aller Minijobber ist im gewerblichen Bereich tätig. Vor allem in Branchen wie dem Handel, dem Gastgewerbe oder auch dem Reinigungsgewerbe. Ein kleinerer Teil der Minijobber ist privat beschäftigt, etwa als Haushaltshilfe. Das betrifft vor allem Frauen.
Welche Vorteile haben Minijobs?
Für Arbeitnehmer sind Minijobs attraktiv, weil sie auf ihr Einkommen in der Regel keine Steuern und kaum Abgaben bezahlen. Steuern und Abgaben zahlt nur der Arbeitgeber. Minijobber können in die Rentenkasse einzahlen, müssen es aber nicht. Lassen sie sich von den Rentenbeiträgen befreien, entspricht ihr Nettoeinkommen ihrem Bruttoeinkommen. Und Zahlen der Minijob-Zentrale zeigen: Rund 80 Prozent der Arbeitnehmer lassen sich von den Beiträgen befreien.
Minijobs können darüber hinaus berufliche Abwechslung bieten – zum Beispiel, wenn Beschäftigte einen Teilzeitjob haben und im Minijob nebenberuflich eine neue Branche kennenlernen. Und: Minijobs sind auch vergleichsweise leicht zu finden, da sie für Arbeitgeber mit wenig bürokratischem Aufwand verbunden sind.
Das ist auch ein Vorteil aus Arbeitgebersicht. Bei einem Minijob bezahlen Arbeitgeber alle notwendigen Steuern und Abgaben direkt an die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung. Sie müssen neue Arbeitnehmer also nicht wie bei einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei deren Krankenkasse anmelden.
Die Steuern und Abgaben für Arbeitgeber sind bei Minijobs zwar höher als bei regulärer Beschäftigung. Sie betragen rund 30 Prozent im Vergleich zu normalerweise rund 20 Prozent. Dafür bieten Minijobs Unternehmen aber eine flexible Möglichkeit, um genug Personal für Stoßzeiten zu haben oder andere Lücken im Dienstplan aufzufüllen.
Was sind die Nachteile von Minijobs?
Die Forschung zeigt im Wesentlichen zwei Nachteile: Erstens verdrängen Minijobs in kleinen Unternehmen bis zu 500.000 sozialversicherungspflichtige Stellen. Das hat das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) 2021 in einer Studie festgestellt. Demnach stellen kleine Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitenden teilweise lieber mehrere Minijobber ein als eine Vollzeitkraft. „Minijobs sind demnach – zumindest in kleinen Betrieben – keine Ergänzung zur sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung“, sagt IAB-Forscher Matthias Collischon.
Darüber hinaus zeigt seine Studie, dass Minijobs vor allem für Frauen oft zur beruflichen Falle werden. Das hat unter anderem steuerliche Gründe: Viele Ehepaare nutzen das sogenannte Ehegatten-Splitting bei der Steuererklärung. Dabei gilt: Die Partner, die weniger verdienen – meist sind das die Frauen –, können durch einen Minijob aktuell 556 Euro pro Monat dazuverdienen, ohne dafür Steuern bezahlen zu müssen.
Verdienen sie mehr, gelte ab dem ersten Euro über der Minijob-Verdienstgrenze der Grenzsteuersatz ihres Partners, sagt Collischon. Ihre Steuerlast sei dadurch so hoch, dass sich eine Erhöhung ihrer Arbeitszeit kaum lohne. Viele Frauen, die nach einer Babypause mit einem Minijob wiedereinsteigen, bleiben daher über Jahre geringfügig beschäftigt, zeigt seine Forschung.
Das Problem daran: Frauen, die über Jahre geringfügig beschäftigt sind, können sich beruflich in der Regel nicht weiterentwickeln. Sie verdienen zu wenig, um selbstständig ihren Lebensunterhalt finanzieren zu können. Und sie erwerben kaum oder nur wenig Rentenansprüche. Das kann für den Staat perspektivisch teuer werden. Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, mit der der Staat Altersarmut abfedern will, mit Abstand der größte Posten unter den staatlichen Sozialhilfeleistungen ist.
Welche Reformen wären denkbar?
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert vor allem steuerliche Reformen. Konkret: die Abschaffung des Ehegatten-Splittings oder zumindest eine Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 für Paare. Bei Nutzung der Steuerklassen 3 und 5 zahlt die besserverdienende Person in Steuerklasse 3 kaum Steuern, während die weniger verdienende Person in Steuerklasse 5 fast die gesamte Steuerlast trägt.
Derartige Reformen würden es für Minijobberinnen und Minijobber attraktiver machen, ihre Arbeitszeit aufzustocken, sagt Anja Weusthoff, die Abteilungsleiterin Frauen, Gleichstellungs- und Familienpolitik im DGB-Bundesvorstand. Sie würden also mehr verdienen – die wichtigste Voraussetzung für eine auskömmliche Rente. Der Handelsverband Deutschland, der als Arbeitgeberverband die Branche vertritt, in der die meisten Minijobberinnen und Minijobber beschäftigt sind, hält eine Reform der Steuerklassen ebenfalls für sinnvoll.
Die Bundesregierung verfolgt allerdings keine entsprechenden Pläne. Die frühere Ampel-Regierung hatte die Abschaffung der Steuerklassen geplant. Durch den Bruch der Ampel kam es aber nicht mehr zur Umsetzung.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert darüber hinaus, Minijobs sozialversicherungspflichtig zu machen. So, dass jeder Euro, den Beschäftigte verdienen, genutzt wird, um diese zu gut abzusichern und vor Altersarmut zu schützen. Diese Forderungen stand auch – mit Unterschieden im Detail – in den Wahlprogrammen der Linkspartei, der Grünen und des BSW bei der Bundestagswahl 2025.
Denkbar sei, bei Minijobs zunächst nur sehr geringe Sozialabgaben zu erheben, die dann mit zunehmendem Einkommen langsam ansteigen, sagt Anja Weusthoff vom DGB. Der Handelsverband Deutschland (HDE) lehnt eine Sozialversicherungspflicht dagegen ab. Minijobs würden dadurch für Arbeitnehmer finanziell unattraktiver, sagt Steven Haarke, der Geschäftsführer Arbeit, Bildung, Sozial- und Tarifpolitik beim HDE. Das könne den Arbeitskräftemangel im Handel verstärken.
irs