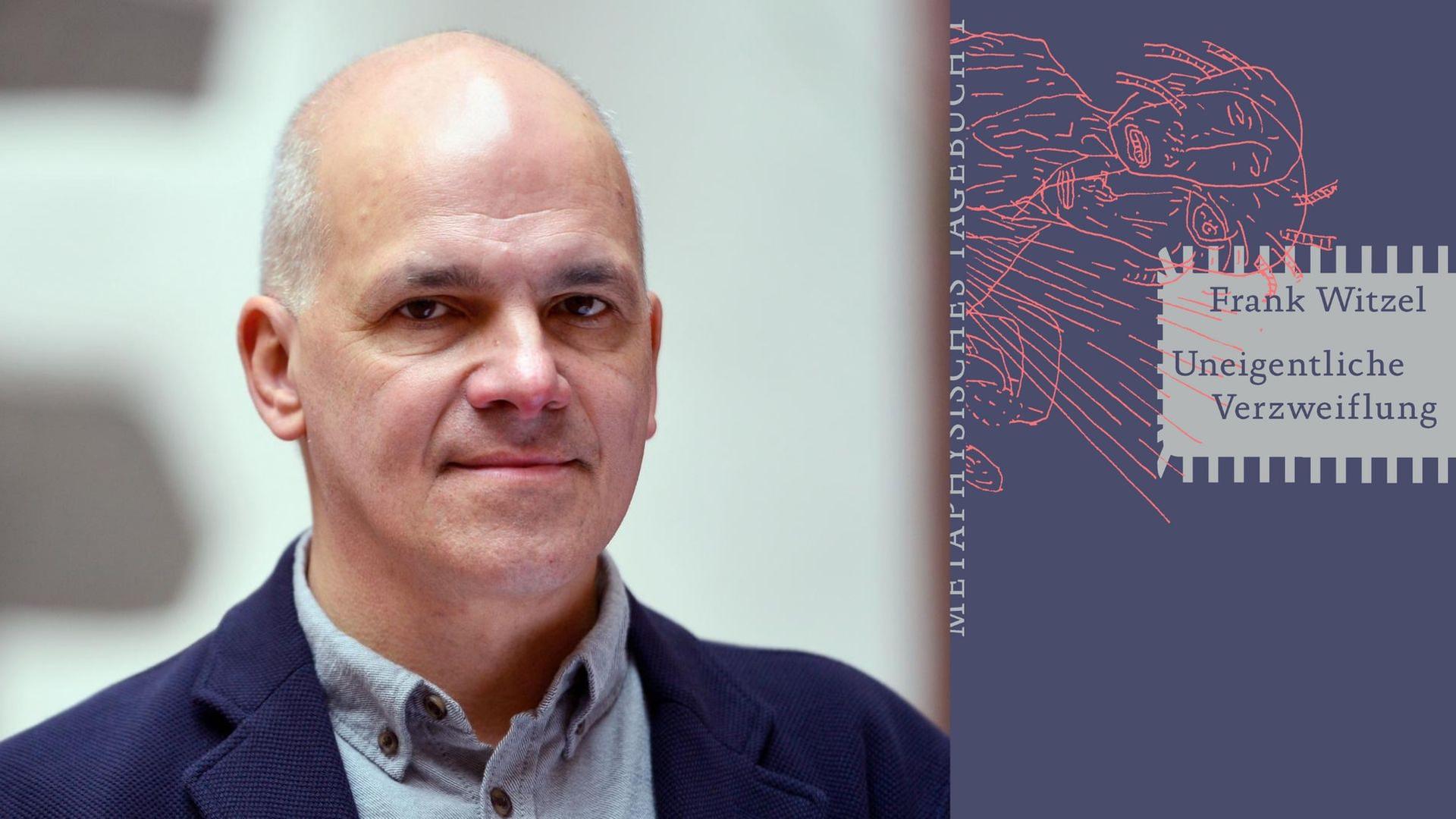Die Ethik der Geheimniskrämerei, um die es in Norbert Gstreins neuem Roman geht, hat vor mehr als 200 Jahren die Dichterin Sophie Tieck-Bernhardi präzise erfasst. 1810 schreibt sie in einem Aufsatz mit dem Titel "Lebensansicht" über die Unmöglichkeit, einander zu verstehen:
"Das, was unsere Scheidung von allen andern Wesen ausmacht, wodurch wir auch von dem geliebtesten Freunde abgesondert und einzeln stehen, suchen wir sorgfältig zu verhüllen, damit er sich nicht vor dem fremden Wesen entsetzen möge – und wäre es einem Menschen möglich, die innerste Eigenthümlichkeit seines geliebtesten Freundes aufzufassen und auszusprechen, so würde den Freund ein Schauder wie vor einem Zauberer ergreifen, der die Gewalt hätte, den Geist aus unsern Körpern zu ziehen und ihn uns selbst anschaulich hinzustellen, und wir würden auf immer entfremdet von ihm zurücktreten."
"Als ich jung war" heißt das neue Buch des Österreichers Gstrein, und es nimmt sich wie eine Roman-Umsetzung von Tieck-Bernhardis Überlegungen aus. Die knapp 350 Seiten handeln von Verhüllungen und Auslassungen, davon, wie Menschen Nähe vermeiden, indem sie Wörter wie Barrieren zwischen sich und ihr Gegenüber platzieren. Im Zentrum des Geschehens steht ein Ich-Erzähler namens Franz, der sich unterschiedlicher Lebensetappen entsinnt. Als Heranwachsender hilft er jahrelang im Restaurant der Eltern aus. Bei den zahlreichen Hochzeitsfeiern vor Ort fotografiert er ein ums andere Mal die zwangsglücklichen Brautpaare:
"Das Minimalziel verfehlte ich fast nie, sie wollten alle auf den Fotos besser dastehen als in Wirklichkeit, aber dazu brauchte es nicht viel, dazu brauchte ich nur die billigsten Tricks anzuwenden, oder ich fotografierte einfach an ihren Unvollkommenheiten und Menschlichkeiten vorbei."
Mit Anfang 20 verschlägt es ihn nach Jackson, Wyoming, in ein Kaff, in dem er als Skilehrer arbeitet. Dort akquiriert er einen kauzigen Professor als Stammkunden, der als Raketenphysiker in Seattle arbeitet und Winter um Winter Unterricht bei ihm nimmt. Schließlich kehrt er mit 37 Jahren nach Österreich zurück, um erneut im Restaurant zu landen, das nun von seinem Bruder Viktor geführt wird.
Ein Zentrum der Scham
So jedenfalls lautet der Lebensweg, wie ihn Franz in groben Zügen aufschreibt. Aber ist dieser Stimme Glauben zu schenken? In Franz’ Umfeld häufen sich mysteriöse Ereignisse: Auf der letzten Hochzeit, die er als junger Erwachsener fotografiert, stirbt die Braut, als sie einen Steilhang hinunterstürzt. Ob es ein Unfall oder doch Mord war, beschäftigt in der Folge Franz’ Familie ebenso wie einen Kommissar aus Wien. Bei einer früheren Hochzeit gibt es einen Vorfall mit einer jungen Geigerin namens Sarah. Die genauen Umstände eines gemeinsamen Spaziergangs belässt Franz wohlweislich im Dunkeln. In Jackson verschwindet wiederum ein junges Mädchen namens Eileen, wenige Tage nachdem sie mit Franz unterwegs war. Ganz zu schweigen vom Suizid des Professors, der seine Skier absichtlich in eine Baumgruppe lenkt. Kurz vorher hat er Franz feierlich eine Uhr geschenkt, die eingravierte Inschrift lautet: "Für unsere gemeinsamen Tage, für alles".
"Genau zwei Tage vor seinem Tod hatte der Professor zu mir gesagt, er sei überzeugt, dass jeder Mensch wenigstens eine Geschichte in seinem Leben habe, von der er nicht wolle, dass jemand anderer sie zu hören bekomme, es gebe bei jedem ein Zentrum des Schweigens, ein Zentrum der Scham, an das er sich selbst kaum heranwage."
So wie Franz damals die "billigen Tricks" kannte, um die fotografierten Brautpaare in ein besseres Licht zu rücken, so wendet er bei der Niederschrift des Textes Manöver an, um sein eigenes "Zentrum des Schweigens" abzuschotten. Gstrein interessiert sich erneut für die Psychologie des Erzählens, dafür, wie die Beschönigung eines Lebens dazu dient, eben dieses Leben zu verfälschen. Wie mächtig beziehungsweise ohnmächtig ist die Sprache, wenn es darum geht, die "innerste Eigenthümlichkeit" einer Person auszuleuchten? Kann sie nicht auch, ja sogar viel eher der Verschattung dienen?
Im Dunkeln tappen
Das Buch nimmt sich ob des irrlichternden Titels erst einmal wie ich-lastige Bekenntnisprosa samt autobiographischen Akzenten aus. Tatsächlich legt der Autor mit seinem bei "Hanser" erschienenen Roman einen kritischen Kommentar zu einer Gegenwartsliteratur vor, die sich allzu stark dem Paradigma der gefühlvollen Selbstoffenbarung verschrieben hat. Auch deswegen ist die Lektüre sowohl ein literaturtheoretischer Gewinn als auch ein stilistischer Genuss. Einerseits gewährt Gstreins hochpräzise Sprache dem geschmeidigen Parlando der Hauptfigur viel Raum. Andererseits nährt sie über verwinkelte Formulierungen und vermeintlich nichtige Details eine Skepsis, die sich mehr und mehr Bahn bricht. In diesen Zeilen ist eben kein Schlafwandler am Werk, sondern ein Stratege.
"Was, wenn sich die Wahrheit nur allzu oft als schlechte Geschichte herausstellte, ja, als plattes Klischee? Solange die Sätze unverbunden nebeneinander standen, musste man sich hüten, Verbindungen herzustellen, man musste wissen, dass 'weil' ein gefährliches Wort war, vielleicht das gefährlichste Wort überhaupt, zumal es nahelegte, man habe etwas verstanden, wo man vielleicht gar nichts verstanden hatte und nach einem ersten, grellen Lichtblitz der Erkenntnis in Wirklichkeit im Dunkeln tappte."
Erst nach der Hälfte erfährt die Leserschaft, dass Franz die Geigerin namens Sarah beim Spaziergang bedrängt hatte. Seine Avancen, sie zu küssen, hatte sie mit einem dreifachen "Nicht!" von sich gewiesen. Und es vergehen nochmal viele Seiten, bis sich herausstellt, dass Sarah damals nicht siebzehn, sondern erst dreizehn Jahre alt war.
Die Vermeidung von Nähe
Bei so zahlreichen Verdachtsmomenten verwundert es nicht, dass in "Als ich jung war" jeder jeden beäugt: In Österreich lässt sich der Kommissar auch nach Jahren nicht abwimmeln; er ist überzeugt, dass Franz etwas mit dem tödlichen Sturz der Braut zu tun hat. In Jackson fühlen zuerst der Sheriff, später der Bruder von Eileen Franz auf den Zahn, um Näheres über ihr Verschwinden zu erfahren. Ebenso wird dem Leser eine Rolle als Skeptiker zugewiesen: Er liest und zweifelt, er fühlt mit und wähnt sich im Glauben, der Wahrheit hinter den Worten nahe zu sein.
Auch wenn der Roman in der zweiten Hälfte ein, zwei Schauplätze zu viel begeht und seinem gesprächigen Protagonisten keinen Einhalt gebietet, so glückt Norbert Gstrein doch ein bemerkenswerter Handstreich: Er problematisiert die Konzepte von Nähe und Selbstoffenbarung, indem er sie als literarische Kategorien inspiziert. Nicht alles lässt sich sagen; nicht jeder ist fähig beziehungsweise willig, sich anderen Menschen offenherzig anzunähern. Das gilt für Franz ebenso wie für den Professor, dessen letzte missglückte Beziehung allmählich aufgedeckt wird. Nach dessen Selbstmord spricht Franz mit der Barkeeperin ihres Stammcafés. Sie konfrontiert ihn mit einer Erkenntnis, die er lange und erfolgreich von sich gewiesen hat: dass er für den Professor der nächste Mensch gewesen ist, den er jemals gehabt hat.
"Ich erschrak und konnte meinen Schreck nicht verbergen, merkte selbst, wie von einer Sekunde auf die andere meine Augen hin und her irrten, als würden sie nach einem Ausweg suchen."
Die Scheu vor Preisgabe und Intimität führt geradewegs ins Opake, mithin ins Manipulative. Auf diesem Terrain kennt sich Gstrein gut aus, stellen doch zahlreiche seiner Schriften die postmoderne Systemfrage: Welche Konstruktionen bestimmen die Erfahrung von Wirklichkeit? Ist es möglich, einen unverstellten Zugriff auf die Welt zu erlangen? Seine erzählskeptische Poetik hat Gstrein mit "Als ich jung war" nicht vorangetrieben, geschweige denn neu ausgerichtet. Die bekannten Knoten werden geknüpft, die üblichen Fragen bleiben unbeantwortet. Dass der Roman nicht zur Fingerübung verkommt, ist der seit vielen Jahren verbürgten stilistischen Könnerschaft seines Autors zu verdanken.
Norbert Gstrein: "Als ich jung war"
Carl Hanser Verlag, München, 352 Seiten, 23 Euro
Carl Hanser Verlag, München, 352 Seiten, 23 Euro