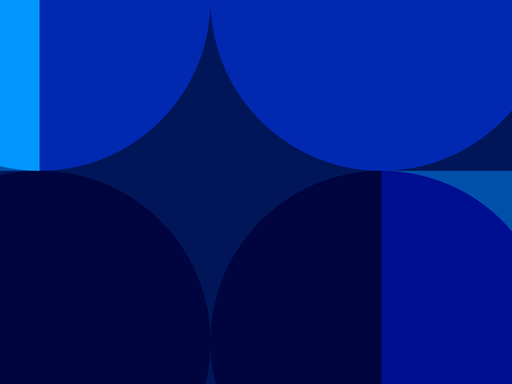Nürnberg 1945: Am 20. November begann der Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Ein halbes Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mussten sich führende Nationalsozialisten vor einem internationalen Militärgericht für ihre Verbrechen an Millionen Menschen verantworten.
Auf der Anklagebank saßen 21 hochrangige Nazis, darunter Hermann Göring, Rudolf Heß und Hans Frank. Die Vorwürfe lauteten: „Verschwörung gegen den Weltfrieden, Planung und Durchführung eines Angriffskrieges, Verbrechen und Verstöße gegen das Kriegsrecht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“
Nach einem Verhandlungsmarathon von 216 Tagen endete der Hauptprozess mit zwölf Todesurteilen, sieben langjährigen Haftstrafen und drei Freisprüchen.
Der Internationale Militärgerichtshof der Alliierten war ein Novum der Weltgeschichte und in mehrfacher Hinsicht wegweisend: Der Prozess legte den Grundstein für die juristische, politische und moralische Aufarbeitung der Menschheitsverbrechen des Zweiten Weltkriegs - mit Auswirkungen bis in die Gegenwart.
Meilenstein des modernen Völkerstrafrechts
Der Nürnberger Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher gilt als Meilenstein des modernen Völkerrechts und als Vorbild für den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Erstmals wurden in diesem Verfahren Politiker und Militärs persönlich für völkerrechtliche Verbrechen zur Rechenschaft gezogen.
Das Prinzip der individuellen Schuld durchbrach den bis dahin geltenden Grundsatz, dass allein Staaten für die Einhaltung des Völkerrechts verantwortlich sind. Seitdem können auch Staatschefs, Minister und Generäle für Straftaten wie Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt werden - selbst dann, wenn das nationale Recht ihres Heimatlandes keine Strafe vorsieht. Auf diesen Nürnberger Prinzipien basierten seither alle internationalen Strafgerichtshöfe.
Der lange Weg von Nürnberg nach Den Haag
Die Gräuel des Zweiten Weltkriegs schärften weltweit das Bewusstsein, dass die internationale Gemeinschaft Regeln braucht, die auch strafrechtlich durchgesetzt werden können. Und so gab es im Zwanzigsten Jahrhundert bemerkenswerte Fortschritte in der internationalen Strafverfolgung von Kriegsverbrechern.
Allerdings war der Weg von Nürnberg nach Den Haag nicht so gradlinig, wie oft angenommen, sagt die Rechtsprofessorin Alexa Stiller. Sie beschreibt die Geschichte des Völkerstrafrechts als eine voller Abzweigungen, Sackgassen und Kehrtwendungen. Bis zur Gründung des heutigen, ständigen Internationalen Strafgerichtshofs dauerte es denn auch noch mehr als ein halbes Jahrhundert.
Nachdem die Aushandlung und Umsetzung weltweiter Konfliktregeln nach den Hauptkriegsverbrecherprozessen gerade erst Fahrt aufgenommen hatte, sorgte nämlich wenig später der Kalte Krieg wieder für Stillstand - zumindest mit Blick auf die Einrichtung eines permanenten internationalen Strafgerichtshofs. Die Konfrontation der beiden Blöcke verhinderte den Aufbau internationaler Gerichtsbarkeit.
Das änderte sich erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Den Anfang machten Mitte der 1990er-Jahre die Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda. Der UN-Sicherheitsrat setzte die beiden Sondertribunale ein, um die dort begangenen Verbrechen aufzuarbeiten. Einige Jahre später folgte dann die Gründung des ständigen Internationalen Strafgerichtshof, der 2002 seine Arbeit aufnahm.
Ein Strafprozess als Mittel der Umerziehung
Der Prozess gegen die NS-Elite war jedoch nicht nur aus strafrechtlicher Sicht bedeutend, sondern auch essenziell für die historische Aufklärung. Bei dem Verfahren ging es um mehr als die Verurteilung der Angeklagten: Die Alliierten verfolgten auch ein politisches Ziel, sagt Stiller. Sie wollten der Welt - und allen voran den Deutschen - die Gräueltaten der Nationalsozialisten bewusst machen.
Als erste große und öffentliche Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen wurde der Prozess im Nürnberger Justizpalast zu einem internationalen Medienereignis mit Hunderten von Beobachtern, darunter prominente Namen wie Ernest Hemingway, Erich Kästner und Willy Brandt. Journalisten aus aller Welt sorgten dafür, dass das Urteil um die Welt und die Bilder aus dem Gerichtssaal ins kollektive Gedächtnis eingingen.
Der Hauptkriegsverbrecherprozess war - wie die anschließenden zwölf Nachfolgeprozesse - Teil des US-amerikanischen "Re-Education"-Programms. Ein Mittel der Umerziehung, erklärt Stiller, das die deutsche Gesellschaft entnazifizieren und demokratisieren sollte. „Es ging darum, der Bevölkerung die Verbrechen klar vor Augen zu führen und damit eine Abkehr von dem alten Regime zu veranlassen.“
Im Laufe des Verfahrens hörte der Militärgerichtshof 240 Zeugen und nahm mehr als 5.000 Dokumente entgegen. Die Beweislast war erdrückend, die vorgelegten Materialien beklemmend.
Aus Sicht von Historikerin Annette Weinke waren diese Erkenntnisse und Befunde des Verfahrens zentral, „um Geschichtsmythen und Geschichtslegenden die Grundlage zu entziehen“. Die Expertin ist überzeugt: Im Völkerstrafrecht werden Urteile über die Geschichte gefällt. So habe man auch in Nürnberg „sehr bewusst und reflektiert“ eine Deutung der Ereignisse vorgenommen.
Die Nürnberger Prozesse in der Erinnerungskultur
Im historischen Gerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes gibt es heute keine Prozesse mehr. Der Raum dient seit einigen Jahren ganz der Erinnerung an das historische Strafverfahren. Auch dadurch wirken die Prozesse bis in die Gegenwart nach: als Teil der deutschen Erinnerungskultur.
Und das Interesse an den Nürnberger Prozessen und dem Völkerrecht ist bis heute groß, sagt die Historikerin Nina Lutz. Sie leitet das „Memorium Nürnberger Prozesse“, die Dauerausstellung am historischen Ort.
Lutz zufolge verzeichnet die Ausstellung mit 160.000 Besuchern im Jahr einen deutlichen Besucherzuwachs. Sie ist überzeugt: Je mehr heute das Völkerstrafrecht unter Druck gerate, desto eher schaue man wieder auf die Nürnberger Prozesse, bei denen sich die unterschiedlichsten Parteien mit unterschiedlichen politischen Systemen zusammengefunden und gesagt hätten: Wir geben dem Recht den Vorzug vor der Rache.
Die Motivation der Kriegsverbrecher
Die Nürnberger Prozesse haben die Gräueltaten der Nazis sichtbar und die Kriegsverbrecher verantwortlich gemacht. Sie haben zur Aufklärung beigetragen, indem sie die Täter und ihre Taten in den Fokus rückten. Dabei sollte gerade die Täterperspektive in der Erinnerungskultur grundsätzlich mehr beachtet werden, fordern Historiker wie Jens Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dorau und Martin Cüppers von der Forschungsstelle Ludwigsburg.
Die Auseinandersetzung mit der Frage, warum die meisten Deutschen mitgemacht haben, hält Wagner auch mit Blick auf den großen Zuspruch der AfD unter jungen Wählerinnen und Wählern bei den letzten Landtagswahlen für relevant.
Auch die Historikerin Steffi De Jong plädiert dafür, in der Erinnerungskultur die Täter und ihre Motivation stärker in den Fokus zu rücken und so für aktuelle gesellschaftliche Veränderungen zu sensibilisieren.
irs