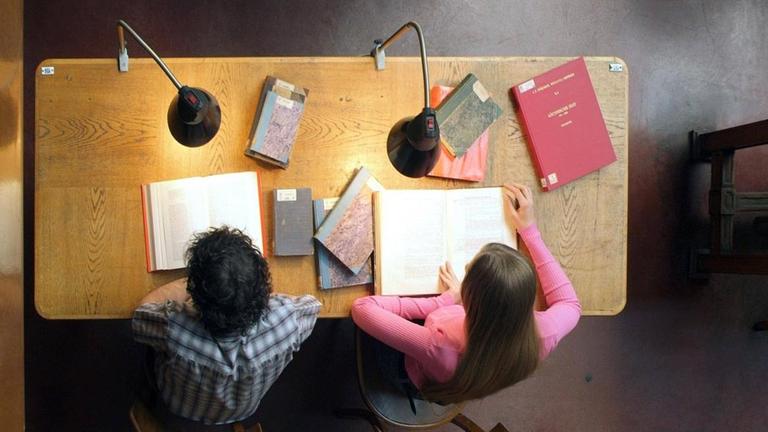Bildungserfolg ist in Deutschland für sozial benachteiligte Schüler nach wie vor schwieriger zu erreichen als in vielen anderen Ländern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, die den Zehnjahreszeitraum zwischen 2006 und der letzten PISA-Studie 2015 umfasst. Demnach holen deutsche Schulen seit dem PISA-Schock im Jahr 2000 zwar international auf und der Einfluss der Herkunft wird immer schwächer. Doch: Die Leistungsschere ist immer noch groß.
Soziale Mobilität erhöhen
Die Autoren der Studie haben die Daten anhand der naturwissenschaftlichen Tests der PISA-Studie 2015 ausgewertet. Ein zentrales Ergebnis: Kinder aus einkommensschwachen Familien liegen immer noch fast dreieinhalb Jahre hinter Schülern aus sozial starken Elternhäusern zurück. Der Durchschnitt in den 36 OECD-Mitgliedsstaaten liegt bei drei Jahren. Und: Nur 15 Prozent der Erwachsenen, deren Eltern kein Abitur haben, erreichten in Deutschland einen Hochschulabschluss. Das liegt unter dem OECD-Schnitt.

Die Autoren der Studie machen verschiedene Vorschläge, wie die sogenannte soziale Mobilität erhöht werden könnte. Einer davon: eine bessere soziale Mischung in den Klassen. Die Studie zeigt, dass sozial benachteiligte Schüler deutlich bessere Leistungen zeigen, wenn sie nicht benachteiligte Schulen besuchen. In diesem Fall schneiden sie bei Tests in Naturwissenschaften 122 Punkte besser ab - was einen Unterschied von vier Jahren Schulerfahrung ausmacht. Aktuell besuchen aber knapp 50 Prozent der sozial benachteiligten Schüler Schulen, in denen die anderen Schüler den gleichen sozio-ökonomischen Hintergrund haben.
Mehr Förderprogramme für benachteiligte Schüler
Ein weiterer Vorschlag: sozial benachteiligte Schüler stärker zu fördern - insbesondere durch einen besseren Zugang zu frühkindlicher Bildung - also z.B. Kitas. Und: Durch mehr individuelle Förderprogramme für benachteiligte Schüler und Schulen, zu denen auch die Lehrer gezielt beitragen und ausgebildet werden könnten.
Für Oliver Kaczmarek, den bildungspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sei es zwar erfreulich, dass die Wirkung des sozialen Hintergrunds auf den Bildungserfolg reduziert werden konnte. Doch gelinge das noch nicht so gut wie in vielen anderen Ländern. Daher sei die Bundesregierung gefordert, die Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag beispielsweise beim Digitalpakt voranzutreiben.
Vor gut einem Monat hatte die OECD bereits ihren jährlichen Bildungsbericht vorgelegt - ebenfalls mit dem Fokus Chancengleichheit. Das Fazit damals: Deutschland hole in einigen Bildungsbereichen zwar auf. Für Kinder aus ärmeren Familien sowie für Einwandererkinder ist ein Aufstieg durch Bildung aber immer noch schwierig.