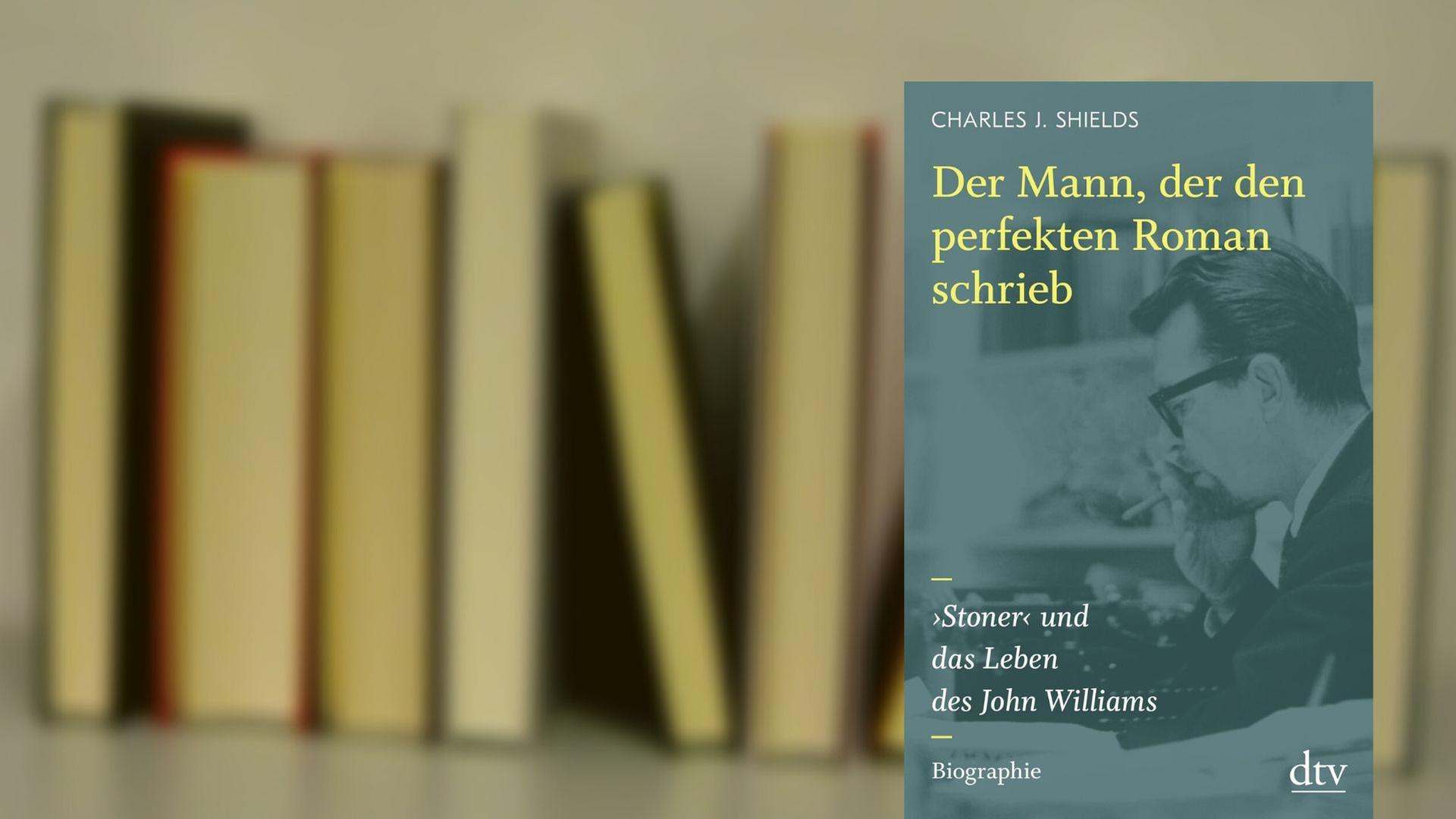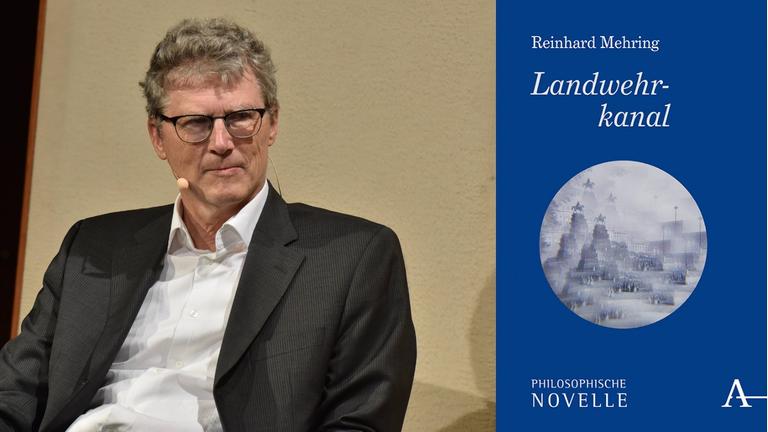
Die Universität ist ein Ort, an dem radikale Freiheit und strenges Regelwerk ungebremst aufeinandertreffen. Diese explosive Mischung, angereichert durch das Spiel der Macht zwischen Jung und Alt, Unwissend und Wissend, wo sich das Menschlich-Allzumenschliche wie in einer Petrischale beobachten lässt. Das heißt: beobachten ließe, wäre die akademische Gerüchteküche nicht aus Angst vor Prestigeverlust an einen Schweigekodex gebunden. Gelästert wird nur zwischen den Vorträgen, auf dem Weg zum Hörsaal, beim Kaffee in der Mensa.
Gerade deswegen eignet sich die Universität vorzüglich, um über sie und ihr Personal gute Geschichten zu erzählen. Halb Verschwiegenes verbreitet sich zuverlässiger als jeder Artikel in einer Fachzeitschrift; und der ständige Zustrom von immer neuen Studierenden und Professoren sorgt für geradezu unendlich variantenreiches Material. Dass die Campus-Literatur vor allem im Pulp-Genre erfolgreich ist – abgefahrene Mordfälle und Sex-Affären –, ist daher nicht überraschend. Überraschend ist eher, dass sie, zumindest in Deutschland, darüber bisher kaum hinausgekommen ist.
Der mysteriöse Tote
Reinhard Mehrings "Landwehrkanal" ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Anstatt das küchenpsychologische Klischee von der Lust zu bemühen, die durch die Vernunft nur mehr schlecht als recht verborgen wird, geht es in seinem Roman um die Freundschaft zweier Männer: einer aus dem Osten, einer aus dem Westen Deutschlands. An der Humboldt-Universität lernen sie sich kurz nach der Wende kennen.
R., von dem der Protagonist M. erzählt, hat bereits die ersten Karriereschritte hinter sich, als er im neuen System eine Stelle bekommt. Er überlässt M. eine Mappe mit Aufzeichnungen zu einer Frage, die ihn als Kuriosum interessiert: Wie starb der Philosoph Friedrich Eduard Beneke, dessen Leiche 1856 aus einem Kanal gezogen wurde, nachdem er über zwei Jahre als vermisst galt?
Humboldt-Universität im Umbruch
Also doch ein abgefahrener Mordfall? Keineswegs. Der rätselhafte Tod ist für Mehring nur der Aufhänger für eine – stellenweise äußerst detailreiche – Darstellung universitärer Milieus und Umgebungen, auch ihrer Architekturen der Macht und ihrer fast kafkaesken Wirkung:
"Das Sekretariat des Instituts für Philosophie lag im hinteren Teil des Gebäudes im zweiten Stock (…). Die Einrichtung war aus dem Osten überkommen. Es gab ein kleineres Vorzimmer für die (…) Institutssekretärin, die gute Seele des Instituts, man trat seitwärts in das ausgreifende Direktionszimmer und ging dann am Schreibtisch des Direktionsassistenten vorbei, der aus dem Osten kam und (…) letzte Observationspflichten wahrnahm, einige Meter bis zum Schreibtisch des Institutsdirektors, fast wie in der Reichskanzlei."
Anfang der 90er Jahre befindet sich die Humboldt-Universität im Umbruch. Die DDR ist Geschichte, und obwohl der akademische Betrieb durchsetzt ist von ehemaligen Stasi-Spitzeln – vor allem bei den Theologen –, wird das Personal teilweise übernommen. Einer der Glücklichen, die bleiben dürfen, ist R., der seinem Freund den politischen Realismus dieses Aussiebeprozesses nicht erspart:
"Das musst du verstehen. Wohin sollten wir gehen, wir Philosophen (…)? Welche Zukunft hatten wir denn in der BRD? Jenseits der Privilegien? Die Philosophie wurde brutal abgespeckt. Wir waren ja Wasserkopf, Legitimationsideologen. (…) Es gab zu viele Philosophen, alle auf Marxismus-Leninismus eingefahren, verschworen und geeicht. Wir wurden deshalb ziemlich scharf gesiebt. Und natürlich auch über den Tisch gezogen. (…) Wir sollten unsere entfristeten Verträge kündigen und neu unterschreiben."
Kollision von Wenderoman und doppeltem Kriminalfall
In solchen Passagen ist es Mehring gelungen, die Atmosphäre einer vergangenen Epoche sichtbar zu machen. Universitäten, die, um Geld zu bekommen, Veranstaltungen zu Marx organisieren. DDR-Interieur und Reichskanzlei-Flair im philosophischen Institut, komplett mit Fichte-Büste und dunkelgrünem Beamtenfußboden.
Doch solche Bilder glücken Mehring selten. Sein Text leidet an recht grundsätzlichen Problemen, die zu den Dauerbrennern in Schriftstellerseminaren gehören. Da ist zunächst einmal die Kollision unterschiedlicher Ambitionen: Ein Wenderoman über zwei Freunde aus verschiedenen Systemen, die sich im Miniaturkosmos Universität finden. Dann ein doppelter Kriminalfall, der sich selbst kommentiert: Ein Forscher verschwindet unter mysteriösen Umständen im 20. Jahrhundert, während er über einen Forscher aus dem 19. Jahrhundert forscht, der unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Eine Aufarbeitung der akademischen Intrigen, die die Karriere und das Vermächtnis des kritischen Querkopfs Beneke verhindern. Eine umfassende Darstellung der Notizen, die R. seinem Freund M. übergibt, inklusive seitenlanger Briefe von Persönlichkeiten wie Schleiermacher und Hegel zu Beneke. Eine anspielungs- und kenntnisreiche innere Reflexion über den Zusammenhang von Fiktion und Realität. Eine satirisch angehauchte Beschreibung ehemaliger Weggefährten.
Jeder Satz ein Bonmot
Das kann nicht klappen – und so liest man bis zur eigentlichen Handlung, die Sichtung der Notizen, die sich R. zu Beneke angefertigt hat, fast das halbe Buch. Das liegt auch an dem geradezu klassischen Darstellungsfehler fehlender Verknappung. Mehring schließt an jeden Gedanken, der seiner Geschichte nutzt, drei weitere an, die zur Sache nichts beitragen.
Das führt zu ausführlichen Referaten über die Berliner Stadtlandschaft, die Ereignisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die Flüchtlingskrise 2015, Merkel und Europa. Die fehlende Distanz zum eigenen Text schlägt sich auch in den Figuren nieder, die fast ausnahmslos in der gleichen referierenden Weise über ihre Themen sprechen. Hinzu kommt, dass Mehring die Freiheit der Fiktion nutzt, um mit Lieblingsfeinden wie Martin Heidegger oder Sahra Wagenknecht abzurechnen.
Bisweilen gleitet die Sprache ohne erzählerische Funktion in einen seltsam aphoristisch wirkenden Telegrammstil ab, der aus jedem Satz ein Bonmot zu machen versucht. Die Darstellung ist an einigen Stellen widersprüchlich, durch sprunghafte Themenwechsel geprägt, die, wie die historischen Referate, den Lesefluss ein ums andere Mal ins Stocken bringen.
Notizenkonvolut aus seitenlangen Briefen
Mehrings Text scheitert an der Unvereinbarkeit eines ideengeschichtlichen Referats, das literarisch scheitert und einer Literatur, die ständig mehr sein und mehr zeigen will, als es für ihre Story gut ist. Das ist schade, denn Idee und Ausgangspunkt sind vielversprechend. Sowohl M. als auch R. sind interessante Charaktere, über die man gerne mehr erfahren würde. Aber kaum hat man angefangen, Interesse für die Figuren und ihre Konflikte zu entwickeln, da soll man sich schon durch ein Notizenkonvolut mit seitenlangen Briefen kämpfen, das R. interessant fand.
Das ist so, als würde man eine Geschichte über einen berühmten Physiker erzählen und dann versuchen, beim Leser Interesse für die Figur zu wecken, indem man ihm die Berechnungen des Physikers vorlegt. Ganze 70 Seiten widmet Mehring der Darstellung dieses Materials, bis er wieder zu M. zurückkehrt.
Weniger wäre mehr gewesen
Eigentlich möchte man das nicht. Man möchte lieber M. und R. bei ihren Gesprächen mit der "Perle aus dem LSD-Kiez" und dem Genossen G. zuhören, über Marx und die DDR und wie sich hier Philosophie und Leben mischen. Man möchte durch das Berlin kurz nach der Wende streifen und Mäuschen spielen an der Universität, wo West und Ost, Vergangenheit und Zukunft aufeinanderprallen. Auch R.s Forschung über Beneke ließe sich hier unterbringen, ohne den Leser mit Quellen, Quellenkommentaren und inneren Monologen über diese Quellenkommentare zuzuwerfen.
Allzu große Ambitionen beherbergen die Gefahr, dass man an ihnen scheitert. Das ist die Lektion, die Mehrings Figuren in seiner philosophischen Novelle lernen müssen. Zumindest in dieser einen Hinsicht wäre nicht weniger, sondern mehr Identifikation von Autor und Figuren wünschenswert gewesen.
Reinhard Mehring: "Landwehrkanal"
Alber-Verlag, Freiburg / München
245 Seiten, 24 Euro.
Alber-Verlag, Freiburg / München
245 Seiten, 24 Euro.