
Plastik ist mittlerweile überall: auf Berggipfeln, im Essen und sogar in der Atemluft. Das hat Folgen für die Umwelt und für uns Menschen. Winzige Kunststoffpartikel dringen in unsere Lunge, ins Blut und bis ins Gehirn vor. Ein aktueller Bericht des WWF und der Universität Birmingham zeigt: Immer mehr medizinische Studien weisen auf mögliche gesundheitliche Folgen hin, von chronischen Entzündungen über Hormonstörungen bis zu einem erhöhten Krebsrisiko.
Was ist Mikroplastik und Nanoplastik und wo ist es enthalten?
Mikro- und Nanoplastikpartikel sind winzige Kunststoffteilchen, die in die Umwelt gelangen, meist dann, wenn größere Plastikprodukte wie Tüten oder Verpackungen zerfallen. Mikroplastik ist kleiner als fünf Millimeter, oft kaum größer als der Durchmesser eines Haars. Nanoplastik ist noch winziger: höchstens ein tausendstel Millimeter groß und mit bloßem Auge nicht mehr zu erkennen.
Die Plastikpartikel finden sich inzwischen in zahlreichen Lebensmitteln, auch in Mineral- oder Trinkwasser. Die Konzentrationen im Trinkwasser seien sehr gering, erklärt der Ökohydrologe Stefan Krause von der Universität Birmingham. Er ist Mitautor der WWF-Studie zu möglichen Gesundheitsrisiken durch Mikro- und Nanoplastik.
Mikroplastik aus Reifenabrieb
Eine der Hauptquellen für Mikroplastik ist der Abrieb von Autoreifen, sagt Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale NRW. In Innenräumen gelangen Kunststofffasern aus Teppichen, Kleidung, Polstern oder Vorhängen in die Luft, besonders solche aus Polyacryl, Nylon oder Polyester.
Auch in Kosmetika steckt oft Mikroplastik. In der EU sind bislang nur lose Glitterpartikel und Mikroperlen in Peelings verboten. In Produkten wie Make-up oder Lippenstiften bleibt Kunststoff bis 2035 erlaubt.
Wie gelangen Plastikpartikel in den Körper?
„Am häufigsten gelangen Kunststoffteilchen über verpackte Lebensmittel oder die Atemluft in den Körper“, erklärt der Ökohydrologe Stefan Krause. Eingeatmete Partikel dringen tief in die Bronchien und Lunge vor, können sich im Rachenraum ablagern und verschluckt werden. Auf diese Weise gelangen sie, wie auch über die Nahrung, in das Verdauungssystem.
Auch über die Haut kann Mikro- und Nanoplastik aufgenommen werden, allerdings in deutlich geringerer Menge. Die Haut stellt laut Eleonore Fröhlich von der Medizinischen Universität Graz eine solide Barriere dar.
Auch die Lunge verfüge Mechanismen, um sich zu schützen. „Anders sieht es im Darm aus. Offenbar können kleine Mikroplastikpartikel durch die Schleimhaut und die Darmwand gelangen“, sagt Fröhlich. Nanoplastik sei so groß wie ein Virus und gelange so leicht in die Zellen selbst.
Belastung ist unterschiedlich verteilt
Wie viel Plastik ein Mensch aufnimmt, hängt stark vom Lebensstil ab, vor allem von der Ernährung, erklärt Stefan Krause. Wer etwa häufig verpackte Lebensmittel konsumiert, nimmt tendenziell mehr Kunststoffpartikel auf.
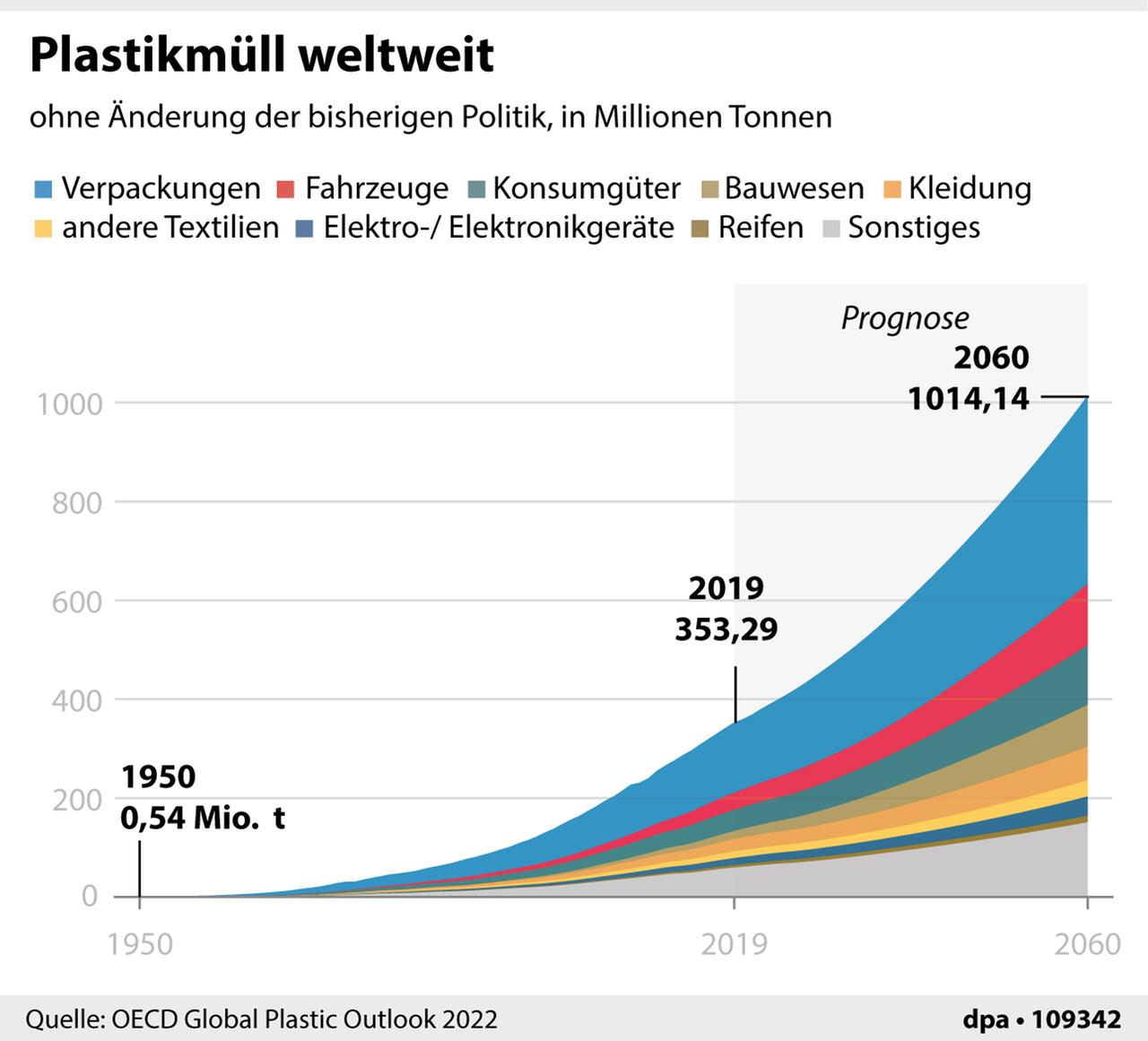
UN-Plastikabkommen: Finale Verhandlungsrunde in Genf
Nachdem die letzte Verhandlungsrunde zum UN-Plastikabkommen im November 2024 in Südkorea ohne Einigung endete, treffen sich Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 170 Ländern nun zur finalen Runde – vom 5. bis 14. August 2025 in Genf. Ziel ist ein weltweit verbindlicher Vertrag zur Eindämmung der Plastikverschmutzung. Wissenschaftler und Organisationen wie der WWF fordern, dass dabei auch die gesundheitlichen Folgen für Mensch, Natur und künftige Generationen stärker berücksichtigt werden.
Auch der Aufenthaltsort spielt eine Rolle: In Städten mit viel Verkehr und starkem Reifenabrieb ist die Belastung deutlich höher als im ländlichen Raum. Selbst Innenräume sind relevant, zum Beispiel Büros mit Teppichen, Polstermöbeln oder Vorhängen, die Kunststofffasern in die Luft abgeben.
Plastik im menschlichen Gehirn
In einem Experiment mit Mäusen, denen Mikroplastik verabreicht wurde, konnte der Wiener Pathologe Lukas Kenner bereits nach zwei Stunden Plastikpartikel in verschiedenen Organen nachweisen. Beim Menschen sind solche Tests zwar nicht möglich, doch auch hier gibt es Hinweise: Mikroplastik wurde unter anderem im Urin gefunden. Das bedeutet, dass die Partikel vom Darm ins Blut und bis in die Niere gelangt sein müssen.
Auch im menschlichen Gehirn wurde Mikroplastik entdeckt, und zwar bei Autopsien von Verstorbenen im Jahr 2024 deutlich häufiger als bei Todesfällen zehn Jahre zuvor. Die Belastung scheint also weiterhin zuzunehmen.
Was sind die gesundheitlichen Folgen von Mikro- und Nanoplastik?
Seit 2018 wurden laut WWF fast 1500 Studien zu den gesundheitlichen Folgen von Mikroplastik veröffentlicht. Die Risiken gehen dabei nicht nur von den Plastikpartikeln selbst aus, sondern auch von Chemikalien wie Phthalaten, Bisphenolen und PFAS, sogenannten Ewigkeitschemikalien, die in der Plastikproduktion verwendet werden.
Viele dieser Stoffe lassen sich bereits im Körper nachweisen, etwa im Blut oder Lungengewebe. Studien zeigen mögliche Zusammenhänge mit zahlreichen Erkrankungen, darunter hormonell bedingte Krebsarten wie Brust- und Hodenkrebs, Unfruchtbarkeit, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit sowie neurologische Störungen wie ADHS, Autismus und Demenz.
Noch fehlen verlässliche Nachweise
Mikroplastik wurde in verschiedenen Tumoren nachgewiesen, zum Beispiel in der Prostata, der Lunge und dem Dickdarm. Dabei fanden Forschende zum Teil höhere Konzentrationen als im gesunden Gewebe. Der Wiener Pathologe Lukas Kenner beobachtete in Zellkulturen außerdem: Unter dem Einfluss von Mikroplastik werden Krebszellen beweglicher, ein Hinweis darauf, dass die Partikel möglicherweise die Bildung von Metastasen begünstigen könnten.
Ein klarer Nachweis konkreter Krankheitsursachen ist dennoch schwierig, da für Nanoplastik verlässliche Messmethoden fehlen. Auch Kunststofftyp, Größe und Schadstoffbelastung sind oft schwer zu bestimmen. Viele Studien arbeiten außerdem mit unrealistisch hohen Konzentrationen. Trotz offener Fragen nimmt die wissenschaftliche Evidenz zu.
Wie kann man die Plastikaufnahme vermeiden?
„Die Plastikaufnahme beginnt schon beim Einkauf“, sagt Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale NRW. Ihr Rat: Möglichst unverarbeitete und unverpackte Lebensmittel wählen. In der Küche sollten Plastikdosen, -schalen und -schneidebretter durch Glas, Edelstahl oder Hartholz ersetzt werden. Auch Kunststoff-Teebeutel besser meiden und statt Meersalz lieber zu Steinsalz greifen, das meist weniger belastet ist.
Leitungswasser enthält laut Schätzungen deutlich weniger Mikroplastik als Wasser aus Plastikflaschen. Bei Kleidung empfiehlt Effers, auf Naturfasern umzusteigen und Textilien möglichst lange zu tragen.
Besonders bei Sport- und Outdoorbekleidung gilt: Lieber lüften statt waschen, vor allem in den ersten Waschgängen lösen sich viele Fasern. Eine gut gefüllte Maschine reduziert den Faserabrieb zusätzlich.
Bei Kosmetik lohnt ein Blick auf Naturkosmetik-Siegel. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Inhaltsstoffe prüfen. Als Faustregel gilt: Bei Begriffen mit „Poly“ besser zweimal hinschauen. Hilfreich sind außerdem Apps wie ToxFox vom BUND oder CodeCheck, die Produkte auf Mikroplastik und andere bedenkliche Stoffe überprüfen.
Elena Matera



















