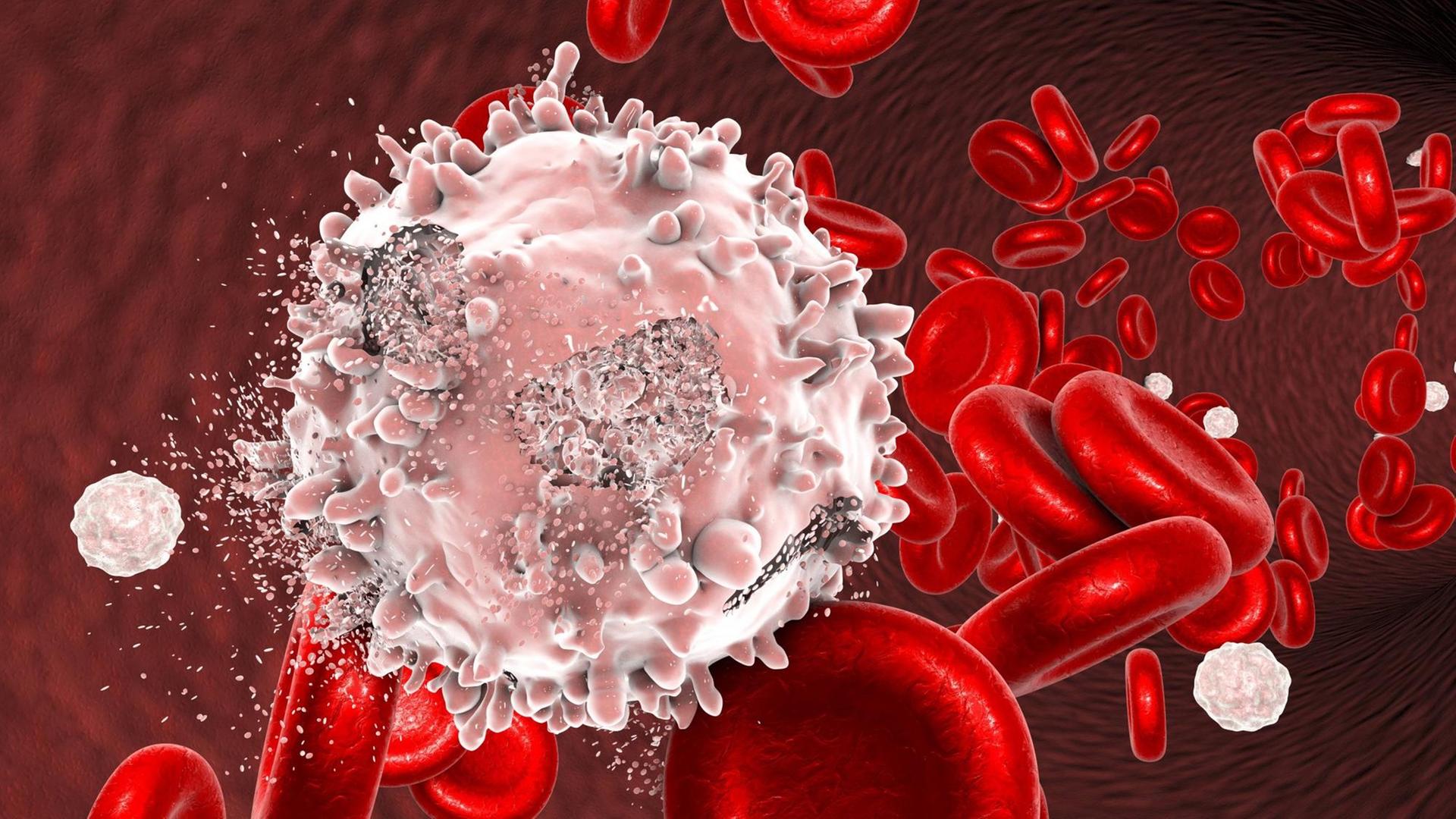Bei den Lungenärzten ist nichts mehr so, wie es einmal war. In dieser Woche trifft sich ihr Bundesverband in München zum Jahreskongress. Und neben den Fachthemen wie Lungenkrebs oder der nächsten Grippewelle stehen bei der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, kurz DGP, auch "Fake News" auf dem Programm: das Schlagwort, das einst bewusst gestreute Falschinformationen brandmarken sollte und heute unter anderem genutzt wird, um unliebsame politische Vorhaben und wissenschaftliche Erkenntnisse zu diskreditieren.
Wie es ist, wenn fragwürdige Positionen in der Öffentlichkeit Karriere machen und von Medien und Politikern aufgegriffen werden, hat der Lungenärzteverband vor wenigen Wochen erfahren. Sein ehemaliger Präsident Dieter Köhler stellte mit rund 100 Kollegen den gesundheitlichen Nutzen von Grenzwerten für Feinstaub und Stickstoffdioxid, NO2, infrage — und erhielt prompt Zuspruch von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
"Generell muss man natürlich sagen, diese 100 Ärzte sind eine Minderheit der Pneumologen, die dort gesagt haben, dass alles sozusagen nicht gesundheitsschädlich ist."
Sagt Holger Schulz, Epidemiologe vom Helmholtz Zentrum in München. Schulz ist Hauptautor eines neuen Grundsatzpapiers der DGP. Darin macht der Verband klar, dass er Feinstaub für den gefährlichsten Schadstoff in der Luft hält. Und die Experten fordern noch strengere Abgasgrenzwerte in der Europäischen Union, nicht schwächere, wie sie CSU-Mann Scheuer in einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc eingefordert hatte - unter Berufung auf die besagten 100 Lungenärzte. Darauf erhielt er nun eine brüske Absage in einem Brief, den die Binnenmarkt-Kommissarin Elżbieta Bieńkowska und Umweltkommissar Karmenu Vella gleich mit unterschrieben, um der Sache Nachdruck zu verleihen.
Nicht kurzsichtig, sondern politisch kalkuliert
Holger Schulz weiß nicht mehr, wie viele Interviews er seit Köhlers Brief gegeben hat, um dessen Behauptungen zu entkräften. Es frustriert ihn, dass dieses Schreiben so viel Aufmerksamkeit erregt - und sogar in der hohen Politik Zustimmung gefunden hat. Vor allem, weil es dem widerspreche, was Wissenschaftler jahrelang mühsam erarbeitet hätten.
"Man muss halt im Hinterkopf haben, dass die Luftschadstoffbelastung, die Richtwerte zum Beispiel der WHO, wie sie vorgegeben werden, von einem großen Gremium an internationalen Experten über Jahre ausgearbeitet werden, und man dann zum Schluss kommt: Wir empfehlen, die Luftschadstoffgrenzwerte sollten nicht höher sein als zum Beispiel die 40 Mikrogramm bei NO2 oder die 10 Mikrogramm beim Feinstaub. Und dass man diese Expertise natürlich auch erst einmal anerkennen muss."
Bei dieser Anerkennung für wissenschaftliche Erkenntnisse aber, so scheint es, hapert es immer wieder — gerade, wenn es politisch kontrovers wird. Da mögen Mediziner, Statistiker und Epidemiologen sich über Jahre in Forschungsvorhaben, Messungen, Versuchen, Debatten und gegenseitiger Qualitätskontrolle einem Grenzwert für die Weltgesundheitsorganisation angenähert haben, der die Gesundheit der Bevölkerung wahren soll. Wenn es besser in die Agenda des Verkehrsministers passt, stützt er sich trotzdem lieber auf eine teils polemisierende Minderheit von Ärzten ohne erkennbare Expertise im Feld

Die Reaktion des CSU-Ministers sei nicht kurzsichtig gewesen, sondern politisch kalkuliert, sagt der Philosoph Stefan Gosepath von der Freien Universität Berlin.
"Er steht in einer politischen Auseinandersetzung und nutzt natürlich seine Mittel. Aber eine rationale Politik sollte einen etwas längeren Atem haben. Da kommt es nicht auf drei Tage an. Hier gab es ja objektiv auch gar keinen Entscheidungsdruck, deshalb hätte sich der Minister besser zurückgehalten und hätte auch mit seinem Ministerium, das, glaube ich, insgesamt rationaler operiert, überprüfen müssen, ob die wissenschaftliche Intervention hier eigentlich gerechtfertigt ist oder nicht."
Nachdem Dieter Köhler eingeräumt hatte, dass er sich in seiner Kritik an den Feinstaub-Grenzwerten mehrfach verrechnet hatte, war es ausgerechnet Scheuers Ministerium, das forderte, dass die Debatte nun, so wörtlich, "wissenschaftlich fortgesetzt und eine Versachlichung herbeigeführt" werden müsse. Immerhin aber sei jene durch den Impuls der Lungenärzte ja angestoßen worden. Mit einem Beitrag, der erst einmal nur für Zweifel und Verwirrung sorgt.
Genau darum aber scheint es immer wieder zu gehen, wenn als gesichert geltende Forschungsstände angegriffen werden - und so schnell auch beim unbefangeneren Publikum plötzlich als "umstritten" gelten.
Besonders deutlich wird das aktuell neben dem Streit um Luftschadstoffe beim Klimawandel oder bei Impfgegnern, die mit widerlegten und mitunter abstrusen Behauptungen die Immunisierung gegen Krankheiten scheuen. Teilweise werden die Institute, die etwa in der Klimadebatte prominent Gegenpositionen propagieren, von Großindustriellen finanziert. US-Präsident Donald Trump widersprach öffentlich den Wissenschaftlern seiner eigenen Regierung.
Nachdem Dieter Köhler eingeräumt hatte, dass er sich in seiner Kritik an den Feinstaub-Grenzwerten mehrfach verrechnet hatte, war es ausgerechnet Scheuers Ministerium, das forderte, dass die Debatte nun, so wörtlich, "wissenschaftlich fortgesetzt und eine Versachlichung herbeigeführt" werden müsse. Immerhin aber sei jene durch den Impuls der Lungenärzte ja angestoßen worden. Mit einem Beitrag, der erst einmal nur für Zweifel und Verwirrung sorgt.
Genau darum aber scheint es immer wieder zu gehen, wenn als gesichert geltende Forschungsstände angegriffen werden - und so schnell auch beim unbefangeneren Publikum plötzlich als "umstritten" gelten.
Besonders deutlich wird das aktuell neben dem Streit um Luftschadstoffe beim Klimawandel oder bei Impfgegnern, die mit widerlegten und mitunter abstrusen Behauptungen die Immunisierung gegen Krankheiten scheuen. Teilweise werden die Institute, die etwa in der Klimadebatte prominent Gegenpositionen propagieren, von Großindustriellen finanziert. US-Präsident Donald Trump widersprach öffentlich den Wissenschaftlern seiner eigenen Regierung.
"Genug von Experten"
Und kaum sonst wurde die Abneigung gegen Wissenschaft so deutlich ausgesprochen wie vom britischen Minister und "Brexiteer" Michael Gove, der vorm EU-Referendum 2016 sagte, die Leute hätten "genug von Experten".
Chris Tyler vom University College London kennt sich aus im Verhältnis von Politik und Wissenschaft.
"Es birgt erkenntnistheoretisch eine gewisse Ironie, dass Fakten heute so leicht verfügbar sind und dennoch sogenannte ‚alternative Fakten‘ Zuspruch finden. Ironisch daran ist, dass Wissen nur eine Wikipedia-Suche entfernt liegt - und ‚alternative Fakten‘ oder ‚Fake News‘ sich dennoch in der öffentlichen Debatte Bahn brechen und ihr damit Schaden zufügen. Die politische Polarisierung macht diesen Eindruck noch krasser."
Tyler leitete bis 2017 den wissenschaftlichen Dienst des britischen Parlaments und arbeitet heute in einer eigens dafür gegründeten Abteilung an einer besseren Verständigung von Forschern und Politikern.
"Demokratie funktioniert nicht, wenn Politiker es mit den Fakten nicht ernst nehmen. Wenn ein Parlament nicht mehr darauf beruht, dass politische Entscheidungen mit Evidenz untermauert werden, wenn diese Kultur verloren geht, dann beginnt auch die Demokratie zu zerbrechen."
Soweit allerdings ist es noch nicht, im Gegenteil. Das Eigenartige an der Wissenschaftsmüdigkeit einiger Politiker: Sie trifft auf eine Welt, in der Politik mehr denn je darauf angelegt ist, dass sie von Forschern abgesichert werden kann.
Chris Tyler vom University College London kennt sich aus im Verhältnis von Politik und Wissenschaft.
"Es birgt erkenntnistheoretisch eine gewisse Ironie, dass Fakten heute so leicht verfügbar sind und dennoch sogenannte ‚alternative Fakten‘ Zuspruch finden. Ironisch daran ist, dass Wissen nur eine Wikipedia-Suche entfernt liegt - und ‚alternative Fakten‘ oder ‚Fake News‘ sich dennoch in der öffentlichen Debatte Bahn brechen und ihr damit Schaden zufügen. Die politische Polarisierung macht diesen Eindruck noch krasser."
Tyler leitete bis 2017 den wissenschaftlichen Dienst des britischen Parlaments und arbeitet heute in einer eigens dafür gegründeten Abteilung an einer besseren Verständigung von Forschern und Politikern.
"Demokratie funktioniert nicht, wenn Politiker es mit den Fakten nicht ernst nehmen. Wenn ein Parlament nicht mehr darauf beruht, dass politische Entscheidungen mit Evidenz untermauert werden, wenn diese Kultur verloren geht, dann beginnt auch die Demokratie zu zerbrechen."
Soweit allerdings ist es noch nicht, im Gegenteil. Das Eigenartige an der Wissenschaftsmüdigkeit einiger Politiker: Sie trifft auf eine Welt, in der Politik mehr denn je darauf angelegt ist, dass sie von Forschern abgesichert werden kann.

Das Vertrauen der Bevölkerung in Wissenschaft und Forschung sei stabil, sagt Markus Weißkopf, Geschäftsführer von "Wissenschaft im Dialog", einem Zusammenschluss von Wissenschaftsorganisationen, Verbänden und Stiftungen, der jährlich das "Wissenschaftsbarometer" erstellt. Immerhin gibt darin mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie Wissenschaft eher oder voll vertraut. Und jene, die zweifeln, fürchten meist einen zu starken Einfluss der Industrie.
"Wir sehen auch, dass es ein sehr hohes Interesse an wissenschaftlichen Themen gibt, dass es ein sehr großes Verständnis gibt zum Beispiel dafür, dass Wissenschaft unterschiedliche Positionierungen hat."
Und kaum ein Politiker wird heute vergessen darauf hinzuweisen, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf welcher Evidenz also seine Politik basiert.
"In diesen hochpolitischen Fragen wird Politik die wissenschaftlichen Beweise immer übertrumpfen. Aber immerhin haben die Politiker im Hinterkopf, dass diese Evidenz irgendwie in die politischen Prozesse einfließen sollte. Und wenn wir uns in den kommenden Jahren mit grundlegenden Fragen wie Ungleichheit, der Zukunft von Arbeit oder Klimawandel beschäftigen, wird es sehr wichtig sein, dass das evidenzbasierte Denken bei unseren Gesetzgebern die Regel ist und nicht die Ausnahme."
Es werde immer Politiker geben, die gegen wissenschaftliche Erkenntnisse zu Felde ziehen. Ebenso würden Politiker versuchen, ihre Überzeugungen wissenschaftlich zu verpacken. Der Grund: Wissenschaft habe größeres Gewicht als bloße Ideologie, sagt Tyler. Deswegen werde etwa Trump Wissenschaftler ins Feld schicken, um eigene Erkenntnisse über den Klimawandel zu produzieren, die der Einschätzung des Weltklimarats widersprechen. Die Aufgabe der politischen Institutionen müsse es sein, derartige Versuche zu entlarven. Dafür brauche es eine funktionierende wissenschaftliche Politikberatung.
"Wir sehen auch, dass es ein sehr hohes Interesse an wissenschaftlichen Themen gibt, dass es ein sehr großes Verständnis gibt zum Beispiel dafür, dass Wissenschaft unterschiedliche Positionierungen hat."
Und kaum ein Politiker wird heute vergessen darauf hinzuweisen, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen, auf welcher Evidenz also seine Politik basiert.
"In diesen hochpolitischen Fragen wird Politik die wissenschaftlichen Beweise immer übertrumpfen. Aber immerhin haben die Politiker im Hinterkopf, dass diese Evidenz irgendwie in die politischen Prozesse einfließen sollte. Und wenn wir uns in den kommenden Jahren mit grundlegenden Fragen wie Ungleichheit, der Zukunft von Arbeit oder Klimawandel beschäftigen, wird es sehr wichtig sein, dass das evidenzbasierte Denken bei unseren Gesetzgebern die Regel ist und nicht die Ausnahme."
Es werde immer Politiker geben, die gegen wissenschaftliche Erkenntnisse zu Felde ziehen. Ebenso würden Politiker versuchen, ihre Überzeugungen wissenschaftlich zu verpacken. Der Grund: Wissenschaft habe größeres Gewicht als bloße Ideologie, sagt Tyler. Deswegen werde etwa Trump Wissenschaftler ins Feld schicken, um eigene Erkenntnisse über den Klimawandel zu produzieren, die der Einschätzung des Weltklimarats widersprechen. Die Aufgabe der politischen Institutionen müsse es sein, derartige Versuche zu entlarven. Dafür brauche es eine funktionierende wissenschaftliche Politikberatung.
Skepsis nehme nicht zu, werde aber radikaler artikuliert
Doch damit ist nicht ausgeschlossen, dass auch Wissenschaft vom mitunter hitzigen Diskurs beeinträchtigt wird. Dafür hat Anna Leuschner von der Leibniz Universität Hannover erste Anzeichen gefunden. Die Philosophin beobachtet vor allem die Debatte um den Klimawandel. Die Skepsis nehme zwar nicht zu, werde aber radikaler artikuliert. Mitunter würden Wissenschaftler direkt angegriffen.
"Das Problem, das sich da auftut, ist, dass solche Fälle von Wissenschaftlern, die so in der Öffentlichkeit unter Beschuss geraten sind, eben einfach eine bestimmte Atmosphäre schaffen, in der die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in dieser Disziplin tätig sind, sich fürchten müssen, sich mit bestimmten Themen zu befassen, oder Hypothesen mit dem Nachdruck zu vertreten, den sie für angemessen halten."
Deshalb hätten Wissenschaftler erklärt, dass sie Daten eher konservativ auswerteten und ihre Schlüsse zurückhaltender zögen. Das bedeutet: Nicht nur in der Umsetzung, sondern bereits in der Entstehung politisch relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse verändert sich die Auseinandersetzung bereits.
"Das Problem, das sich da auftut, ist, dass solche Fälle von Wissenschaftlern, die so in der Öffentlichkeit unter Beschuss geraten sind, eben einfach eine bestimmte Atmosphäre schaffen, in der die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in dieser Disziplin tätig sind, sich fürchten müssen, sich mit bestimmten Themen zu befassen, oder Hypothesen mit dem Nachdruck zu vertreten, den sie für angemessen halten."
Deshalb hätten Wissenschaftler erklärt, dass sie Daten eher konservativ auswerteten und ihre Schlüsse zurückhaltender zögen. Das bedeutet: Nicht nur in der Umsetzung, sondern bereits in der Entstehung politisch relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse verändert sich die Auseinandersetzung bereits.
Aber wie klar lässt sich beides eigentlich trennen? Zunächst sind Politik und Wissenschaft zwei unterschiedliche gesellschaftliche Systeme; das eine sucht Macht, das andere Wissen. Aber so sauber auseinanderzuhalten sei es nicht, sagt Philosophieprofessor Stefan Gosepath von der Freien Universität Berlin. Die Wertung beginne schon, wenn Wissenschaftler ihre Fragen formulierten.
"Diese Bewertungen haben mit den Evidenzen und der reinen Wissenschaft eigentlich nichts zu tun. Dann werden die Evidenzen erhoben, dann wird das Experiment gemacht, dann wird die Hypothese bestätigt oder nicht. Und dann geht es sofort darum, Schlussfolgerungen zu ziehen, in welchem Maße ist die Hypothese bestätigt worden, inwieweit kann man das Ergebnis generalisieren, und da gehen schon wieder Wertungen ein. Und natürlich auch, was heißt das jetzt für eine Umsetzung in Medikamente, in Politik, in Stromversorgung, in Wirtschaft - da gehen natürlich meistens auch politische Meinungen ein."
Ein Rückblick zeigt: Ganz wertfrei war die Wissenschaft schon im 19. Jahrhundert nicht, als Naturforscher begannen, gesellschaftlich von sich reden zu machen. Lehrstühle für Naturwissenschaften wurden geschaffen. Es seien zum ersten Mal Experten aufgetreten, die nur noch für ihr Fachgebiet sprechen konnten, sagt der Wissenschaftshistoriker Claus Spenninger von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und diese Experten seien von Anfang an politisch gewesen.
"Das wird vor allem sehr deutlich um die Mitte des 19. Jahrhunderts, 1848/49 bricht die Revolution in Europa aus, kommt auch nach Deutschland, und in diesem Zuge politisieren sich zahlreiche Naturwissenschaftler. Sie sehen — oder zumindest stilisieren sie es so — eine Verbindung zwischen demokratischen politischen Ideen und ihrer Forschung bezüglich der Gesetzmäßigkeiten der Natur."

"Scientists should be on tap, not on top"
Auch als die Revolution niedergeschlagen war, hätten Naturwissenschaftler sich weiter Gehör verschafft, in dem sie etwa populärwissenschaftliche Bücher schrieben, voller gesellschaftspolitischer Forderungen. Schon im 19. Jahrhundert habe es nicht die Politik auf der einen Seite gegeben und die objektive und unschuldige Naturwissenschaft auf der anderen, sagt Spenninger. Damals kam auch zum ersten Mal ein Sinnspruch auf, der später Winston Churchill zugeschrieben wurde: "Scientists should be on tap, not on top." Wissenschaftler sollten der Politik und Gesellschaft zur Verfügung stehen, aber nie die Oberhand gewinnen.
Chris Tyler vom University College London.
"Die perfekte politische Entscheidung gibt es nicht. Irgendwer wird immer verlieren. Der Politiker muss herausfinden, welcher Weg politisch am wenigsten Schaden anrichtet. Und er muss begründen, warum er sich so entschieden hat. Es wäre eine Katastrophe, wenn man solch einen komplexen Entscheidungsprozess allein Wissenschaftlern überlassen würde. Die wären dafür nicht zu gebrauchen."
Wissenschaftler dürften sich nicht in die Rolle der Legislative drängen lassen. Und Politiker müssten akzeptieren, dass Wissenschaftler stets auch ihr Nichtwissen und ihre Unsicherheiten mitsamt ihren Ergebnissen präsentierten — zumindest, wenn sie ihre Sache gut machten.
Chris Tyler vom University College London.
"Die perfekte politische Entscheidung gibt es nicht. Irgendwer wird immer verlieren. Der Politiker muss herausfinden, welcher Weg politisch am wenigsten Schaden anrichtet. Und er muss begründen, warum er sich so entschieden hat. Es wäre eine Katastrophe, wenn man solch einen komplexen Entscheidungsprozess allein Wissenschaftlern überlassen würde. Die wären dafür nicht zu gebrauchen."
Wissenschaftler dürften sich nicht in die Rolle der Legislative drängen lassen. Und Politiker müssten akzeptieren, dass Wissenschaftler stets auch ihr Nichtwissen und ihre Unsicherheiten mitsamt ihren Ergebnissen präsentierten — zumindest, wenn sie ihre Sache gut machten.

Allerdings kranke das Verhältnis von Politik und Wissenschaft gerade daran, sagt Paul Cairney, Politikprofessor im schottischen Stirling: Politik lasse wenig Platz für Unsicherheiten, die im wissenschaftlichen Prozess eigentlich üblich seien.
"Wenn sich ein Wissenschaftler auf die Politik einlässt, weiß er, dass es ihm nicht weiterhilft, wenn er seine Unsicherheiten preisgibt. Seine Wettbewerber werden jeden Mangel an Überzeugung ausnutzen. Wenn wissenschaftliche Institutionen wissenschaftliche Evidenz in der Politik diskutieren, legen sie sich viel eindeutiger fest als sonst. Sie sind weniger bereit nachzugeben, weil sie wissen, dass einige alles gegen sie auslegen würden."
Cairney hat ein Buch über die evidenzbasierte Politik geschrieben, die in Großbritannien vor allem unter Labour-Premierminister Tony Blair an Boden gewann. Das Versprechen: Nicht beliebige politische Ideologie sollte die Grundlage der Politik sein, sondern belastbare Fakten, die die besten Ergebnisse fürs Land ermöglichen sollten. "What counts is what works", lautete der Slogan. Es zählt das, was funktioniert. Dahinter steckt ein frommer Wunsch: Wenn man nur genug Informationen darüber hat, wie eine politische Entscheidung wirkt, könnten sich selbst soziale Probleme ohne politische Verwerfungen lösen lassen. Cairney sagt: Evidenzbasierte Politik sei nicht viel mehr als eine Parole.
"Häufig benutzen Regierungen den Begriff evidenzbasierte Politik, um damit auszudrücken, dass die Probleme, mit denen sie es zu tun haben, technisch und wissenschaftlich seien. Sie sagen gerne: ‚Evidenz statt Ideologie‘. Aber das stimmt einfach nicht. Es kommt selten vor, dass Regierungen ausschließlich wissenschaftliche Beweise berücksichtigen. Außerdem wird das Ideal der evidenzbasierten Politikgestaltung dem weniger befriedigenden politischen Prozess gegenübergestellt."
"Wenn sich ein Wissenschaftler auf die Politik einlässt, weiß er, dass es ihm nicht weiterhilft, wenn er seine Unsicherheiten preisgibt. Seine Wettbewerber werden jeden Mangel an Überzeugung ausnutzen. Wenn wissenschaftliche Institutionen wissenschaftliche Evidenz in der Politik diskutieren, legen sie sich viel eindeutiger fest als sonst. Sie sind weniger bereit nachzugeben, weil sie wissen, dass einige alles gegen sie auslegen würden."
Cairney hat ein Buch über die evidenzbasierte Politik geschrieben, die in Großbritannien vor allem unter Labour-Premierminister Tony Blair an Boden gewann. Das Versprechen: Nicht beliebige politische Ideologie sollte die Grundlage der Politik sein, sondern belastbare Fakten, die die besten Ergebnisse fürs Land ermöglichen sollten. "What counts is what works", lautete der Slogan. Es zählt das, was funktioniert. Dahinter steckt ein frommer Wunsch: Wenn man nur genug Informationen darüber hat, wie eine politische Entscheidung wirkt, könnten sich selbst soziale Probleme ohne politische Verwerfungen lösen lassen. Cairney sagt: Evidenzbasierte Politik sei nicht viel mehr als eine Parole.
"Häufig benutzen Regierungen den Begriff evidenzbasierte Politik, um damit auszudrücken, dass die Probleme, mit denen sie es zu tun haben, technisch und wissenschaftlich seien. Sie sagen gerne: ‚Evidenz statt Ideologie‘. Aber das stimmt einfach nicht. Es kommt selten vor, dass Regierungen ausschließlich wissenschaftliche Beweise berücksichtigen. Außerdem wird das Ideal der evidenzbasierten Politikgestaltung dem weniger befriedigenden politischen Prozess gegenübergestellt."
"Wissenschaftler müssen mehr tun"
Politiker lassen sich Cairney zufolge aber seltener als behauptet von ideologischen Grundsätzen abbringen. Ein Politiker, der überzeugt davon sei, dass der Markt öffentliche Aufgaben besser regle als der Staat, lasse sich durch keine Studie vom Gegenteil überzeugen.
Wissenschaftler müssten aber auch stärker auf die Politik eingehen, fordert Chris Tyler vom University College London. Es reiche nicht, sich zu beschweren, wenn Empfehlungen nicht genau befolgt würden. Wissenschaftler dürften die Kraft der öffentlichen Meinung nicht unterschätzen und müssten damit umgehen lernen, dass diese für gewählte Politiker oft ebenso wichtig sei wie wissenschaftliche Evidenz.
"Wissenschaftler müssen mehr tun. Sie müssen sicherstellen, dass ihre politisch relevante Arbeit besser im politischen Prozess zur Geltung kommt. Ich weiß aber auch, dass Forscher in ihrem wissenschaftlichen Rahmen arbeiten, der es ihnen nicht gerade dankt, wenn sie viel Zeit dafür aufwenden, um politischen Entscheidungsträgern dabei zu helfen, klügere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das muss sich ändern."
Aber auch dann würden Politiker wie andere Menschen ihre Entscheidung zum Teil rational und zum Teil emotional fällen, sagt Politologe Paul Cairney. Tatsächlich schenkten Politiker wissenschaftlichen Erkenntnissen viel weniger Beachtung als sie behaupteten. Dafür gebe es einen einfachen Grund: Die meisten Politiker verwenden mehr Zeit auf Machtvermehrung oder -erhalt denn auf Wissensvermehrung. Wissenschaft aber, so Cairney, produziere so viel Evidenz, dass jeder Volksvertreter zu Auswahlstrategien greife.
Wissenschaftler müssten aber auch stärker auf die Politik eingehen, fordert Chris Tyler vom University College London. Es reiche nicht, sich zu beschweren, wenn Empfehlungen nicht genau befolgt würden. Wissenschaftler dürften die Kraft der öffentlichen Meinung nicht unterschätzen und müssten damit umgehen lernen, dass diese für gewählte Politiker oft ebenso wichtig sei wie wissenschaftliche Evidenz.
"Wissenschaftler müssen mehr tun. Sie müssen sicherstellen, dass ihre politisch relevante Arbeit besser im politischen Prozess zur Geltung kommt. Ich weiß aber auch, dass Forscher in ihrem wissenschaftlichen Rahmen arbeiten, der es ihnen nicht gerade dankt, wenn sie viel Zeit dafür aufwenden, um politischen Entscheidungsträgern dabei zu helfen, klügere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das muss sich ändern."
Aber auch dann würden Politiker wie andere Menschen ihre Entscheidung zum Teil rational und zum Teil emotional fällen, sagt Politologe Paul Cairney. Tatsächlich schenkten Politiker wissenschaftlichen Erkenntnissen viel weniger Beachtung als sie behaupteten. Dafür gebe es einen einfachen Grund: Die meisten Politiker verwenden mehr Zeit auf Machtvermehrung oder -erhalt denn auf Wissensvermehrung. Wissenschaft aber, so Cairney, produziere so viel Evidenz, dass jeder Volksvertreter zu Auswahlstrategien greife.
Gewohnheit, Bauchgefühl und ein Gespür für politische Stimmungen
"Politiker suchen also nach einer Möglichkeit, wie sie das meiste einfach ignorieren können. Manchmal beziehen sie ihre Informationen in erster Linie von Leuten oder Instituten, die sie kennen, bestimmte Experten etwa. Manchmal verlassen sie sich aber auch einfach auf ihre Gewohnheiten, ihr Gespür oder ihr Bauchgefühl. Man kann das, negativ betrachtet, Voreingenommenheit nennen — oder, positiv betrachtet, einen ziemlich effizienten Weg um festzulegen, wem und was man seine Aufmerksamkeit schenkt."
Gewohnheit, Bauchgefühl und ein Gespür für politische Stimmungen — die dürften auch für Verkehrsminister Andreas Scheuer die ersten Ratgeber gewesen sein, als er bei der Debatte über die Luftverschmutzung in die Empörung über Grenzwerte einstimmte. Dass er damit viel Aufmerksamkeit erregte, sei aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, sagt Chris Tyler.
"Das war auch deswegen eine Nachricht wert, gerade weil er die wissenschaftliche Evidenz ignoriert hat. Und das ist gut, daran können wir uns festhalten: Er hat gegen die kulturelle Erwartung verstoßen, dass wissenschaftliche Evidenz ernst genommen werden sollte."
Der Politik empfiehlt Tyler, sich auf die Wissenschaft einzulassen. Ihre Ergebnisse seien nach den vielen Tests und Qualitätskontrollen immerhin näher an "der Wahrheit" als jedes andere Wissen.
Gewohnheit, Bauchgefühl und ein Gespür für politische Stimmungen — die dürften auch für Verkehrsminister Andreas Scheuer die ersten Ratgeber gewesen sein, als er bei der Debatte über die Luftverschmutzung in die Empörung über Grenzwerte einstimmte. Dass er damit viel Aufmerksamkeit erregte, sei aber nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen, sagt Chris Tyler.
"Das war auch deswegen eine Nachricht wert, gerade weil er die wissenschaftliche Evidenz ignoriert hat. Und das ist gut, daran können wir uns festhalten: Er hat gegen die kulturelle Erwartung verstoßen, dass wissenschaftliche Evidenz ernst genommen werden sollte."
Der Politik empfiehlt Tyler, sich auf die Wissenschaft einzulassen. Ihre Ergebnisse seien nach den vielen Tests und Qualitätskontrollen immerhin näher an "der Wahrheit" als jedes andere Wissen.