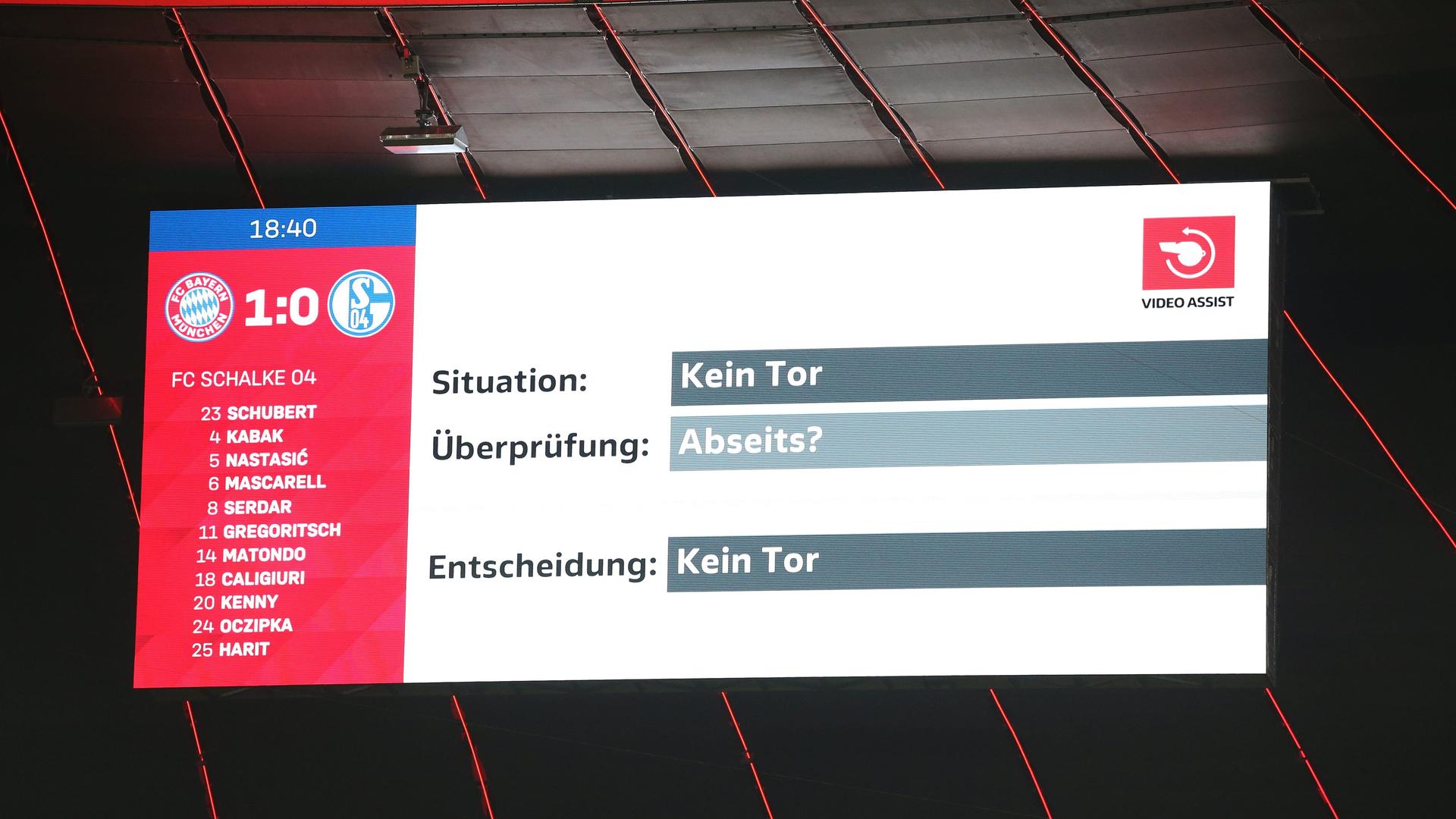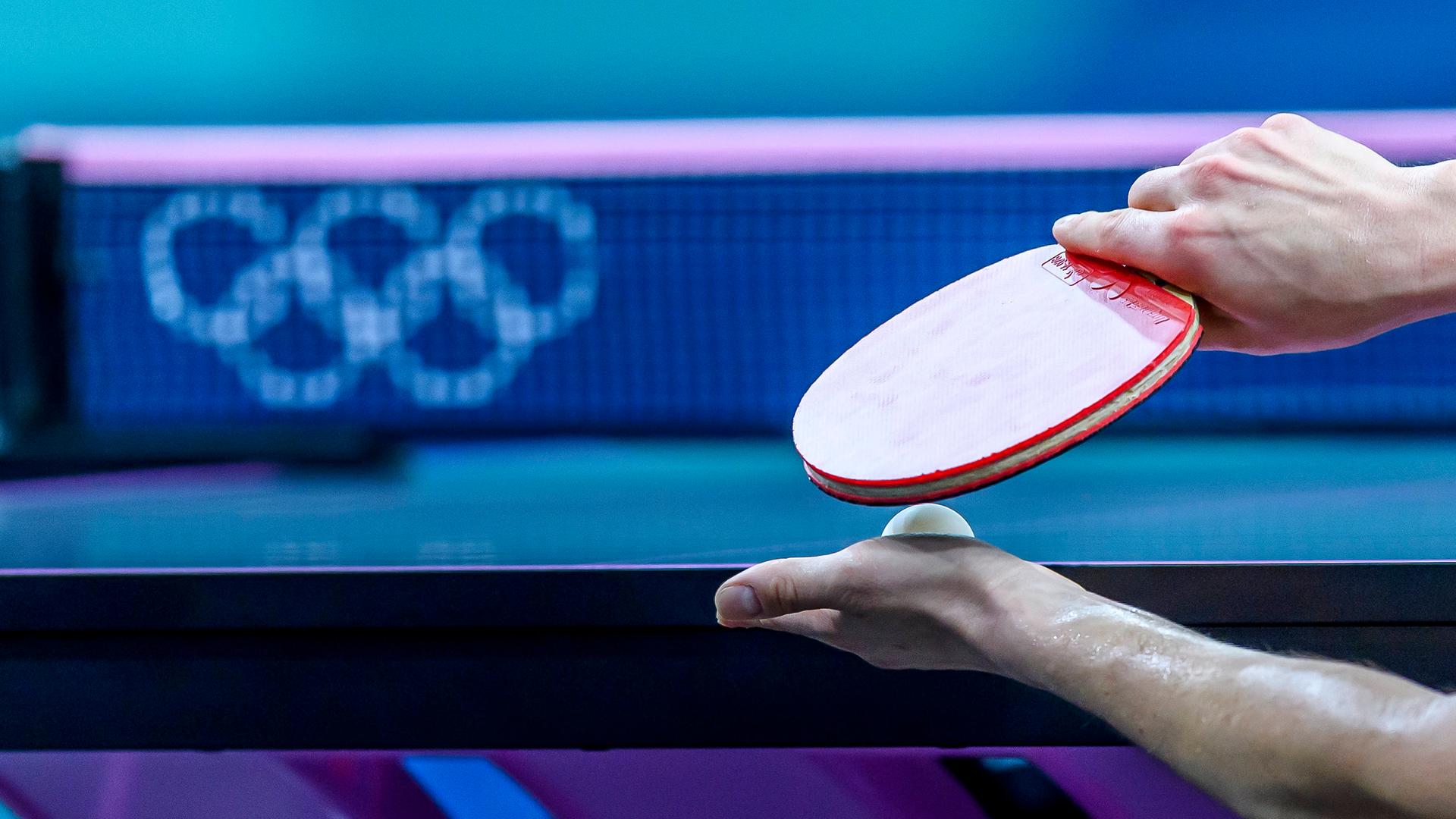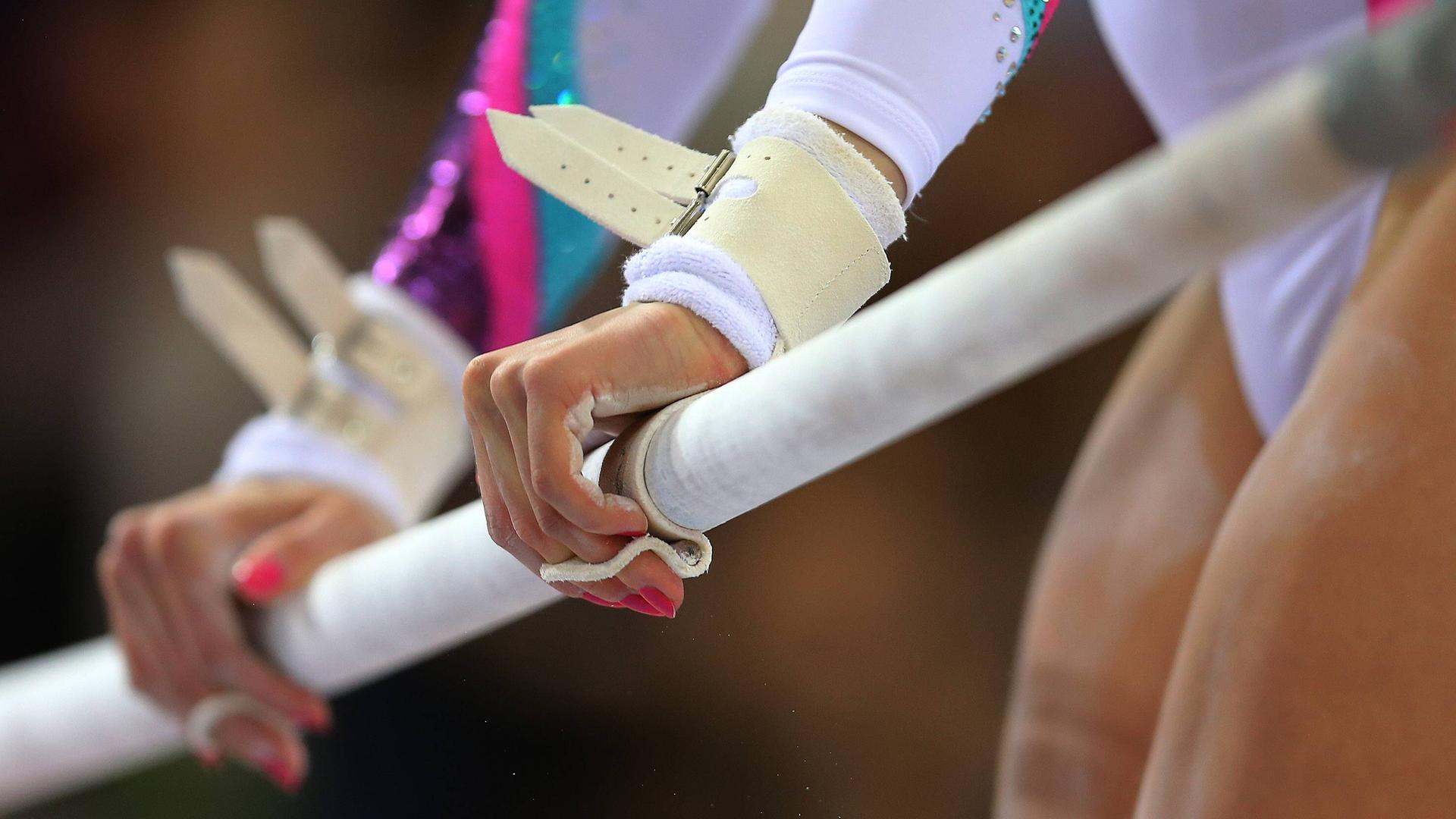Die Angst vor dem Coming Out - für viele vor allem schwule Profi-Sportler in der Vergangenheit der Hauptgrund, die eigene sexuelle Orientierung geheim zu halten und sich erst nach der Profi-Karriere zu outen. Viele haben Angst vor den Reaktionen der Mitspieler in einer vermeintlich homophoben Sportlandschaft. Der Australier Josh Cavallo hat trotzdem den Schritt gewagt und sich vor zwei Wochen als Fußball-Profi geoutet. Die Reaktionen seiner Mitspieler war aber ausschließlich positiv. Diese Erfahrung, die Josh Cavallo gemacht hat, haben auch viele andere homo-, bisexuelle oder transidentitäre junge Menschen gemacht. In einer Studie an amerikanischen High Schools und Universitäten haben über 95 Prozent aller jungen Athlet*innen angegeben, dass es nach ihrem Coming Out nur positive Reaktionen gegeben hat. Eric Anderson von der University of Winchester und Leiter der Studie, ist das keine Überraschung. Ein Coming Out sei heutzutage einfach "kein großes Ding mehr", sagte Anderson im Dlf.
Lesen Sie hier das vollständige Interview im Wortlaut.
Raphael Späth: Waren Sie überrascht von den Ergebnissen?
Eric Anderson: Ich war kein bisschen überrascht. Für mich war es eine dieser Studien, bei denen man sich denkt: Haben die wirklich dafür eine Studie gebraucht, um das herauszufinden? Für mich war es eine dieser Studien. Ich beschäftige mich jetzt schon seit zwei Jahrzehnten mit diesem Thema und der einzige Grund, weshalb ich jetzt diese tiefgründige und ausführliche Studie durchgeführt habe, bei der wir wirklich aktiv auf Schulen zugegangen sind, um LGBTQ*-Athletinnen und Athleten zu finden, ist nur, weil die Medien immer noch ständig darüber berichten, wie homophob der Sport doch sei.
Es gibt andere Studien, die über die Erfahrungen von ungeouteten Athlet*innen oder älteren Menschen berichten, die den Sport natürlich als unfassbar homophobes Umfeld darstellen. Aber ich habe viel recherchiert und war mir sicher, dass das absolut nicht der Fall ist. Also war dieses Ergebnis für mich überhaupt keine Überraschung.
"Als ich ein Kind war, war Homosexualität nicht akzeptabel"
Späth: Glauben Sie, dass sie die gleichen Ergebnisse erhalten hätten, wenn sie die Studie vor zwanzig Jahren durchgeführt hätten? Oder gibt es einen Generationen-Unterschied, was die Akzeptanz von LGBTQ*-Personen und vor allem LGBTQ*-Athlet*innen angeht?
Anderson: Es gibt einen wahnsinnigen Generationen-Unterschied. 1993 habe ich mich als erster High School-Trainer in den USA geoutet. Und im Zuge meines Coming Outs gab es viele symbolische, aber auch tatsächliche Gewalt. In diesen Zeiten waren schwule Männer, vor allem im Teamsport, Ausgestoßene und es gab viele Anfeindungen.
Aber seit dem Jahr 2000 hat sich die Einstellung vor allem gegenüber homosexuellen Menschen stark verbessert und diese Einstellung verbessert sich von Jahr zu Jahr. Die gesellschaftliche Akzetanz von Homosexuellen hat sich seit Mitte der 90er-Jahre verbessert. Und das nicht nur in Amerika, sondern in der gesamten westlichen Welt. Und für die jüngere Generation hat sich das komplett verändert.
Als ich ein Kind war, war Homosexualität nicht akzeptabel. Heutzutage ist es Homophobie, die nicht akzeptabel ist. Es gab also einen massiven Umschwung. Und für uns davon auszugehen, dass sich die Jugendkultur weg entwickelt hat von der Homophobie, die Athletinnen und Athleten aber nicht - das macht einfach keinen Sinn. Warum sollte ein 16-Jähriger, der in einer Schule mit homosexuellen Freunden aufwächst, in einem Umfeld, in dem Homophobie nicht toleriert wird, warum sollte er dann in einem Sportteam auf einmal homophob sein? Das macht einfach keinen Sinn.
Also: In dieser Hinsicht hat es einen massiven generationsbedingten Wandel gegeben. Es ist nicht mehr zeitgemäß, Teamsport oder Athlet*innen als homophob darzustellen. Das ist inzwischen ein immer noch aktives Vorurteil.
"Angst vor dem Coming Out ist schon seit langem nicht mehr die Realität"
Späth: Aber auch heutzutage gibt es noch Studien, die beweisen, dass eine in fünf LGBTQ*-Personen immer noch aus Angst vor Diskriminierung darauf verzichtet, den Sport auszuüben, für den er oder sie sich interessiert. Sind das inzwischen unbegründete Ängste?
Anderson: Ja. Und das ist der Punkt, auf den sich viele Studien zuletzt fokussiert haben: Sie haben die Ängste von Menschen untersucht. Aber Ängste bilden nicht die Realität ab. Und die Angst vor dem Coming Out ist schon seit langem nicht mehr die Realität. Wenn sich Menschen jetzt outen, beschreiben viele, wie sich ihre mentale Gesundheit danach verbessert hat. Und wenn Athlet*innen sich outen, liefern sie danach bessere Leistungen ab.
Ich habe das jetzt seit Jahrzehnten untersucht und das sind tatsächlich nachweisbare Tatsachen. Also: Das, was manche Leute vorstellen, stimmt nicht mit dem überein, was wirklich passiert. Wenn Menschen sich im Sport outen, werden sie von ihren Teamkollegen akzeptiert. Heutzutage ist das gar kein großes Thema mehr. Vor zehn Jahren wurde ein Coming Out immer groß von anderen Menschen gefeiert, um ihre Akzeptanz zu zeigen. Aber heutzutage muss das niemand mehr machen, weil Akzeptanz fast schon vorausgesetzt wird. Deshalb sind Coming Outs heutzutage keine große Sache mehr – und deshalb habe ich in der Umfrage auch die Option "neutral" bei der Frage angegeben, wie die eigene Coming Out-Erfahrung war. Und die Realität ist: Sich heutzutage zu outen, ist ein neutrales Statement.
Als ob man sagen würde, dass man in Wahrheit schwarze Haare hat. Es ist einfach kein großes Ding mehr. Und es ist wirklich wichtig hervorzuheben, dass die fünf Prozent, die keine gute Coming-Out-Erfahrung angegeben haben, kein einziges Mal körperlich angegangen wurden deshalb. Kein einziges Mal gab es Gewalt bei den über Tausend Coming-Out-Erfahrungen, die wir untersucht haben.
"Die Menschen wollen so inklusiv wie möglich sein"
Späth: Wir haben jetzt viel über Homophobie gesprochen, aber die LGBTQ*-Community besteht natürlich nicht nur aus Homo- und Bisexuellen, sondern auch aus trans* Personen. Da geht es natürlich nicht um sexuelle Orientierung, sondern um Geschlechtsidentität. Und das ist, vor allem in den USA, ein kontroverseres Thema. In vielen Staaten in den USA wird gerade debattiert, ob Gesetze geändert werden sollen, die es trans* Jugendlichen verbieten, an Wettbewerben im Schul- oder Collegesport teilzunehmen. Hatten trans* Athlet*innen in ihrer Studie ähnliche Erfahrungen wie homosexuelle?
Anderson: Ja, hatten sie. Die Erfahrungen waren etwas schlechter: Etwa sieben Prozent haben angegeben, schlechte Coming-Out-Erfahrungen gemacht zu haben. Das Problem ist: Von den 875 Personen, die wir befragt haben, waren nur ungefähr 30 transidentitär. Also: Die Anzahl an trans* Athlet*innen im Vergleich zu homo- oder bisexuellen war sehr sehr niedrig. Daraus jetzt allgemeingültige Schlüsse zu ziehen, ist schwierig. Aber die Realität ist: Die Erfahrungen waren ähnlich.
Und das sagt mir: Diese Debatten über Toiletten und Umkleidekabinen, die in den USA geführt werden, sind politische Argumente, mit denen sich die Jugendlichen heutzutage eigentlich gar nicht mehr beschäftigen. Wir sprechen hier ja nicht über ein olympisches oder professionelles Niveau. Sondern es geht um Schulsport. Die Menschen wollen so inklusiv wie möglich sein. Diese Debatten, die in den USA teilweise geführt werden, sind also nichts weiter als ein Sturm im Wasserglas.
Späth: Aber es gibt auch einige College- und High-School Athletinnen in den USA, vor allem im Individualsport wie in der Leichtathletik zum Beispiel, die jetzt vor Gericht dagegen vorgehen, dass trans* Mädchen gegen sie antreten dürfen, weil sie einen unfairen Vorteil hätten.
Anderson: Ja, davon gibt es ein paar Fälle. Aber es gibt über 3000 Universitäten in den USA, wahrscheinlich hunderttausende High Schools. Und wir hören nur von diesen sehr seltenen, speziellen Fällen. Die Realität ist: Für den Großteil der Jugend ist das einfach kein Problem. Vielleicht in diesen einzelnen Fällen, aber auch diese Klagen wegen eines angeblichen unfairen Vorteils sind schwierig. Es gibt nämlich noch keine wissenschaftlichen Beweise dafür.
Also wissen wir nicht wirklich, ob es einen Vorteil gibt und wie groß er tatsächlich ist. Also glaube ich nicht, dass diese Klagen wirklich erfolgreich sein werden, wenn die Wissenschaft nicht hinter ihnen steht.
"Schwule Männer interessieren sich einfach mehr für ästhetische Sportarten"
Späth: Was für mich auch noch sehr interessant an den Ergebnissen Ihrer Studie war: Über 30 Prozent aller LGBTQ* Athlet*innen haben angegeben, dass der Zuspruch und die Unterstützung, die sie von ihren Mitspielerinnen und Mitspielern erhalten haben, größer war als der des restlichen schulischen Umfeldes. Würden Sie sagen, dass Sport in der Schule und im College inzwischen sogar ein Safe Space für queere Menschen ist?
Anderson: Absolut. Wir haben diese Frage auch eingeschlossen, weil ich nicht mehr hören konnte, wie homophob doch der Sport sei. Es scheint immer noch salonfähig zu sein, den Sport so schlechtzureden. Und wir scheinen zu vergessen, dass, wenn wir so etwas sagen, eigentlich implizieren, dass es die Athletinnen und Athleten sind, die homophob sind. Aber hinter diesen Mannschaften stecken reale Menschen.
Und wir haben das Fehlen von geouteten Menschen in ein paar Macho-Sportarten wie Fußball, Football, Basketball oder Eishockey als Beweis dafür genommen, um den Sport als homophob abzustempeln. Aber das ist sehr naiv zu sagen. Schwule Männer sind einfach weniger an diesen Sportarten interessiert als heterosexuelle. Schwule Männer interessieren sich einfach mehr für ästhetische Sportarten. Schwule Männer sind ohnehin eine Minderheit, wir machen circa drei Prozent der Bevölkerung aus. Und wenn wir im Tanz, in der Musik, im Theater, Eiskunstlaufen oder Turmspringen überrepräsentiert sind, dann müssen wir zwangsläufig in anderen Sportarten unterrepräsentiert sein. Und es ist klar, dass, auch wenn sich einige schwule Männer diese Sportarten interessieren, der Großteil der Schwulen sich nicht dafür interessiert.
Viele machen den Fehler und fragen mich: Eric, wenn Sport doch so schwulenfreundlich ist, wo sind dann die ganzen schwulen Sportler? Und ich sage dann: Sie sind im Eiskunstlaufen, im Turmspringen, im Turnen, in all diesen Sportarten. Also: Nur weil Schwule sich nicht für Fußball interessieren, heißt das nicht im Umkehrschluss, dass heterosexuelle Fußballer homophober sind als alle anderen auch.