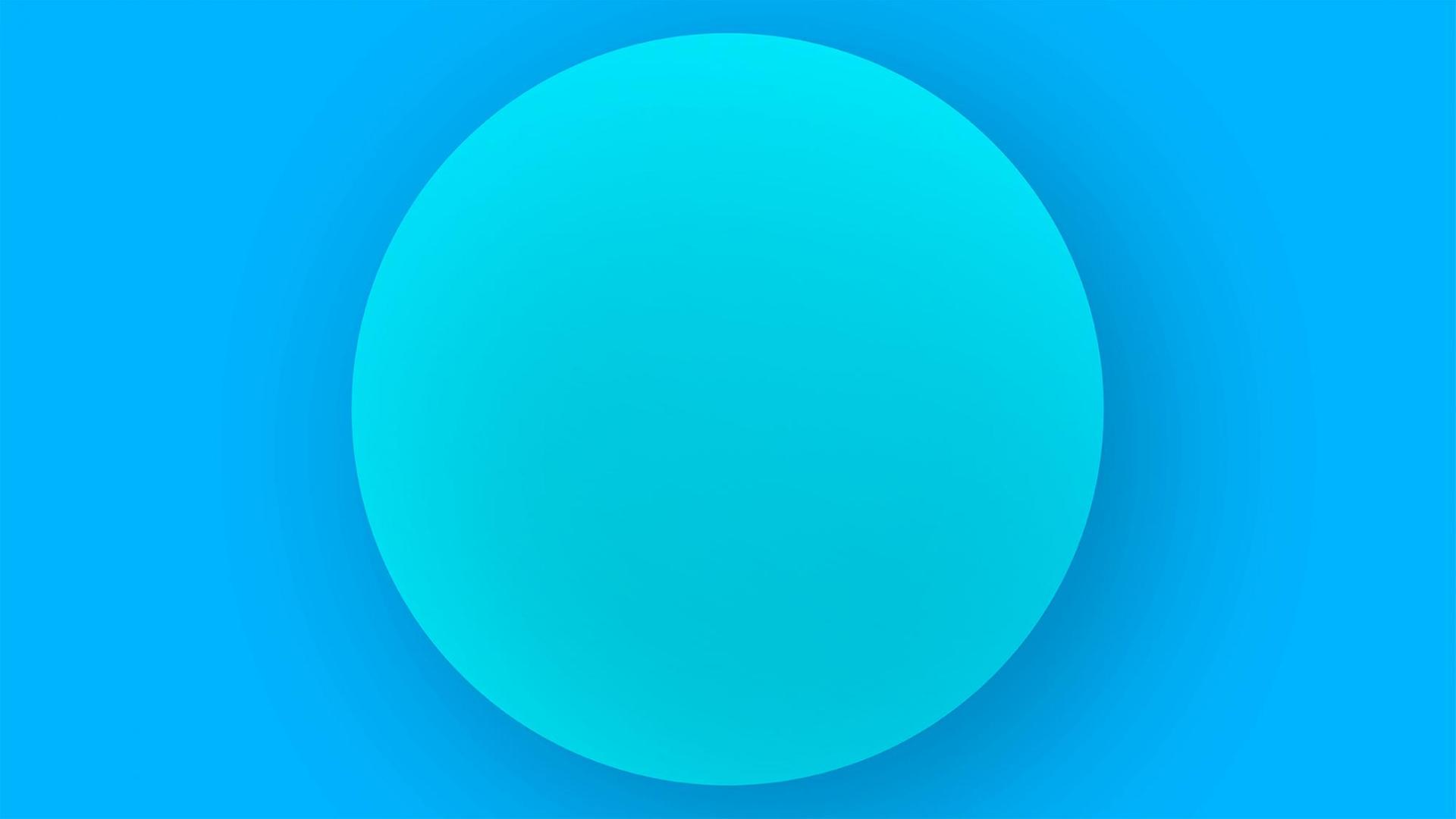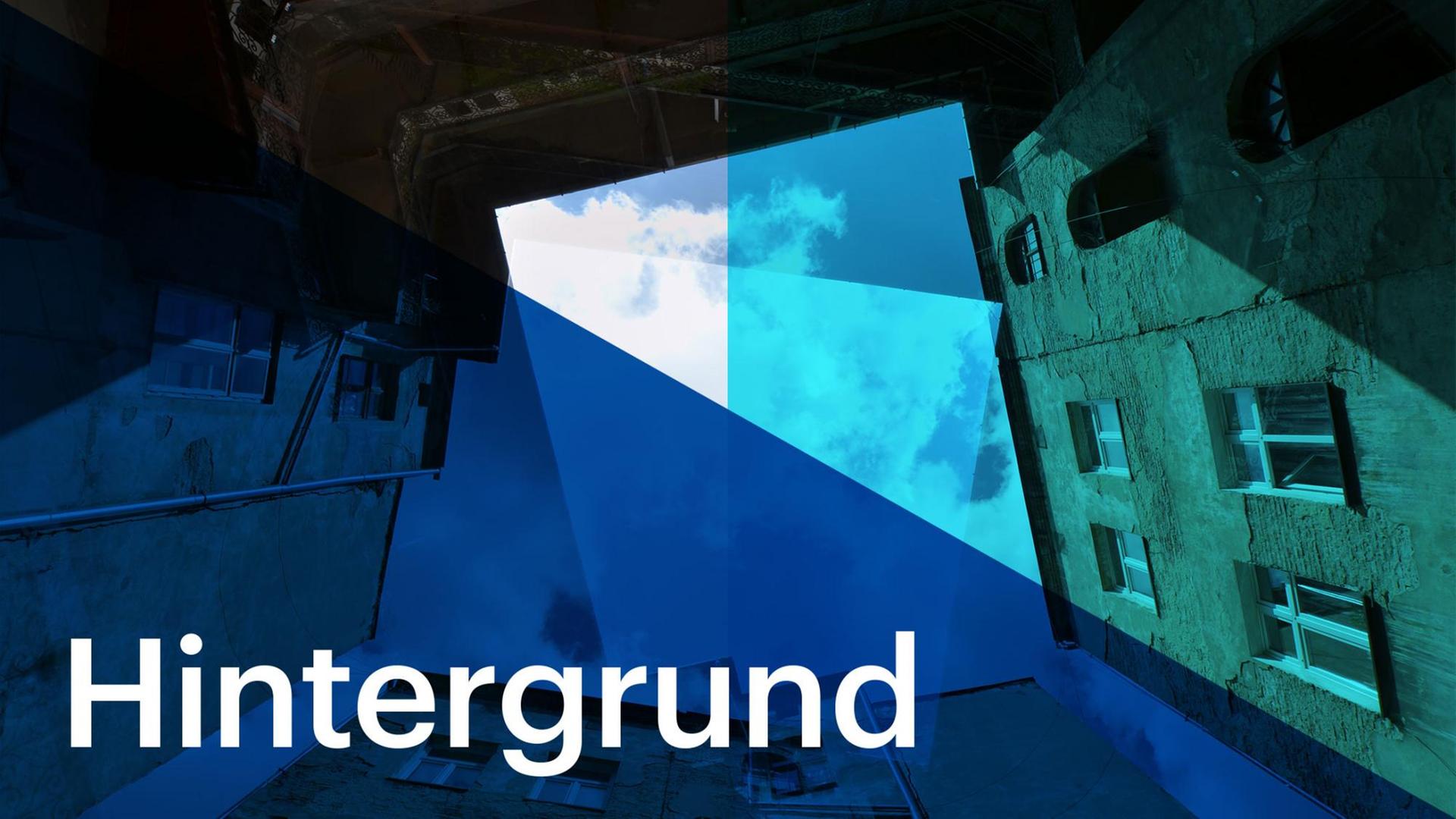Claudine wuchs auf einem der unzähligen Hügel im südlichen Ruanda auf. Sie ging sonntags mit den anderen aus dem Dorf zur Kirche, und wenn sie nicht zur Schule musste, hütete sie die Kühe der Familie. Eine friedliche Kindheit auf dem Lande.
Sie ist neun Jahre alt, als das große Morden beginnt. Gegen ein Uhr nachts wird sie von ihrem Großvater geweckt. Sie müssen fliehen. „Ich war mit Verwandten und meinen Geschwistern zusammen", erinnert sie sich. "Wir waren etwa acht Familien. Wir nahmen die Kühe mit. Die Schweine ließen wir zurück.“
Mörderbanden durchstreifen das Land
Der Grund, warum sie alle sterben sollen: Sie gehören zur Volksgruppe der Tutsi. Mörderbanden der Hutu durchstreifen das Land. Im Dorf waren die Hutu vorher friedliche Nachbarn - jetzt sind sie zu tödlichen Feinden geworden.
In den ersten Tagen gelingt es Claudines Eltern, die Familie zusammenzuhalten. Doch dann kommt ein Hubschrauber, Soldaten schießen um sich, das Kind wird von Mutter und Vater getrennt. Claudine irrt umher, durch den Wald, vorbei an brennenden Hütten und Häusern und leblosen Körpern am Wegesrand. Sie schließt sich anderen Kindern an, flieht nach Burundi und überlebt. Wie ihre Eltern starben, weiß sie nicht.
Ruanda kennt unzählige Schicksale wie das von Claudine. Beim Genozid in Ruanda ermordeten Extremisten der Hutu-Mehrheit 1994 zwischen 800.000 und einer Million Menschen. In rund hundert Tagen sorgten sie in dem ostafrikanischen Land für ein beispielloses Blutvergießen. Die meisten Opfer waren Tutsi, aber auch gemäßigte Hutu wurden getötet. Das Massaker endete erst, als die Rebellen der „Ruandischen Patriotischen Front“ (RPF) im Juli 1994 die Hutu-Milizen besiegten.
Radiosender riefen zur Vernichtung der Tutsi auf
Auslöser war am 6. April 1994 der bis heute ungeklärte Abschuss des Flugzeugs des autoritären Präsidenten Juvénal Habyacrimana, der zur Hutu-Volksgruppe gehörte. Noch in derselben Nacht begann das Abschlachten. Die Massaker waren von langer Hand vorbereitet. Seit Monaten waren Macheten an Hutu-Milizen verteilt worden. Radiosender riefen zur Vernichtung der Tutsi auf, Milizen erhielten Todeslisten.

Schon lange vorher war das Land ein Pulverfass gewesen. Dabei wurde der vermeintliche Rassenkonflikt zwischen den Hutu-Ackerbauern und den Tutsi-Viehzüchtern erst von den deutschen Kolonialherren und später von den belgischen Nachfolgern angefacht, die gezielt die Tutsi-Minderheit als vermeintlich herrschende Schicht förderten.
Noch unter belgischer Kolonialherrschaft verübten Hutu 1959 erste Massaker an den Tutsi. Tausende flohen nach Uganda. Mit der Unabhängigkeit 1962 gelangten dann die Hutu an die Macht. Vor allem die sogenannte erste Republik in Ruanda (1962-1973) war von Mordwellen an Tutsi, Flucht und Vertreibung geprägt. Im Gedächtnis der Hutu wiederum blieb ein Tutsi-Massaker von 1972 an den Hutu im Nachbarland Burundi haften.
„Ein Völkermord ist ein langwieriges Projekt"
„Ein Völkermord ist ein langwieriges Projekt. Man muss mobilisieren, man muss einen Prozess schaffen, der dieses absolute Verbrechen innerhalb einer Gesellschaft möglich macht, die eigentlich nicht fähig sein sollte, ein solches Monster zu gebären“, sagt die Soziologin und Psychologin Assumpta Mugiraneza.
Assumpta sieht drei wirkmächtige Narrative, die den Massenmord in den Köpfen der Ruander vorbereiteten. Erstens eine Mentalität von Gehorsam und Disziplin. Zweitens das Märchen von einer existenziellen Bedrohung: Angeblich wollten die Tutsi die Hutu-Mehrheit auslöschen, dem müsse man zuvorkommen. Und schließlich Dämonisierung und Entmenschlichung: Tutsi wurden als Kakerlaken bezeichnet, als Schlangen, als Unkraut. Radiosender verbreiteten täglich den Hass.
Warnungen vor dem drohenden Genozid
Die internationale Gemeinschaft ignorierte die Krise lange, obwohl der Kommandeur der UN-Truppen in Ruanda vor einem drohenden Genozid warnte. Der kanadische General Roméo Dallaire hatte schon vor Beginn des Mordens eine massive Aufstockung seiner Truppe auf 4500 Soldaten gefordert. Außerdem ein Mandat, das den Einsatz von militärischer Gewalt erlaubte. Dallaire war davon überzeugt, den drohenden Völkermord dadurch verhindern zu können. Doch der UN-Sicherheitsrat verweigerte beides.
Dallaire gab nicht auf und bat Kofi Annan, der damals für die UN-Friedensmissionen zuständig war und wenige Jahre später zum Generalsekretär der Vereinten Nationen aufstieg, um die Erlaubnis, die Waffenlager der Hutu-Milizen auszuheben. Vergebens: „Innerhalb weniger Stunden kam die Antwort, dass ich keine Erlaubnis habe, dass es nicht meinem Mandat entspreche und dass ich die gesamte Mission gefährden würde.“
Eine Rebellenarmee erobert Kigali
Während die Zahl der Toten stieg, wurde die UN-Truppe immer kleiner. Am 21. April 1994, rund zwei Wochen nach Beginn der Massaker, beschloss der UN-Sicherheitsrat, die Friedenstruppe in Ruanda auf 500 Mann zu reduzieren.
Statt der Vereinten Nationen handelte dann eine Rebellenarmee geflohener Tutsi. Die Ruandische Patriotische Front (RPF) eroberte das Land in einem kurzen, aber heftigen Bürgerkrieg. Am 4. Juli 1994 marschierte die RPF in der Hauptstadt Kigali ein und beendete so den Völkermord.
Nach dem Sieg der RPF übernahm Rebellenchef Paul Kagame die Macht im Land. Er verordnete einen Versöhnungskurs. Täter mussten sich vor Dorfgerichten, den sogenannten Gacacas, verantworten.

Über eine Million Fälle wurden von den rund 11.000 Dorfgerichten verhandelt - ein historisch einmaliges Experiment, das weltweit Beachtung fand. Bei den Versammlungen ging es nicht nur um Strafe für die Mörder, sondern auch um Reue und Versöhnung.
Dorfgerichte für die „einfachen“ Täter und Mitläufer
Die Dorfgerichte waren für die „einfachen“ Täter und Mitläufer bestimmt. Organisatoren und Drahtzieher des Völkermords wurden hingegen vor ein internationales Tribunal gestellt. Noch immer wird nach Verantwortlichen des Völkermords gefahndet, die sich ins Ausland absetzten.
Paul Kagame regiert bis heute und wird für seinen autoritären Regierungsstil kritisiert. Es gibt kaum Opposition oder kritische Medien. Von den rund 13 Millionen Einwohnern sind geschätzte 80 bis 85 Prozent Hutu, zehn Prozent Tutsi. Offiziell werden die Volksgruppen nicht mehr unterschieden.

Täter und Opfer leben wieder Tür an Tür. Viele Tatorte sind als Gedenkstätten hergerichtet - mit aufgeschichteten Schädeln und Knochen, die mahnen, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Doch wie lange wird es dauern, bis eine Gesellschaft einen dermaßen brutalen Zivilisationsbruch verarbeitet hat?
Traumata und psychische Narben
Inzwischen weiß man, dass Traumata, die psychischen Narben, auch genetisch von Generation zu Generation weitervererbt werden können. In Ruanda, das unvergleichlich stark von solchen Traumata gezeichnet ist, wären landesweit eine Vielzahl von psychiatrischen und psychotherapeutischen Behandlungsangeboten notwendig, um die Wunden zu heilen. Doch es gibt gerade mal zwei Dutzend Psychiater.
Nach einer Untersuchung leiden etwa ein Viertel der Ruander und Ruanderinnen unter Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das sind 3,3 Millionen Menschen. Ein Bericht zur mentalen Gesundheit, veröffentlicht vom zuständigen Ministerium, zeichnet ebenfalls ein düsteres Bild: Depressionen, sexualisierte Gewalt, Kindesmissbrauch und Alkoholismus sind weitverbreitet.
Auch Claudine wurde immer wieder von Albträumen überwältigt. Der Anblick der Toten, der Geruch von Blut hat sich tief in ihr Gedächtnis eingebrannt. Selbstmordgedanken quälten sie, vor allem in den dunklen Stunden der Nacht. In ihrem Heimatdorf nannte man sie nur Umusazi, die Verrückte. Wenn ihr jemand zu nahekam, schrie und fluchte sie.
Erfolge einer Therapie: das Feld bestellen
Doch Claudine hatte Glück und traf eine Traumatherapeutin. Seit der Therapie kann sie wieder besser mit anderen umgehen, ihr Feld bestellen. Wenn die quälenden Erinnerungen wiederkommen, macht Claudine jetzt Übungen, die ihr die Therapeutin gezeigt hat. Sie umfasst mit der rechten Hand nacheinander die Finger der linken. Dabei verkörpert jeder Finger eine andere positive Aussage, die sie stärken soll.
„Ich will nach Gottes Willen leben“, sagt Claudine. „Ich lebe in Frieden mit anderen. Ich erlebe Freude mit meiner Familie.“ Claudine sagt, grundsätzlich gehe es ihr inzwischen gut. Die meisten Nachbarn, auch die Hutu, seien freundlich zu ihr.