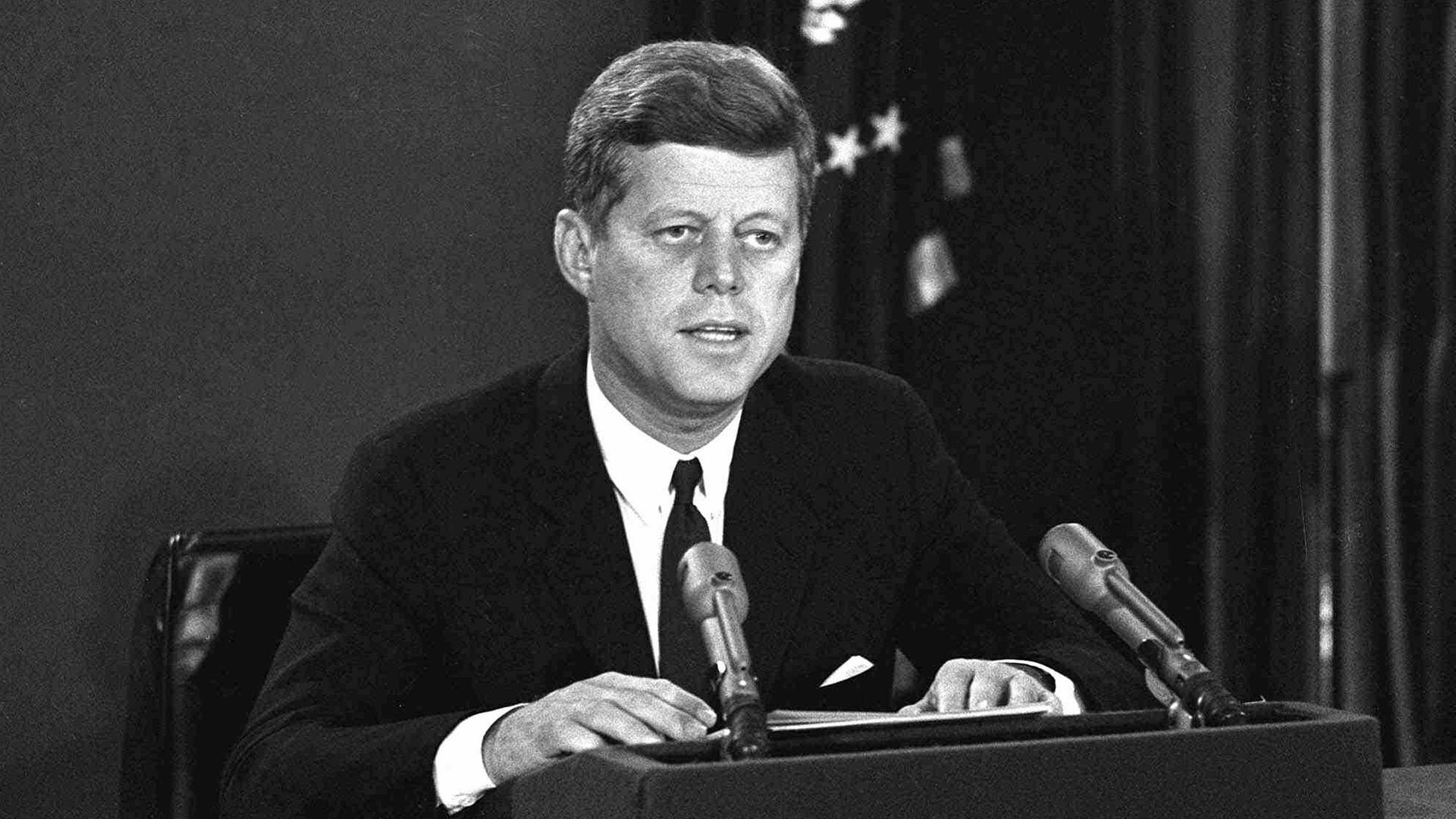"A shadow has fallen upon the scenes so lately lighted by the Allied victory. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the Continent. The Communist parties, which were very small in all these Eastern States of Europe, have been raised to pre-eminence and power far beyond their numbers and are seeking everywhere to obtain totalitarian control. Police governments are prevailing in nearly every case, and so far, except in Czechoslovakia, there is no true democracy."
Was der vormalige britische Premierminister Winston Churchill im März 1946 im amerikanischen Städtchen Fulton so einprägsam beschrieb, war das Eingeständnis, dass die Welt ein Jahr nach dem gewonnenen Krieg in zwei Hälften gespalten war, geteilt durch einen eisernen Vorhang.
Der Kalte Krieg sollte für die folgenden mehr als 40 Jahre die Weltpolitik prägen. Das Hamburger Institut für Sozialforschung hat sich seit einigen Jahren systematisch dem Kalten Krieg gewidmet, den Krisen, der Angst, den Stellvertreterkriegen und nun der Ökonomie. Bernd Greiner, Christian Müller und Claudia Weber vom Hamburger Institut für Sozialforschung haben den Tagungs-Band "Ökonomie im Kalten Krieg" herausgegeben.
Claudia Weber formuliert die zentrale Frage, die allen 24 Einzelstudien innewohnt:
"Wir haben diese Frage, was geschah während des Kalten Krieges und was geschah durch den Kalten Krieg, also welche wirtschaftlichen Entwicklungen sind besonders auf den ideologisch bedingten Wirtschaftswettbewerb des Kalten Krieges zurückzuführen, ganz zentral in den Vordergrund gerückt. Und das ist natürlich immer ein bisschen 'counterfactual history' - also: Was wäre gewesen, wenn ...?"
Es geht um die finanziellen Kosten der Rüstung, um die Folgekosten der wahnwitzigen Umweltzerstörungen, um Ost-West-Handel im Kalten Krieg und, ganz zentral, um "Soll und Haben in der Dritten Welt". Denn auch die, die zwischen Ost und West standen, waren Schauplatz des alles überformenden Konflikts: Die Sowjetunion und die USA leisteten Entwicklungshilfe, gewährten Kredite und lieferten Waffen und Industrie-Anlagen. Dabei konzentrierten sie sich fast ausschließlich auf Regionen von geostrategischer Bedeutung: den Nahen Osten und Südasien.
So floss beispielsweise 1983 die Hälfte der amerikanischen Entwicklungshilfe in nur zwei Länder: Ägypten und Israel. Zwar versuchten die Supermächte, Staaten ganz auf ihre jeweilige Seite zu ziehen, jedoch gelang dies angesichts selbstbewusster nationaler Eliten nur selten. Vielmehr sahen sich die Supermächte oft instrumentalisiert, so Bernd Greiner in seinem Vorwort:
"Eben, weil die "Starken" in vielfältiger Weise manipulierbar waren, ist eine "Tyrranei der Schwachen" zu beobachten. Überraschend oft wedelte der Schwanz mit dem Hund."
Die Sowjetunion bot der Dritten Welt meist prestigeträchtige, aber oft untaugliche Großprojekte und militärische Unterstützung an. Politisch-militärische Erwägungen dominierten immer den ökonomischen Sachverstand. So gerieten die Empfängerländer mitunter in die gleiche wirtschaftliche Schieflage wie das Geberland selbst, die Sowjetunion.
Die USA setzten noch mehr als die Sowjetunion auf Militärhilfe und Rüstungsexporte; günstige Kredite waren immer auch Mittel, Märkte für amerikanische Exporte zu öffnen oder den Import wichtiger Rohstoffe zu sichern. Amerikanische "Entwicklungshilfe" beförderte aber auch den Hunger in der Welt: So trieb beispielsweise die Hochzinspolitik des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan die weltweite Verschuldung der Dritten Welt in absurde Höhen; Lebensmittelimporte wurden so unmöglich.
Der subventionierte Export amerikanischer Getreideüberschüsse - auch dies war Entwicklungshilfe - schadete parallel der Landwirtschaft der Importländer, schreibt der amerikanische Politikwissenschaftler Earl Conteh-Morgan in seinem Aufsatz über die US-Entwicklungshilfe:
"Die amerikanische Auslandshilfe diente weitgehend als Waffe, um den Sowjetkommunismus einzudämmen, Einfluss in den Entwicklungsländern zu kaufen und insbesondere der sowjetischen Wirtschaftshilfe entgegenzuwirken. Sie diente dazu, befreundete Regime zu stützen; sie war nicht darauf ausgerichtet, Armut und Korruption zu bekämpfen."
Das Buch bezeugt zudem mit vielfältigen Beispielen die Blindheit der beiden Supermächte, die immer wieder glaubten, anderen Staaten ihre Ideologie oder ihre mechanistische Modernisierungslehre überstülpen zu können.
Erhellend sind auch die Betrachtungen darüber, wie sich der Kalte Krieg auf die Supermächte selbst ausgewirkt hat. In den USA erkennen die Autoren ein "military remapping" - eine wirtschaftliche Umgestaltung der Landkarte - durch den Kalten Krieg: wie etwa das Silicon Valley, das im Westen des Landes entstand. Millionen Dollar an Forschungsgeldern flossen zudem in die Universitäten. Ein Modernisierungsschub ging durchs Land.
Gleichzeitig war beim sowjetischen Kontrahenten die Rüstungsindustrie durchaus innovativ und brachte durch Exporte Devisen ein - sie war jedoch ähnlich ineffizient wie die Zivilwirtschaft. Die Rüstungsausgaben verschlangen einen viel höheren Anteil am Bruttosozialprodukt als in den USA.
Der texanische Wirtschaftswissenschaftler Paul Gregory kommt zu dem Ergebnis, dass das Wirtschaftswachstum in der UdSSR ohne den Kalten Krieg nur um einen Prozentpunkt höher ausgefallen wäre.
Gleichwohl: Der Kalte Krieg war ein schlechtes Geschäft für alle Beteiligten, so Claudia Weber vom Hamburger Institut für Sozialforschung:
"Military Remapping ging natürlich mit immensen Umweltschäden einher. Also, der Preis für wirtschaftliche Entwicklung, für Modernisierung war immens hoch. Dann relativieren sich auch durchaus die ökonomischen Ergebnisse des Kalten Kriegs - die relativieren sich angesichts der Umweltschäden."
Die Beseitigung radioaktiver Kontaminierung im Umfeld der US-Nuklearanlagen wird 250 Milliarden Dollar kosten, 20.000 Orte sind mit giftigen Chemikalien verseucht, Millionen Blindgänger liegen auf Testgeländen, Zigtausende Menschen wurden skrupellos hohen Strahlendosen ausgesetzt. Auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion sieht es noch schlimmer aus.
Weitere Kapitel drehen sich um das US-Handelsembargo gegen den Ostblock und China, die CoCom-Liste und das Erdgas-Röhren-Embargo Anfang der 80er Jahre. Anfangs seien sie noch erfolgreich gewesen, später hätten die USA eher sich selbst und ihren Verbündeten geschadet, so das Fazit
Der umfangreiche Band zur Ökonomie des Kalten Krieges liefert einen kritischen und vorurteilsfreien Blick auf die USA und die Sowjetunion und beantwortet viele Fragen. Zudem lädt seine klare Struktur zum kapitelweisen Lesen ein und überrascht den Leser nicht nur mit der Antwort auf die Frage, ob der Westen die Sowjetunion tatsächlich totgerüstet hat:
"Wäre Gorbatschow ein junger und energischer Breschnew und nicht er selbst gewesen, könnte sich die Sowjetunion heute auf dem kubanisch-nordkoreanischen Weg befinden."
Bernd Greiner, Christian Müller und Claudia Weber (Hrsg.): "Ökonomie im Kalten Krieg", Hamburger Edition erschienen, 528 Seiten, 35 Euro.
Was der vormalige britische Premierminister Winston Churchill im März 1946 im amerikanischen Städtchen Fulton so einprägsam beschrieb, war das Eingeständnis, dass die Welt ein Jahr nach dem gewonnenen Krieg in zwei Hälften gespalten war, geteilt durch einen eisernen Vorhang.
Der Kalte Krieg sollte für die folgenden mehr als 40 Jahre die Weltpolitik prägen. Das Hamburger Institut für Sozialforschung hat sich seit einigen Jahren systematisch dem Kalten Krieg gewidmet, den Krisen, der Angst, den Stellvertreterkriegen und nun der Ökonomie. Bernd Greiner, Christian Müller und Claudia Weber vom Hamburger Institut für Sozialforschung haben den Tagungs-Band "Ökonomie im Kalten Krieg" herausgegeben.
Claudia Weber formuliert die zentrale Frage, die allen 24 Einzelstudien innewohnt:
"Wir haben diese Frage, was geschah während des Kalten Krieges und was geschah durch den Kalten Krieg, also welche wirtschaftlichen Entwicklungen sind besonders auf den ideologisch bedingten Wirtschaftswettbewerb des Kalten Krieges zurückzuführen, ganz zentral in den Vordergrund gerückt. Und das ist natürlich immer ein bisschen 'counterfactual history' - also: Was wäre gewesen, wenn ...?"
Es geht um die finanziellen Kosten der Rüstung, um die Folgekosten der wahnwitzigen Umweltzerstörungen, um Ost-West-Handel im Kalten Krieg und, ganz zentral, um "Soll und Haben in der Dritten Welt". Denn auch die, die zwischen Ost und West standen, waren Schauplatz des alles überformenden Konflikts: Die Sowjetunion und die USA leisteten Entwicklungshilfe, gewährten Kredite und lieferten Waffen und Industrie-Anlagen. Dabei konzentrierten sie sich fast ausschließlich auf Regionen von geostrategischer Bedeutung: den Nahen Osten und Südasien.
So floss beispielsweise 1983 die Hälfte der amerikanischen Entwicklungshilfe in nur zwei Länder: Ägypten und Israel. Zwar versuchten die Supermächte, Staaten ganz auf ihre jeweilige Seite zu ziehen, jedoch gelang dies angesichts selbstbewusster nationaler Eliten nur selten. Vielmehr sahen sich die Supermächte oft instrumentalisiert, so Bernd Greiner in seinem Vorwort:
"Eben, weil die "Starken" in vielfältiger Weise manipulierbar waren, ist eine "Tyrranei der Schwachen" zu beobachten. Überraschend oft wedelte der Schwanz mit dem Hund."
Die Sowjetunion bot der Dritten Welt meist prestigeträchtige, aber oft untaugliche Großprojekte und militärische Unterstützung an. Politisch-militärische Erwägungen dominierten immer den ökonomischen Sachverstand. So gerieten die Empfängerländer mitunter in die gleiche wirtschaftliche Schieflage wie das Geberland selbst, die Sowjetunion.
Die USA setzten noch mehr als die Sowjetunion auf Militärhilfe und Rüstungsexporte; günstige Kredite waren immer auch Mittel, Märkte für amerikanische Exporte zu öffnen oder den Import wichtiger Rohstoffe zu sichern. Amerikanische "Entwicklungshilfe" beförderte aber auch den Hunger in der Welt: So trieb beispielsweise die Hochzinspolitik des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan die weltweite Verschuldung der Dritten Welt in absurde Höhen; Lebensmittelimporte wurden so unmöglich.
Der subventionierte Export amerikanischer Getreideüberschüsse - auch dies war Entwicklungshilfe - schadete parallel der Landwirtschaft der Importländer, schreibt der amerikanische Politikwissenschaftler Earl Conteh-Morgan in seinem Aufsatz über die US-Entwicklungshilfe:
"Die amerikanische Auslandshilfe diente weitgehend als Waffe, um den Sowjetkommunismus einzudämmen, Einfluss in den Entwicklungsländern zu kaufen und insbesondere der sowjetischen Wirtschaftshilfe entgegenzuwirken. Sie diente dazu, befreundete Regime zu stützen; sie war nicht darauf ausgerichtet, Armut und Korruption zu bekämpfen."
Das Buch bezeugt zudem mit vielfältigen Beispielen die Blindheit der beiden Supermächte, die immer wieder glaubten, anderen Staaten ihre Ideologie oder ihre mechanistische Modernisierungslehre überstülpen zu können.
Erhellend sind auch die Betrachtungen darüber, wie sich der Kalte Krieg auf die Supermächte selbst ausgewirkt hat. In den USA erkennen die Autoren ein "military remapping" - eine wirtschaftliche Umgestaltung der Landkarte - durch den Kalten Krieg: wie etwa das Silicon Valley, das im Westen des Landes entstand. Millionen Dollar an Forschungsgeldern flossen zudem in die Universitäten. Ein Modernisierungsschub ging durchs Land.
Gleichzeitig war beim sowjetischen Kontrahenten die Rüstungsindustrie durchaus innovativ und brachte durch Exporte Devisen ein - sie war jedoch ähnlich ineffizient wie die Zivilwirtschaft. Die Rüstungsausgaben verschlangen einen viel höheren Anteil am Bruttosozialprodukt als in den USA.
Der texanische Wirtschaftswissenschaftler Paul Gregory kommt zu dem Ergebnis, dass das Wirtschaftswachstum in der UdSSR ohne den Kalten Krieg nur um einen Prozentpunkt höher ausgefallen wäre.
Gleichwohl: Der Kalte Krieg war ein schlechtes Geschäft für alle Beteiligten, so Claudia Weber vom Hamburger Institut für Sozialforschung:
"Military Remapping ging natürlich mit immensen Umweltschäden einher. Also, der Preis für wirtschaftliche Entwicklung, für Modernisierung war immens hoch. Dann relativieren sich auch durchaus die ökonomischen Ergebnisse des Kalten Kriegs - die relativieren sich angesichts der Umweltschäden."
Die Beseitigung radioaktiver Kontaminierung im Umfeld der US-Nuklearanlagen wird 250 Milliarden Dollar kosten, 20.000 Orte sind mit giftigen Chemikalien verseucht, Millionen Blindgänger liegen auf Testgeländen, Zigtausende Menschen wurden skrupellos hohen Strahlendosen ausgesetzt. Auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion sieht es noch schlimmer aus.
Weitere Kapitel drehen sich um das US-Handelsembargo gegen den Ostblock und China, die CoCom-Liste und das Erdgas-Röhren-Embargo Anfang der 80er Jahre. Anfangs seien sie noch erfolgreich gewesen, später hätten die USA eher sich selbst und ihren Verbündeten geschadet, so das Fazit
Der umfangreiche Band zur Ökonomie des Kalten Krieges liefert einen kritischen und vorurteilsfreien Blick auf die USA und die Sowjetunion und beantwortet viele Fragen. Zudem lädt seine klare Struktur zum kapitelweisen Lesen ein und überrascht den Leser nicht nur mit der Antwort auf die Frage, ob der Westen die Sowjetunion tatsächlich totgerüstet hat:
"Wäre Gorbatschow ein junger und energischer Breschnew und nicht er selbst gewesen, könnte sich die Sowjetunion heute auf dem kubanisch-nordkoreanischen Weg befinden."
Bernd Greiner, Christian Müller und Claudia Weber (Hrsg.): "Ökonomie im Kalten Krieg", Hamburger Edition erschienen, 528 Seiten, 35 Euro.