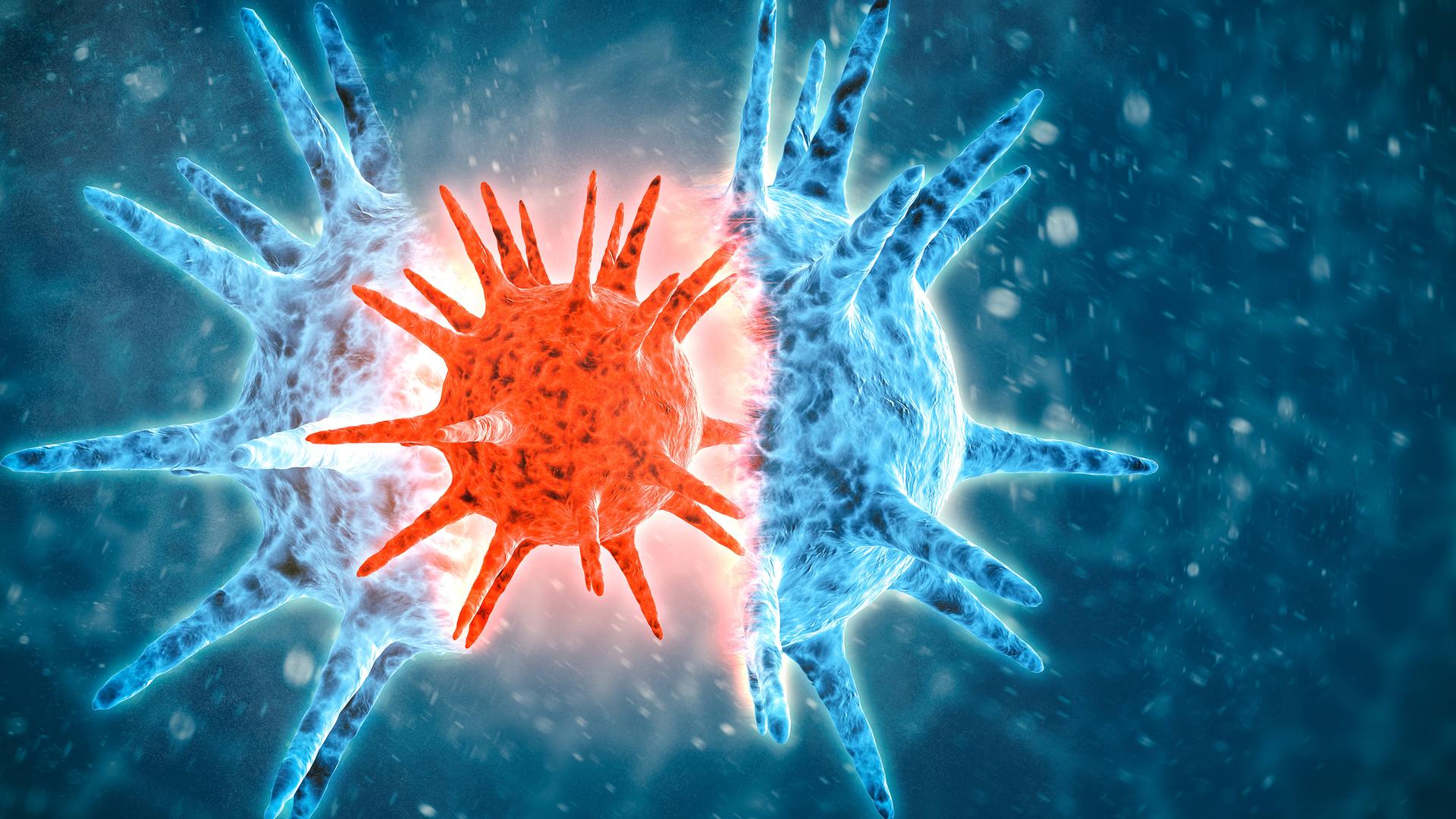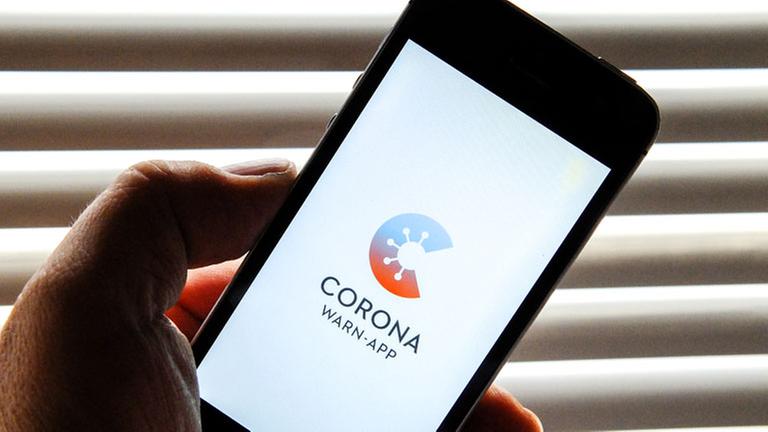Schweden Umgang mit der Coronakrise laufe "in dieselbe Richtung, mit dem selben Ziel" wie in anderen europäischen Ländern, sagte der schwedische Schriftsteller Aris Fioretos im Deutschlandfunk. Doch setze sein Land dabei auf Vertrauen und Freiwilligkeit - die meisten Leute hielten sich daran. Mit Lenins Aussage "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" sehe es im Moment so aus, als sei die ganze Welt leninistischer als Schweden, sagte Fioretos.
Natürlich gebe es auch in Schweden "Idioten", die sich in der Bar an die Theke setzten oder nicht an Abstandsregeln hielten, aber im Großen und Ganzen walte die Vernunft. Das habe historische Gründe: Schweden sei seit 450 Jahren ein zentralistisch gesteuerter Staat, der seit 200 Jahren keinen Krieg hatte - so wie viele europäische Länder.
"Wir hatten immer Vertrauen in den Staat"
Die Schweden schenkten ihren Staatsbeamten, den sogenannten Experten, großes Vertrauen. "Zurzeit sind es Mediziner, Epidemiologen, sie sorgen dafür, dass das öffentliche Gespräch sachlich orientiert bleibt." Das präge auch die mediale Berichterstattung.
Aris Fioretos weist darauf hin, dass es trügerisch sei, nur die Zahlen der Verstorbenen in verschiedenen Ländern miteinander zu vergleichen. Man müsse auch sozio-ökonomische Unterschiede mit einbeziehen. Es gebe Länder, wo Menschen auf engstem Raum lebten, Länder, wo mehrere Generationen unter einem Dach wohnten. Oder Länder wie Schweden, wo Plegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern oft wechselten, wenig verdienten und trotzdem zur Arbeit gehen müssten. Möglicherweise sei das ein Grund für die Todesraten unter älteren Menschen, die in Schweden höher seien als im Durchschnitt.
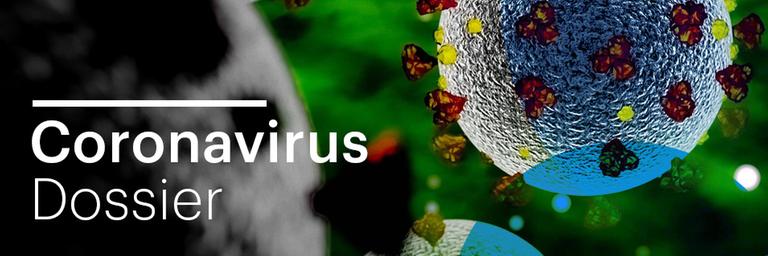
"Es gibt nicht nur Ungutes aus der Krise mitzunehmen"
Die Verzweiflung sei in seinem Land aber genauso groß wie in anderen Ländern: "Wie soll es nach der Pandemie weitergehen?" Es herrsche Frust darüber, dass die Politiker nur über die Toten sprächen, aber nicht über die Lebenden und ihre Zukunft. Das könnte nach hinten losgehen, wenn die Leute sich dauerhaft mit einer Situation anfreunden müssten, die sie weder gestalten dürften noch erzeugt hätten. Da sehe er "große Probleme auf uns alle zukommen".
Doch die Coronakrise habe seiner Überzeugung nach auch etwas Gutes: Es lasse sich jetzt nicht mehr bestreiten, dass man global etwas gegen den Klimawandel machen könne. "Niemand kann nach der Pandemie behaupten, dass es nicht möglich wäre, durch radikale Maßnahmen zum Beispiel der Umweltverschmutzung Paroli zu bieten."
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.