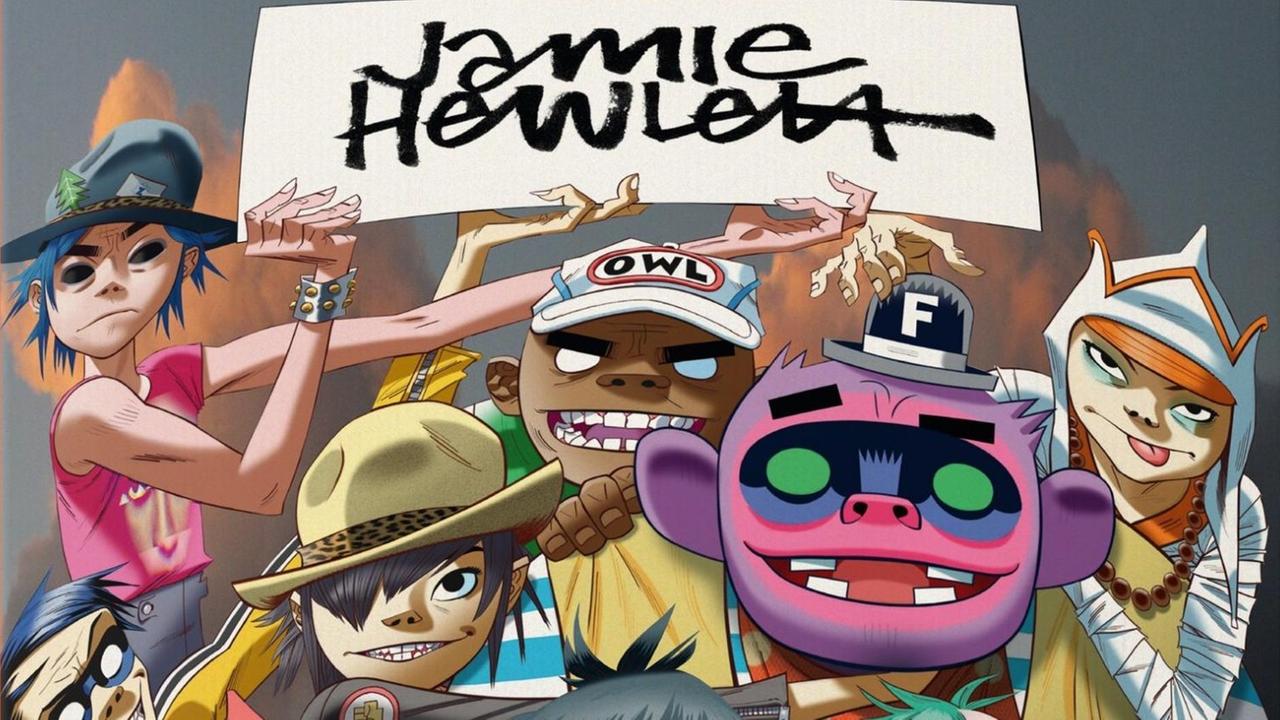Der Mond bebt. Künstlerin Moon Ribas schlägt auf Pauke und Gong, um musikalisch auszudrücken, was sie täglich wahrnimmt.
"Whenever there is an earthquake I feel a vibration. For me it has become a new sense", sagt Moon Ribas.
Ein sechster Sinn. Die 32-jährige Spanierin, die mit ihren platinblonden Haaren sowieso ein bisschen aussieht wie von einer anderen Welt, hat sich einen seismischen Sensor ins Bein implantieren lassen. Sie spürt Erschütterungen auf Erde und Mond, nennt sich selbst einen Cyborg und ihre spirituelle Trommel-Performance Cyborg Art:
"Ich wollte Bewegung auf eine andere Weise wahrnehmen. Viele Dinge, die um uns herum geschehen, können wir mit unseren limitierten Sinnen nicht wahrnehmen. Aber wir müssen nicht mehr auf die Evolution warten, damit sich das ändert. Jeder kann sich in seinem Leben durch Technik so entwickeln, wie er will, und seine eigene Wahrnehmung der Realität kreieren."
Ribas Erdbeben-Sensor ist nicht die einzige Verbesserung an ihrem Körper: Über einen Bluetooth-Zahn kann sie mit ihrem Freund kommunizieren und Implantate im Ohr lassen sie in alle Richtungen fühlen:
"Indem ich mich mit Technik verbunden habe, habe ich mehr über die Erde gelernt und festgestellt, wie lebendig sie ist und wie ignorant und unangepasst wir sind. Wir müssen nicht an unnatürliche Dinge denken, das meiste ist ja bereits da. Tiere können Licht erzeugen, fliegen, UV-Licht und infrarot wahrnehmen und es gibt sogar eine Qualle, die unsterblich ist. Meine Hoffnung ist, dass die Verbindung zwischen Mensch und Technik letztlich mehr Mitgefühl für unsere Erden und die Tiere hervorbringt."
Technologie als Hilfe, um ganz zu uns, zu unseren Ursprüngen zurückzufinden, Tech-Ökologie sozusagen - ein faszinierendes und gleichzeitig erschreckendes Gedankenspiel.
"Whenever there is an earthquake I feel a vibration. For me it has become a new sense", sagt Moon Ribas.
Ein sechster Sinn. Die 32-jährige Spanierin, die mit ihren platinblonden Haaren sowieso ein bisschen aussieht wie von einer anderen Welt, hat sich einen seismischen Sensor ins Bein implantieren lassen. Sie spürt Erschütterungen auf Erde und Mond, nennt sich selbst einen Cyborg und ihre spirituelle Trommel-Performance Cyborg Art:
"Ich wollte Bewegung auf eine andere Weise wahrnehmen. Viele Dinge, die um uns herum geschehen, können wir mit unseren limitierten Sinnen nicht wahrnehmen. Aber wir müssen nicht mehr auf die Evolution warten, damit sich das ändert. Jeder kann sich in seinem Leben durch Technik so entwickeln, wie er will, und seine eigene Wahrnehmung der Realität kreieren."
Ribas Erdbeben-Sensor ist nicht die einzige Verbesserung an ihrem Körper: Über einen Bluetooth-Zahn kann sie mit ihrem Freund kommunizieren und Implantate im Ohr lassen sie in alle Richtungen fühlen:
"Indem ich mich mit Technik verbunden habe, habe ich mehr über die Erde gelernt und festgestellt, wie lebendig sie ist und wie ignorant und unangepasst wir sind. Wir müssen nicht an unnatürliche Dinge denken, das meiste ist ja bereits da. Tiere können Licht erzeugen, fliegen, UV-Licht und infrarot wahrnehmen und es gibt sogar eine Qualle, die unsterblich ist. Meine Hoffnung ist, dass die Verbindung zwischen Mensch und Technik letztlich mehr Mitgefühl für unsere Erden und die Tiere hervorbringt."
Technologie als Hilfe, um ganz zu uns, zu unseren Ursprüngen zurückzufinden, Tech-Ökologie sozusagen - ein faszinierendes und gleichzeitig erschreckendes Gedankenspiel.
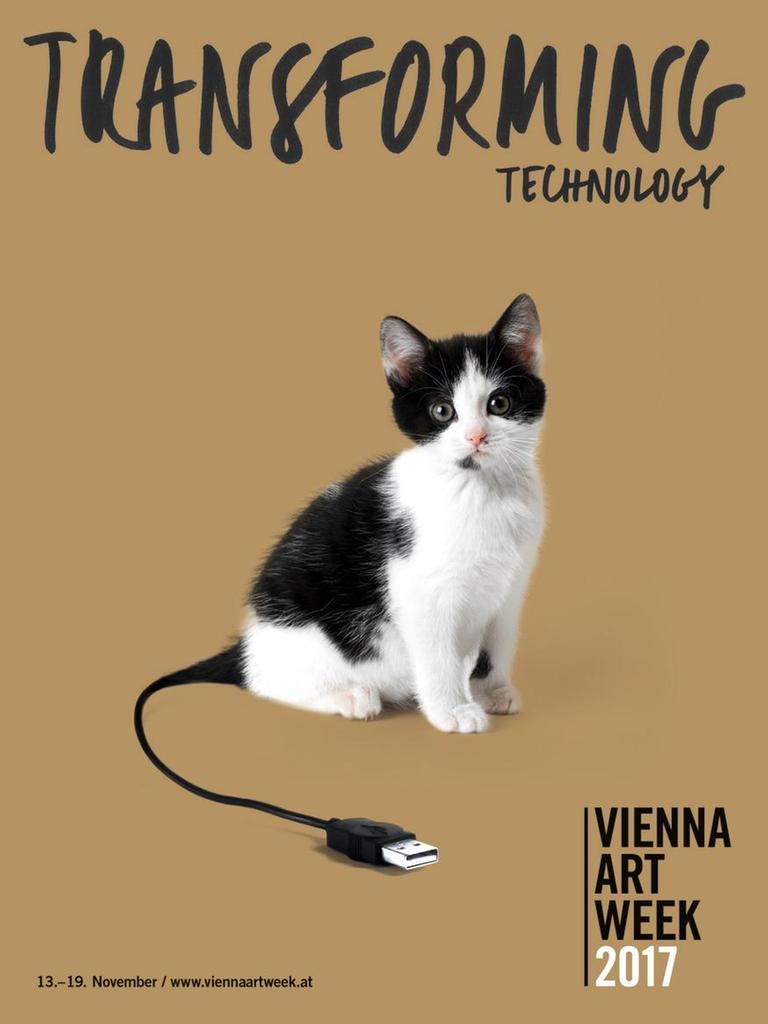
"Es bleibt nicht die Technik, sondern die Frage: Wie trifft dich das emotional?"
"Wir müssen uns der Thematik stellen. Wir müssen da aufwachen und aus dem romantischen Atelier rausgehen."
Robert Punkenhofer, Künstlerischer Leiter der Wiener "Art Week", in der viel über das Zusammenspiel von Kunst und Technik diskutiert wurde, formuliert sein Fazit:
Robert Punkenhofer, Künstlerischer Leiter der Wiener "Art Week", in der viel über das Zusammenspiel von Kunst und Technik diskutiert wurde, formuliert sein Fazit:
"Große Skepsis, wie stark da Künstler wirklich eingreifen können, zu sagen, wir haben da wirklich Einfluss auf 'Artificial Intelligence', auf 'Digital Transformation'. Gleichzeitig haben aber auch alle gesagt, dass aus künstlerischer Perspektive eine viel höhere Sensibilität da ist, was die Schattenseiten des Technologieglaubens betrifft."
Einer, der dieses Gespür mitbringt, ist der Berliner Videokünstler Stefan Panhans. In seinem neusten Kurzfilm "Freeroam" lässt er Tänzer Szenen aus dem Computerspiel "Grand Theft Auto" nachstellen. Panhans sucht die Fehler im System: Menschen, die im Loop hängen bleiben, gegen Wände laufen und sich eben gerade nicht perfekt-realistisch bewegen:
"Man nennt das ja auch das 'Uncanny Valley': KIs, Avatare und Roboter - je näher sie an reale menschliche Bewegungen und Mimiken rankommen, desto unheimlicher werden sie", sagt Panhans.
Wo hört das Analoge auf und fängt das Digitale an? Leben wir bald in einer Simulation? Oder Roboter unter uns? Fragen, die Filme wie "Matrix" oder "I, Robot" so schon vor Jahren gestellt haben. Was die künstlerischen Arbeiten unterscheidet ist ihre besondere Ästhetik und weniger die Antworten, die bislang eher spärlich ausfallen, wie auch Robert Punkenhofer zugibt:
"Das Problem mit der Technologie in der Kunst ist oft, was letztlich im Kunstwerk übrig bleibt; ist ja nicht die Technik, sondern die Frage: Wie trifft dich das emotional? Wie trifft dich das in den Bauch?"
Einer, der dieses Gespür mitbringt, ist der Berliner Videokünstler Stefan Panhans. In seinem neusten Kurzfilm "Freeroam" lässt er Tänzer Szenen aus dem Computerspiel "Grand Theft Auto" nachstellen. Panhans sucht die Fehler im System: Menschen, die im Loop hängen bleiben, gegen Wände laufen und sich eben gerade nicht perfekt-realistisch bewegen:
"Man nennt das ja auch das 'Uncanny Valley': KIs, Avatare und Roboter - je näher sie an reale menschliche Bewegungen und Mimiken rankommen, desto unheimlicher werden sie", sagt Panhans.
Wo hört das Analoge auf und fängt das Digitale an? Leben wir bald in einer Simulation? Oder Roboter unter uns? Fragen, die Filme wie "Matrix" oder "I, Robot" so schon vor Jahren gestellt haben. Was die künstlerischen Arbeiten unterscheidet ist ihre besondere Ästhetik und weniger die Antworten, die bislang eher spärlich ausfallen, wie auch Robert Punkenhofer zugibt:
"Das Problem mit der Technologie in der Kunst ist oft, was letztlich im Kunstwerk übrig bleibt; ist ja nicht die Technik, sondern die Frage: Wie trifft dich das emotional? Wie trifft dich das in den Bauch?"
Internet-Giganten schwingen sich zu den neuen Guggenheims auf
Was die Ausstellungspraxis, Museen und Kuratoren betrifft, so schwingen sich die Internet-Giganten Google, Facebook und Instagram allmählich zu den neuen Guggenheims und Medici auf. Das "Google Culture Institute" ist bereits so ein Weltmuseum im Netz mit über 50.000 Kunstwerken und bietet auch Künstlerstipendien für unter 28-Jährige mit Schwerpunkt Technik an, erklärt Mitarbeiterin Julie Boukobza:
"Die Künstler müssen keine großen Vorkenntnisse mitbringen. Sie lernen bei uns, wie sie zum Beispiel mit 3D-Animation oder Künstlicher Intelligenz umgehen."
Der Plan dahinter? Kein Plan, sagt sie. Google probiere nur aus und plane nicht mehr als drei Monate voraus. Schwer zu glauben. Klar ist, mit Kunst lässt sich Geld verdienen. Viel Geld.
Und so bleibt festzuhalten: Technik-Know-how bedeutet auch in der Kunstszene Macht, Kontrolle. Museen müssen sich vielleicht schon bald gegen die großen (Online-)Netzwerke behaupten, Künstler gegen Roboter. Bislang setzen sich eher wenige und vor allem junge Künstler aktiv mit den neuen Fragen auseinander - das künstlerische Interesse liegt mehr auf ästhetischen als inhaltlichen Aspekten. Radikale Experimente, wie Moon Ribas Cyborg Art jedenfalls, polarisieren und zeigen, was möglich ist.
"Die Künstler müssen keine großen Vorkenntnisse mitbringen. Sie lernen bei uns, wie sie zum Beispiel mit 3D-Animation oder Künstlicher Intelligenz umgehen."
Der Plan dahinter? Kein Plan, sagt sie. Google probiere nur aus und plane nicht mehr als drei Monate voraus. Schwer zu glauben. Klar ist, mit Kunst lässt sich Geld verdienen. Viel Geld.
Und so bleibt festzuhalten: Technik-Know-how bedeutet auch in der Kunstszene Macht, Kontrolle. Museen müssen sich vielleicht schon bald gegen die großen (Online-)Netzwerke behaupten, Künstler gegen Roboter. Bislang setzen sich eher wenige und vor allem junge Künstler aktiv mit den neuen Fragen auseinander - das künstlerische Interesse liegt mehr auf ästhetischen als inhaltlichen Aspekten. Radikale Experimente, wie Moon Ribas Cyborg Art jedenfalls, polarisieren und zeigen, was möglich ist.
Die "Vienna Art Week" findet vom 13. bis 19.11.2017 statt.