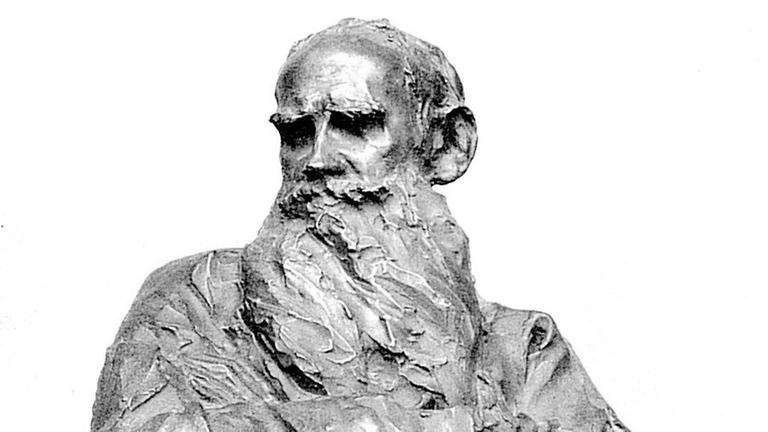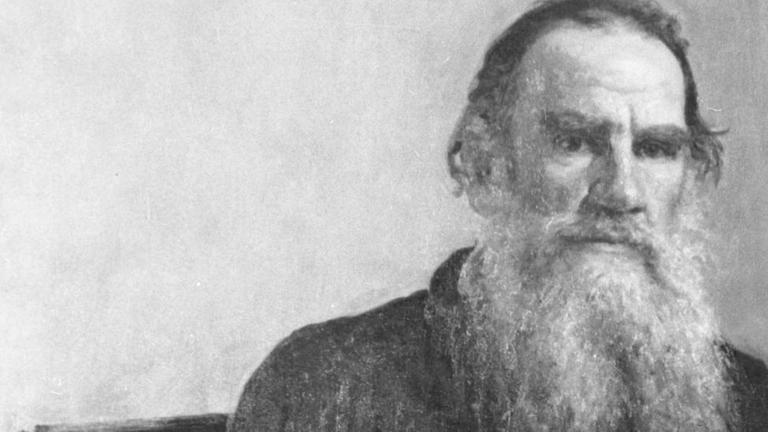
Aus der fernen Zeit des Jahres 1909, in einem verrauschten Tondokument, erreicht uns leise die Stimme Lew Tolstois: "Man sage, der Mensch sei nicht frei, weil alles, was er mache, einen bestimmten Grund in der Vergangenheit habe. Aber der Mensch handle immer nur in der Gegenwart. Die Gegenwart liege jedoch außerhalb der Zeit. Sie sei nur der Schnittpunkt zwischen Vergangenheit und Zukunft", fasste Tolstoi seine Grundüberzeugung zusammen.
Ort der Tonaufnahme war das Landgut Jasnaja Poljana, wo Lew Nikolajewitsch Graf Tolstoi 1828 geboren worden war und wohin er sich, nach einem kurzen Studium von Jura und orientalischen Sprachen, einem anschließenden Eintritt in die Armee und Teilnahme an Kämpfen im Kaukasus und auf der Krim wieder zurückgezogen hatte, in dem Wissen "Meine Karriere ist nicht eine praktische".
Das auf Jasnaja Poljana einsetzende kontinuierliche Schreiberleben führte 1869 zu einem ersten Höhepunkt, als Tolstoi nach gut sieben Jahren die Arbeit an seinem Prosakoloss "Krieg und Frieden" beendete; auf über 2000 Seiten hatte er darin die napoleonischen Kriege von 1805 bis 1812 gegen die Verbündeten Österreich und Russland vor dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen Entwicklung Russlands zur Zeit des Zaren Alexander beschrieben.
Zwischen Schlachtfeld und Opernbesuch
Vorausgegangen waren aufwendige Recherchen, um sich etwa Dokumente wie den Tagesbefehl Napoleons für die Schlacht von Austerlitz zu besorgen:
"Soldaten! Das russische Herr rückt gegen uns vor. Das sind dieselben Regimenter, die ihr bei Hollabrunn geschlagen und ohne Unterlass bis hierher verfolgt habt. Soldaten! Ich selbst werde eure Bataillone führen."
Den offiziellen Verlauf der Geschichte mit den vielen, an die Wucht Homerischer Schilderungen erinnernden Schlacht-Beschreibungen, verwob Tolstoi mit dem Leben einiger adliger Familien der russischen Gesellschaft. Wie Menschen ihr Leben fristen, sich Unterhaltung verschaffen bei Jagdausflügen oder Opernbesuchen in Moskau oder St. Petersburg, in Konversationsritualen verharren und welche Irrtümer sie produzieren – solche letztlich philosophischen Fragen erörterte Tolstoi zwar ganz dicht am individuellen Lebensschicksal seiner Figuren, aber immer um zu einer Beschreibung der Eigenbewegung des "unbewussten, allgemeinen Lebens der Masse Mensch" vorzudringen:
"Es gibt zwei Seiten im Leben eines jeden Menschen: das persönliche Leben, das umso freier ist, je abstrakter seine Interessen sind, und das elementare Leben, das Leben der Masse Mensch, wo der Einzelne nicht anders kann, als die ihm vorgeschriebenen Gesetze erfüllen."
Einen Roman wollte Tolstoi selbst "Krieg und Frieden" nicht nennen. Einerseits ließ er sich zwar breit in den Erzählstrukturen des 19. Jahrhunderts nieder, andererseits brachte er die alten Formen auch immer wieder zum Bersten, indem er mittels einer die Moderne ankündigenden Montagetechnik und über Traumprotokolle und innere Monologe die tiefsten Schichten im subjektiven Universum seiner Personen freilegte.
Vom Hitzkopf zum weisen Mann
Zum Beispiel Fürst Andrej. Mitten im Schlachtgeschehen bekommt er einen Knüppelhieb auf den Kopf. "Über ihm war nichts als der Himmel – der zwar nicht klar, aber trotzdem unermesslich hoch schien. Graue Wolken glitten ruhig dahin. Wie still, wie ruhig ich werde, … gar nicht so, wie ich eben dahingestürmt bin. Gar nicht so wie wir rennen und schreien und kämpfen. Ganz anders ziehen die Wolken über diesen hohen, unendlichen Himmel dahin. Wie kommt es, dass ich früher niemals diesen Himmel gesehen habe? Wie glücklich bin ich, dass ich ihn endlich sehe! Ja! Alles ist eitel, alles ist Lug und Trug, außer diesem unendlichen Himmel."
In seiner Jugend ein aufbrausender Kopf, der seine Umgebung mit verbalen Aggressionen brüsk attackiert hatte, war aus Tolstoi in "Krieg und Frieden" ein Autor geworden, der in einer Sprache ohne Prunksucht und Attitüden ein weit gespanntes, komplexes Bild vom Leben mit allen dazugehörigen Konflikten zeichnete. Im Alter bedrängten den vom Weltruhm umstrahlten Mann mit dem weißen Rauschebart auf Jasnaja Poljana seine eigenen inneren wie die äußeren Widersprüche seiner Zeit aber noch einmal derart mächtig, dass Lew Nikolajewitsch Tolstoi seine Familie und das Landgut verließ und zu einer Reise ins Ungewisse aufbrach, während der er kurz darauf, 1910, gestorben ist.