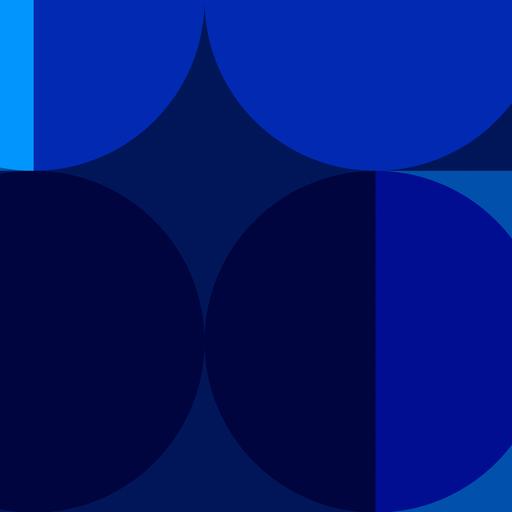Ein Zeitzeugen-Gespräch vom 29.11.2018
William Wolff wird am 13. Februar 1927 als Wilhelm Wolff in Berlin geboren. Sein Vater, ein Unternehmer, ist orthodox jüdisch, seine Mutter nicht an Religion interessiert. Schon im September 1933 emigrieren die Wolffs mit ihren drei Kindern nach Amsterdam. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs zieht die Familie von dort weiter nach London. Schon früh hat Wilhelm Wolff zwei Berufswünsche: Journalist oder Rabbiner will er werden. Er wird dann nacheinander beides. In Großbritannien ist er über Jahrzehnte ein sehr erfolgreicher politischer Zeitungskorrespondent. Mit Anfang 50 beginnt er das Rabbinerstudium am Leo-Beck-College in London. Fünf Jahre später wird er ordiniert. Im Lauf der Jahre betreut Rabbi Wolff verschiedene jüdische Gemeinden in England. 2002 geht er als Landesrabbiner für Mecklenburg-Vorpommern zurück nach Deutschland. Nach 65 Jahren baut William Wolff in Schwerin, Rostock und Wismar wieder eine jüdische Gemeinde auf. 2015 endet sein Vertrag in Mecklenburg-Vorpommern. Rabbi Wolff behält seinen Titel und nimmt nach wie vor repräsentative Aufgaben in seiner alten Gemeinde wahr. Zwei Dokumentarfilme, in denen er auftritt, sorgen für Kinoerfolge. Rabbi Wolff lebt in einem kleinen Haus in der Nähe von London.
"Ich glaube, Kinder gewöhnen sich sehr schnell an neue Umstände."
Kindheit in Berlin, Amsterdam, London.
Christine Heuer: Rabbi Wolff, viele deutsche Zuschauer von Filmen kennen Sie aus dem Film von Britta Wauer, "Rabbi Wolff, ein Gentleman vor dem Herrn". Der ist 2016 erschienen und ist ganz gut besprochen worden. In der "Zeit" stand, das sei "ein hinreißendes Porträt über den vielleicht skurrilsten Rabbiner unter der Sonne." Sie sind so etwas, Rabbi Wolff, wie ein Arthouse-Filmstar. Wie viel Freude bereitet Ihnen das?
William Wolff: Ich bin mir dessen nicht bewusst. Ich bin mir dessen völlig nicht bewusst. Und ich finde, das ist auch nicht meine Sache, und ich kann mir nichts darauf einbilden. Und bilde mir auch nichts darauf ein.
Heuer: Aber viele sprechen Sie ja darauf an.
Wolff: Ja, gewiss. Manchmal ist es ein bisschen lästig, aber so ist es. Und dann sage ich mir, da bist du selber schuld, also sei jetzt höflich zu den Menschen.
Heuer: Wir sprechen über Ihr Leben, das vielfältig ist, das auch viele Brüche hatte, und wir sprechen darüber, was dieses Leben im Innern auch zusammengehalten hat, wie Sie das bewältigt haben. Und wir beginnen vorne: 1927 sind Sie in Berlin geboren. Ihr Vater war ein Gummifabrikant, wenn ich das richtig gelesen habe.
Wolff: Ja, teilweise. Er war auch Vertreter für englische Firmen und so weiter und hat mit einem Amerikaner, der ein berühmter Marken-Sammler war, Artur Hein, da war da auch eine Plüschfabrik, in Boston, glaube ich, und mein Vater war sein deutscher oder europäischer Vertreter.
Heuer: Also ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und Sie sind die ersten sechs Jahre Ihres Lebens aufgewachsen in diesen sechs Jahren im gutbürgerlichen Hansaviertel.
Wolff: Ja, direkt am Spreeufer.
Heuer: Sie hatten einen Zwillingsbruder, Sie haben eine Schwester gehabt, also eine fünfköpfige Familie. Wenn ich Sie jetzt frage, woran erinnern Sie sich aus dieser Zeit, ganz spontan? Wie hat denn Berlin gerochen? Wie hat sich Berlin angehört? Was fällt Ihnen da ein?
Wolff: Eigentlich sehr wenig. Was mir wohl einfällt, was mir leider immer einfällt, ist, dass der erste April '33 dann ein von den Nazis als Boykotttag, Boykott von jüdischen Geschäften und so (war). Und woran ich mich erinnere, ist, dass an der Spree Boote vorbeikamen mit Nazis, die antijüdische Sachen gerufen haben, also "Juda verrecke" und so weiter.
Heuer: Das ist tatsächlich Ihre Berliner Erinnerung …
Wolff: Und ich kann mich eben auch noch an diesen Tag erinnern, weil meine Schwester in Tränen nach Hause kam. Sie konnte nicht in die Schule rein. Die Nazis standen vor der Tür und haben verhindert, dass die Kinder in die Schule gingen.
Heuer: Da waren Sie gerade mal sechs Jahre alt.
Wolff: Ja.
Heuer: Das ist ja eine sehr bedrückende erste Prägung.
Wolff: Ja. Und dann, wie gesagt, die nächste Erinnerung ist eben, wir sind dann am 27. September ausgewandert. Und am Abend zuvor waren wir bei meinen Großeltern, den Eltern meiner Mutter, zum Abendessen, und dann kam um neun Uhr oder wann es war, ein Taxi und hat uns abgeholt. Und anstatt dass es uns zurück zum Holsteiner Ufer gefahren hat, hat es uns zum Lehrter Bahnhof gefahren. Und dann ging es raus.
Heuer: Das war eine ganz frühe Emigration im September '33. Waren Ihre Eltern, die das ja so entschieden haben, besonders hellsichtig?
Wolff: Nein. Es war so, weil meine Mutter und Großmutter Kunden waren bei einer Schneiderin, einer Frau Friedländer. Und damals, wenn man Änderungen hatte, ich meine, heute geht man ins Kaufhaus, kauft es neu. Damals wurde eben genäht. Frau Friedländer hatte eine Tochter namens Magda. Und Magda war mit einem jungen Politiker verheiratet, Vorname Josef, Nachname Goebbels. Und so hatte meine Mutter Angst, dass durch diese Verbindung wir vielleicht schon früh auf irgendeine Liste gesetzt werden, zum deportiert werden oder weiß ich, was damals war. Und so wollte sie raus. Und darum sind wir dann schon am 27. September '33 raus. Nach Holland, weil mein Vater dort einen Vertreter hatte, und der hatte gesagt, sie könnten zusammen was unternehmen, geschäftlich. Das hat sich dann als nicht praktisch erwiesen, und dann hat er mehr Zeit in England verbracht und gesagt, na ja, dann muss die Familie auch nach England kommen.
Heuer: Aber erst mal sind Sie in Amsterdam, in einer völlig fremden Welt. Wie hat das Ihre Kindheit geprägt?
Wolff: Sehr stark. Ich spreche immer noch fließend und akzentfreies Holländisch. Und um meinem Leben doch ein bisschen (unverständlich) noch zu geben, gehe ich doch einmal im Jahr ein paar Tage nach Amsterdam und wohne immer im selben Hotel, beim Hauptbahnhof nebenan. Und wenn ich da ankomme und mich anmelde - Ja, Sie haben ein Zimmer reserviert, ist alles in Ordnung -, dann muss ich den Ausweis zeigen, und dann kommt mein englischer Pass auf den Tisch. Dann sind sie immer sehr erstaunt, warum dieser Holländer einen englischen Pass hat.
Heuer: Dieser Deutsche, dieser Holländer mit dem englischen Pass.
Wolff: Ja, weil ich eben Holländisch ohne Akzent spreche, so meinen Sie, er ist ein Holländer, nicht wahr. Aber dann kommt ein englischer Pass auf den Tisch.
Heuer: Was haben Sie am meisten vermisst in dieser Zeit?
Wolff: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich etwas vermisst habe. Im Rückblick vielleicht wohl, aber ich glaube, Kinder gewöhnen sich einfach sehr schnell an neue Umstände. Zum Beispiel, als wir nach Holland kamen, hat mein Vater sofort einen Nervenzusammenbruch bekommen. Meine Mutter hat ihn dann in die Schweiz in die Nervenklinik gebracht in Kreuzlingen. Und wir Kinder sind in eine Kinderheim nach Hilversum gebracht worden. Und da haben wir uns eigentlich sehr schnell eingelebt, ich persönlich wenigstens, und habe mich dort nicht unwohl gefühlt.
Heuer: Und dann kommen Sie '39 nach England. Das müssen Sie auch noch mal erklären, wieso dann die Reise weiterging.
Wolff: Ganz einfach: Mein Vater hat sich mit dem Leben in Holland nicht abfinden können. Er hat die Sprache nicht beherrscht, und irgendwie hat er sich dort nicht wohlgefühlt, und geschäftlich ging es dort nicht gut. Er stammte aus Hannover, und als er ein Kind und Jugendlicher war, war noch eine enge Beziehung zwischen Hannover und England. Und dann hatte er auch in Deutschland englische Firmen vertreten. Und wie es dann in Holland nicht geklappt hat, hat er mehr und mehr Zeit in England verbracht und hat gesagt, dann muss die Familie auch kommen. Aber inzwischen hatte meine Mutter ein neues Leben in Holland aufgebaut, sehr erfolgreich insofern. Dann hat sie zwei Freundeskreise, einer war holländisch, einer bestand auch aus deutschen Emigranten, und hat sich dort sehr wohlgefühlt und hatte dann auch noch eine Beziehung dort. Aber dann hat mein Vater-ich weiß nicht, am 26. oder so August angerufen und gesagt, kommt sofort mit dem nächsten Schiff.
Heuer: Und das war ja wieder hellsichtig, vielleicht unfreiwillig, aber hellsichtig, denn das war buchstäblich am Vorabend des Zweiten Weltkriegs.
Wolff: Ja. Und dann sind am ersten September die Nazis nach Polen einmarschiert, und dann am dritten ging es dann los. Dann haben die westlichen Alliierten Deutschland den Krieg erklärt. Und dann war Krieg.
Heuer: Und für Sie war es ein großes Glück, dass Sie aus Holland weggegangen sind, denn dort waren die Nazis dann ja auch später.
Wolff: Ja, gewiss, das hat uns das Leben gerettet. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Aber es war eben auch schwierig, denn wir haben uns sehr wohl dort gefühlt. Was heißt wir - das sind wir drei Kinder und unsere Mutter.
Heuer: Wie lange hat das gedauert, bis Sie sich in England dann zu Hause gefühlt haben?
Wolff: Das hat dann doch mindestens sechs oder mehr Monate gedauert, und bis wir die Sprache etwas beherrscht haben. Und dann gingen wir eben in die Schule, und dann waren im Herbst '39 geschlossen, und dann fing es im Januar '40 wieder an. Und da hat der Geschichtslehrer gesagt: Wir hätten die ersten 70 Seiten im Geschichtsbuch durcharbeiten müssen, das können wir nicht, dass müssen Sie jetzt selber machen. Und ich glaube, mein Bruder und ich waren die einzigen, die sich da durchgeackert haben. Und das war natürlich alles auf Englisch, und das konnten wir noch nicht sehr gut. Da haben wir mit dem Wörterbuch dagesessen, und nachdem wir uns dann durchgearbeitet hatten, saß schon viel von der Sprache.
"Fräulein Davis, ich möchte entweder Journalist oder Rabbiner werden."
Ankommen, Fuß fassen, neu anfangen.
Heuer: Nach diesen Jahren an so vielen verschiedenen Orten, rausgerissen, wo man gerade angekommen war, was bedeutet in Ihrem Leben Heimat?
Wolff: Ungeheuer wichtig. Bedeutet, wo man hingehört.
Heuer: Wo gehören Sie hin, Rabbi Wolff?
Wolff: Hat lange gedauert, bis mir das klar wurde, aber ich gehöre eben in zwei Länder. Ich gehöre hier in Deutschland hin, aber auch in England. Ich hatte dann eben auch in England später eine Rolle im öffentlichen Leben, aber ich war lange Jahre lang im Parlament Reporter gewesen und hatte dann auch bei der Zeitung, der Redaktion zu tun und so weiter und kannte besonders den Ministerpräsidenten Harold Wilson sehr gut und habe, glaube ich, dafür gesorgt, dass er Polizeischutz bekommen hat. Ich glaube, '79 - ich bin ja so uralt - 1970 im Wahlkampf bin ich mit ihm einen Freitagabend rumgefahren, um zu sehen, ob was ist und ob ich vielleicht in der Sonntagszeitung was schreiben kann oder nicht.
Und da sind wir, nur er und ich - er hatte keine Begleitung, weder Polizei noch irgendwelche von seinem Büro -, sind wir beide im Auto von einer Kleinstadt nördlich von London zur anderen, zu Wahlversammlungen. Und er war sehr beliebt, zu Recht, und immer, wenn wir aus einem Lokal, Schullokal oder was auch rauskamen, standen seine Anhänger draußen und haben ihm auf die Schulter geklopft. Und Wilson war ein kleiner Mann, und er wurde buchstäblich verkloppt. "Good old Harold", hieß es, "Good old Harold", und es kam - ich weiß noch, ich kam um zehn Uhr abends nach Hause und ich war so empört, dass dieser Mann da buchstäblich verkloppt wurde.
Dann habe ich das meinem stellvertretenden Chefredakteur geschrieben und per Fax hingeschickt. Es kann nicht sein, dass dieser Mann keinen Schutz hat und so weiter. Und dann kam ich eben Sonnabendnachmittag ins Büro und hab da mein Geld für meine Hypothek verdient, und niemand hat was gesagt. Hat gesagt, Danke, dass du das geschrieben hast, wir unternehmen dies oder das. Niemand hat ein Wort gesagt. Und dann hab ich gedacht, na ja, dann eben nicht, und kam dann auch um zehn oder elf Uhr abends nach Hause mit der ersten Ausgabe und habe auf Seite zwei, Seite drei, Seite vier, fünf geguckt. Kein Wort. Na ja, ich habe meine Pflicht getan. Mal schnell gucken, womit sie die Zeitung verkaufen wollen, was auf Seite eins, und dann ins Bett. Da war die erste Seite voll damit, war absolut voll damit mit meinen Sachen. Und dann haben - das war Sonntagfrüh, und Montag um elf hat die politische Sekretärin von Wilson angerufen, um sich bei mir zu bedanken. Sie hat gesagt, um neun Uhr früh war heute Scotland Yard in der Downing Street, um Polizeischutz für den Ministerpräsidenten zu besprechen.
Heuer: Das sind tolle Erinnerungen, sie schildern das ganz lebhaft. Sie sind in dieser Zeit damals, wenn Sie das erzählen, ich höre das - Sie sind begeisterter Journalist gewesen, Rabbi Wolff. Warum sind Sie es nicht geblieben?
Wolff: Wie ich auf dem Gymnasium in London Schüler war, kam ein Brief vom Ministerium an die Schuldirektorin, Sie müssen jetzt Berufsberatung geben. Und der Direktor, sie sagten, der hat genug, hat das seiner Stellvertreterin gegeben, Fräulein Davis, Fräulein Winifred Davis, die Hauptlehrerin für Französisch war. Fräulein Davis, bitte kümmern Sie sich. Sie hatte so viel Ahnung von Berufsberatung wie ich von Hühnerzucht habe. Aber sie hat uns alle vorgeladen, und wie ich vorgeladen wurde: Kommen Sie rein, Wolff, setzen Sie sich hin, Wolff. Also was, Wolff, wollen Sie werden? Fräulein Davis, ich möchte entweder Journalist oder Rabbiner werden. Sehr interessant, Wolff, sehr interessant. Aber sie hatte keine Ahnung, wo sie mich hinschicken sollte. Aber sie hat sich gesagt, der Wolff ist ganz gut auf Französisch. So gab es und gibt immer noch in London eine Französischschule. Der Hauptanteil der Schule war evakuiert im Nordwesten von England. Aber es blieb noch ein Kursus in London zurück, ein zweisprachiger Kursus in Büroarbeit. Und da hat sie mir ein halbes Stipendium für bekommen. Warum nur ein halbes? Ein volles war nur für Franzosen zur Verfügung. Und da habe ich erstens fließend Französisch gelernt und Tippen, ohne dass ich auf die Tastatur gucke, gelernt, und auch Stenografie.
Heuer: Da waren Sie ja schon fast ein Journalist.
Wolff: Ja. Und war dann und bin bis heute noch - kann ich mein Leben verdienen, in dem ich Büroarbeit machen gehe.
Heuer: Aber Sie sind Journalist geworden, nicht Sekretär. Wenn man so klar sagt, ich möchte entweder Journalist werden oder Rabbiner, muss man ja mit dem Journalismus - und über das Rabbinat reden wir gleich ausführlich -, aber auch mit dem Journalismus ja etwas verbinden. Was hat Sie da so gereizt?
Wolff: Es war so hochinteressant, denn man hatte einen Logensitz. Ich hab 25 Jahre lang einen Pass zum englischen Parlament, das Gebäude kennt jeder, gehabt. Und dann kam ich auch jeden Tag oder mehrere Male in der Woche in die Downing Street ins Pressebüro. Und wenn ich in die Straße reinkam, hat die Polizei mich schon gesehen, hat angeklopft, und wie ich vor der Tür stand, ging die Tür automatisch auf, und ich war drin. Das war schon schön.
Heuer: Sie waren nicht nur drin, Sie waren sehr erfolgreich. Sie waren unter anderem Außenpolitikchef beim "Daily Mirror". Das muss man erklären. Das ist ein Boulevardblatt, ein bisschen wie die "Bild"-Zeitung, aber eben eher ein linkes Boulevardblatt, aber mit einer unheimlich hohen Auflage. Also ein sehr erfolgreicher, ein bekannter Journalist. Sie sind auch aufgetreten im "Internationalen Frühschoppen" im deutschen Fernsehen, mit Werner Höfer. Das war ja damals in den 70er-Jahren eine große Institution. Und dann, mit knapp über 50, machen Sie plötzlich einen ganz harten Schnitt und sagen, ich beende das, und ich werde jetzt Rabbiner. Wie ist das gekommen, Rabbi Wolff?
Wolff: Weil ich ein Jahr lang freier Journalist war, ich war nicht bei einer Zeitung angestellt. Freier Journalist zu sein, hat mir nicht viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich inzwischen auch das liberale Judentum entdeckt. Ich stammte aus orthodoxer Familie, das heißt, der Vater war orthodox, die Mutter nicht, aber es war eben ein orthodoxer Haushalt, und so bin ich aufgewachsen. Dann dachte ich eines Tages, dann habe ich auch durch Bekannte und so den Chef der liberalen Bewegung in England gut kennengelernt. Er hat zu mir gesagt, hören Sie mal zu, Wolff, unser Monatsbrief, Zeitung und so, da muss was geschehen, das ist nicht richtig und gut. Können Sie das übernehmen? Das habe ich dann auch, und so habe ich das liberale Judentum kennengelernt, das ich vorher nicht kannte. Und dann dachte ich eines Tages, da könntest du vielleicht noch einen Beitrag machen. Das habe ich dem Chef dort gesagt, und da hat er gesagt, na ja, wenn du wirklich interessiert bist, übermorgen trifft sich das Gremium, um zu entscheiden über den Zutritt zum Seminar. Da nehme ich dich mit hin. Dann bin ich mit ihm dahin, zu dem Gremium, und dann wurde mir weiter nichts gesagt. Aber ich habe dann im Herbst am Seminar angefangen. Und eine Woche, nachdem ich angefangen habe, kam ein Brief, um mir mitzuteilen, dass das Gremium entschieden hat, ich werde zugelassen. Und inzwischen war ich schon da.
Heuer: Aber was bedeutet das denn, wenn man als Kind sagt, ich möchte entweder Journalist oder Rabbiner werden? Schon als Kind haben Sie das gesagt. Dann haben Sie den einen Beruf ausgeübt, und dann das Pferd noch mal gewechselt. Ist das, weil Religion Ihnen so viel bedeutet hat, immer schon? Kommt das aus der Familie?
Wolff: Irgendwie saß die Religion in mir. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie oder was, aber irgendwann habe ich mir eines Tages gesagt, du bist ja ein religiöser Mensch. Du glaubst an Gott, also dann interessier dich ein bisschen mehr. So kam das dann zustande.
Heuer: Was ist das Schöne daran, Rabbi zu sein?
Wolff: Zweierlei. Erstens habe ich Freude an der Zeremonie und auch am Gottesdienst. Gottesdienst kann schön sein oder auch langweilig sein. Und den Gottesdienst schön zu machen, mit Chor und mit hoffentlich einer halbwegs interessanten Predigt, das gibt schon viel Genugtuung.
Heuer: Also Sie verstehen etwas von Zeremonien, Sie finden Form offenbar wichtig. Sie gehen ja auch gern in anglikanische Weihnachtsgottesdienste in England. Sie gehen sehr gern nach Ascot, was ja auch was sehr Zeremonielles hat. Geben Zeremonien, geben Rituale Halt im Leben?
Wolff: Ganz bestimmt, ja. Es ist für mich einfach eine Bereicherung im Leben, ganz bestimmt.
"Wo die Wurzeln sind, steckt in einem drin."
Rückkehr aufs Festland
Heuer: Dann machen wir einen Sprung. 2002, da sind Sie 75, und da haben Sie den Beruf schon eine ganze Weile getauscht gehabt, waren Rabbiner, und dann machen Sie den nächsten richtig großen Schritt und gehen als Landesrabbiner nach Deutschland, nach Mecklenburg-Vorpommern. Können Sie mir erklären, wie das passiert ist, Rabbi Wolff?
Wolff: Es wurde mir einfach angeboten durch Herrn Doktor Peter Fischer, der beim Zentralrat gearbeitet hat. Und der sagte, ich war irgendwie nach gewisser Stellungssuche, und der sagte mir, wir brauchen Rabbiner in Deutschland, und besonders auch etwas liberale, und da sind jetzt neue Gemeinden von russischen Zuwanderern. Wenn du Interesse hast. Dann wurde mir gesagt, dass hier in Schwerin eine neue Gemeinde aufgebaut worden ist oder dabei ist, aufgebaut zu werden, von Herrn Bunimow. Da ist ein Rabbiner benötigt, und wenn ich Interesse habe, soll ich mich da mal melden. Das habe ich dann auch, und dann wurde ich eingeladen, den Gottesdienst zu halten, und dann wurde mir der Posten angeboten. Zur selben Zeit habe ich auch ein Angebot in England bekommen. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was das war, aber dieses hier schien mir interessanter zu sein.

Heuer: Warum? Was hat Sie gereizt?
Wolff: Hier war doch eine Aufbauarbeit zu leisten in dieser Gemeinde. Und da dachte ich, ja, das machst du mal.
Heuer: Wie war das für Sie, zurück nach Deutschland zu kommen?
Wolff: Ich habe mich eigentlich wohlgefühlt. Und dann war mir plötzlich bewusst, es ist die einzige Sprache, wo niemand, wenn ich Deutsch spreche, fragt, wo ich herkomme. Sie wissen sofort - und scheinbar spreche ich Englisch mit einem gewissen holländischen Klang noch.
Heuer: Nach all der Zeit.
Wolff: Ich werde immer, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel, aber ich wurde jahrelang gefragt, wo kommen Sie eigentlich her. Und hier fragt mich niemand, wo kommen Sie eigentlich her. Und das war dann für mich eben auch wichtig, und das deutsche Schicksal hat mich dann sehr bewegt, und wie die Mauer runterkam oder durchbrochen wurde.
Heuer: Das müssen Sie mal erzählen, wie Sie das erlebt haben.
Wolff: Ich war damals im Norden von England, in Newcastle Rabbiner, hatte auch noch eine Gemeinde eine Stunde entfernt übernommen. Die hatten noch ein älteres Gebäude, das wollten sie erhalten. Und da bin ich einmal im Monat freitagabends hingefahren. So war es am 10. November '89, und auf der Fahrt dahin habe ich im Autoradio die ersten Folgen in England, die ersten großen Nachrichten über den Durchbruch der Mauer. Und wie ich das hörte, kamen mir die Tränen. Dann habe ich gleich im Gottesdienst ein Dankesgebet dafür gesagt. Und ich wusste, meine Mutter hatte auch noch Freunde in Ostberlin und Ostdeutschland. Sie hatten mal sieben Jahre in meiner Familie gearbeitet und war eigentlich auch Chefin des Haushalts bei uns und so weiter. So waren wir des Öfteren, wenn wir mal in Deutschland waren, waren wir auch dort zu Besuch. Und ich weiß, ich war auch am Geburtstag da, und da hat sie zu mir gesagt, als ich weggefahren bin, sehen wir dich noch mal? Und da habe ich zu ihr gesagt, ich bin zu deinem Geburtstag wieder hier. Und da hat sie gesagt, ich hab nur einen Wunsch, dass ich in meiner Geburtsstadt, das heißt Berlin, wieder frei herumlaufen kann, nicht nur in einem Teil und nicht in den anderen darf. Da war mir eben auch bewusst, als die Mauer durchbrochen wurde, was das für die Menschen bedeutet hat.
Heuer: Aber nach all der Zeit hat Sie das ja auch sehr berührt. Genaugenommen haben Sie ja nur die ersten sechs Jahre in Deutschland gelebt, und Sie haben auch die Staatsangehörigkeit nicht mehr.
Wolff: Irgendwie war mir das deutsche Schicksal doch wichtig.
Heuer: Wie kommt das? Sind das die frühen Wurzeln?
Wolff: Das hat in mir gesessen, ja. Davon, finde ich, kommt man nicht weg. Wo die Wurzeln sind, steckt in einem drin. Und so ist es mit meinen deutschen Wurzeln.
Heuer: Und dann sind Sie in einer Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern in den 2000er Jahren, ab 2002 bis 2015 waren Sie hauptamtlicher Landesrabbiner. Das ist eine Zeit, in der auch die NPD im Landtag sitzt. Es gibt eine rechte Szene. Hat Ihnen das keine Sorge gemacht?
Wolff: Ich weiß, wie die Wahl hier war - ich weiß nicht, ob es Axel Seitz vom Funk war oder wer auch immer, wollte, dass ich meine Meinung dazu gebe, aber ich war in England. Dann hatten wir verabredet, dass er mich um 18 Uhr am Sonntagabend anruft. Um 18 Uhr kam der Anruf, und dann sagte er mir, dass die NPD sieben Prozent bekommen hatte und dadurch auch einen Sitz im Landtag. Dann habe ich ihm gesagt, wenn die NPD sieben Prozent hat, dann bedeutet das, dass 93 Prozent sie nicht gewählt hat. Das genügt mir.
Heuer: Sie haben sich sicher gefühlt.
Wolff: Ja. Das war meine Antwort, und die würde ich heute auch noch geben.
Heuer: Und das, obwohl wir in Deutschland auch gerade in diesem Jahr wieder erleben - es ist der Hitler-Gruß gezeigt worden in Chemnitz während Demonstrationen in einer deutschen Stadt. Wir hören von vielen Juden, die hier leben, dass der Antisemitismus wieder offen gezeigt wird, dass der auch immer aggressiver wird. Spüren Sie da eine Veränderung?
Wolff: Ich persönlich habe es nicht mitgemacht. Es ist mir persönlich nichts Besonderes passiert. In dieser Stadt werde ich mit ungeheurer Höflichkeit und Hilfsbereitschaft behandelt. Wenn ich zum Einkauf fahre und eine schwere Tasche habe, kommt immer jemand, und bietet an, die Tasche für mich zu tragen und so. Ich kann nur sagen, und das wäre in England unvorstellbar, ich fühle mich hier wohl und werde hier besser, als ich es verdiene, behandelt.
Heuer: Das kann nicht sein, Rabbi Wolff, ausgeschlossen. Sie mögen die Deutschen. Sie sind gar nicht zornig auf dieses Land? Ist das Geschichte?
Wolff: Wissen Sie, ich bin hier geboren. Davon komme ich nicht weg. Ich würde gern sagen, dass ich mit Spreewasser getauft worden bin, aber ich bin eben nicht getauft worden. Aber doch, an der Spree hatte ich meine ersten sechs Jahre, die doch dann wichtig waren, nicht wahr.
Heuer: Das, was Sie erlebt haben, ist das für Sie denn auch tatsächlich Geschichte?
Wolff: Ich betrachte es, das habe ich, glaube ich, schon öffentlich gesagt, als eine Entgleisung der deutschen Geschichte.
Heuer: Leben wir in einem anderen Zeitalter heute, und leben wir auch sicher in einem anderen Zeitalter in Deutschland, als das eben in den 30er-Jahren, den 40er-Jahren war?
Wolff: Aber natürlich, ganz gewiss. Und auch meines Erachtens, wie sich Deutschland um die Zuwanderer kümmert und die ganze Zuwanderung, ist meines Erachtens doch erheblich freundlicher als zum Beispiel in England, wo Herr Cameron, der damalige Ministerpräsident, gesagt hat, es kommen keine Migranten ins Land. Trotzdem sind Hunderttausende ins Land gekommen. Und da ist man so gut wie möglich mit fertig geworden, und wird - aber hier ist es anders. Man kümmert sich um sie.
Heuer: Haben Sie mit Ihrer eigenen Emigrationserfahrung ein besonderes Gespür vielleicht auch für das, was Migranten gerade erleben?
Wolff: Ich glaube, dass ich hoffentlich dadurch mehr Verständnis habe für Zuwanderung und so weiter. Und der große Unterschied zwischen den damaligen jüdischen Emigranten und vielen der heutigen Zuwanderer ist, dass wir die neue Landessprache sehr schnell haben lernen müssen. Es gab auch damals keine Selbstbedienung in den Geschäften. Meine Mutter musste ins Geschäft gehen und auf Holländisch sagen, wie viel Käse sie haben will oder wie viel Wurst oder was auch immer. Heute nimmt man es sich runter und geht zur Kasse, und man braucht kein Wort sprechen. Das ist ein großer Unterschied. Wie gesagt, heute, wenn man zu Hause ist, sieht man das Fernsehen aus dem Land, wo man herkam, sei es Russland, sei es Rumänien oder wo auch immer, und man braucht sich mit der Sprache und mit der Kultur hier sich nicht abgeben. Das Problem dabei ist natürlich, dass die Großeltern nicht mit ihren Enkelkindern sprechen können, denn die Enkelkinder sprechen kein Russisch oder was auch immer. Und Großeltern sprechen kein Deutsch.
Heuer: Und das haben Sie ja auch selbst erlebt in Ihrer jüdischen Gemeinde hier, die zum allergrößten Teil aus russischen Migranten besteht. Da haben Sie erst mal Russisch gelernt, Rabbi Wolff.
Wolff: Ja. Ich hatte schon mal etwas Russisch gelernt, aber hier musste ich das viel seriöser machen.
Heuer: Wie sehr ist Ihnen diese Gemeinde ans Herz gewachsen? Es ist ja auch eine interessante Vorstellung: Da kommt ein deutscher vertriebener Jude, britischer Staatsbürger, als Rabbiner nach Ostdeutschland und trifft dort wiederum auf eine russische Gemeinde. Das ist ein bisschen wie Monty Python, oder.
Wolff: Ja. Auch dann, wissen Sie, durch persönliche Beziehungen. Es war mir auch wichtig, dass wir mal in ein KZ gehen und dass die das sehen. Da waren wir in Ravensbrück zusammen und so weiter. Und dadurch kam dann auch eine persönliche Freundschaft.
"Wenn es etwas gibt, was das eigene Leben und die Gesellschaft bereichert, ist es, dass man sich umeinander kümmert."
Worauf es ankommt
Heuer: Sie haben heute noch repräsentative Aufgaben in Schwerin. Sie haben den Titel auch behalten, Landesrabbiner, aber hauptamtlich machen Sie das seit drei Jahren nicht mehr. Das ist dann auch wieder ein Schnitt gewesen. Ist der Ihnen schwer gefallen?
Wolff: Gewissermaßen, ja. Ich war sehr gern hier im Amt. Ich muss immer was zu tun haben. Jetzt ist es zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich keine ständige Arbeit habe. Es hat mir nie was ausgemacht, dass ich früh oder spät abends noch arbeiten musste. Das habe ich gern gemacht, und es hat vielleicht, jetzt im Rückblick meine ich, dass der Preis, den ich dafür bezahlt habe, ist, dass ich leider nie geheiratet habe, während die anderen so untereinander dann sich haben, war ich irgendwo bei der Arbeit. Das war dann beim Rücktritt doch ein hoher Preis zu bezahlen. Aber so war es.
Heuer: Was bedeutet Ihnen Familie?
Wolff: Eigentlich doch sehr viel, ja. Aber die Schwierigkeit in meiner - also von meiner Schwester gibt es sechs Kinder. Aber mit den Töchtern habe ich leider keinen Kontakt. Und eine davon hat doch immer noch Kontakt mit mir aufrechterhalten. Und dann hat ihr Mann gesagt, was tust du da mit diesem liberalen Rabbiner. Bitte hör auf. Und das hat mir dann auch sehr Leid getan.
Heuer: Ja. Und das ist ja auch eine frühe Prägung, sie haben das erwähnt. Ihr Vater war orthodoxer Jude, Ihre Mutter hat sich, glaube ich, nicht so für Religion eigentlich interessiert. Aber die Familie von Ihrer Schwester, die ist teilweise sogar ultraorthodox.
Wolff: Ja, gewiss. Und das ist sie dann auch geworden, schon mit 14, aus Überzeugung. Und dann ist sie eben auch in diese Kreise gegangen.
Heuer: Was sind das für Kreise? Die sind Ihnen ja - nicht ganz geheuer vielleicht. Wie kann man das formulieren?
Wolff: Das ist sehr schön gesagt, ja.
Heuer: Das ist nicht Ihr Weg. Warum lehnen Sie den ab?
Wolff: Da gibt es einen theologischen Grund. Ich kann nicht akzeptieren, dass jedes Wort in den fünf Büchern Moses von Gott stammt. Denn wenn man den Text dann gut liest, dann hat Gott im fünften Buch vergessen, was er im ersten oder im zweiten - im ersten also kommt er nicht vor oder hat nichts gesagt, aber im zweiten wohl, und im fünften steht was ganz anderes. Also ist Gott eine vergessliche Figur oder so? Das kann nicht sein. Das kann kein Gott sein. Diese strenge orthodoxe Theologie macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und dann ist es zweitens auch so, dass die Leute völlig abgesondert vom Rest der Gesellschaft leben, nicht nur von der allgemeinen Gesellschaft, sondern auch vom Rest der jüdischen Gesellschaft, sich anders kleiden und so weiter.
Heuer: Eine abgeschlossene Welt.
Wolff: Ja, völlig.
Heuer: Dafür sind Sie zu weltoffen.
Wolff: Ja. Das scheint mir nicht akzeptabel zu sein aus verschiedenen Gründen. Aber auch dieses Abschneiden, das führt dann auch zu Vorurteilen bei anderen, die sie nicht kennen. Es ist einfach nicht akzeptabel für mich.
Heuer: Sie haben viele Wechsel erfahren müssen, die Sie sich zum guten Teil ja auch wirklich nicht ausgesucht haben, Rabbi Wolff, in Ihrem Leben. Sie haben auch später Schicksalsschläge in der Familie erlebt. Ihre Schwester ist früh gestorben, Ihr Vater ist früh gestorben. Sie haben Ihren Bruder verloren durch einen, wenn ich das sagen darf …
Wolff: Er hat sich das Leben genommen, ja.
Heuer: Sie sind aber ein Mann, der unglaublich gern lacht und, wie ich finde, eine große Heiterkeit ausstrahlt. Wie haben Sie sich das bewahrt?
Wolff: Dessen bin ich mir nicht bewusst. Ja, natürlich akzeptiere ich das so, aber das kommt eben irgendwo von innen heraus.
Heuer: Eine glückliche Anlage.
Wolff: Ja. Ich mache es nicht mit Absicht. Es passiert einfach.
Heuer: Das ist aber eine sehr schöne Gabe, die Sie da haben.
Wolff: Das ist sehr lieb, danke schön, vielen Dank!
Heuer: Sie haben zwei berufliche Leben gehabt. Sie haben mindestens zwei Leben in England und Deutschland, mindestens zwei. Sie sind jetzt 91 Jahre alt. Wie hält man denn so ein Leben innerlich zusammen? Was ist denn das, was Sie auf Kurs gehalten hat?
Wolff: Manchmal bedarf es gewisser Anstrengungen. Man muss das dann bewusst machen, denn sonst ist es wirklich zu zersplittert.
Heuer: Und was machen Sie genau?
Wolff: Ach so. Eigentlich, dass ich Kontakt zu Menschen habe, auf alle Fälle, und, wie gesagt, auch mitwirke.
Heuer: Worauf kommt es an im Leben, Rabbi Wolff? Sie sind ja auch ein Geistlicher, ein Mann des Glaubens …
Wolff: Ich gebe lieber keinen Rat, denn der passt nicht immer. Aber wenn es etwas gibt, was das eigene Leben bereichert und auch die Gesellschaft bereichert, ist es, dass man sich umeinander kümmert.
Heuer: Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch!
Wolff: Ich bedanke mich vielmals, danke schön. Es hat mir viel Freude gemacht.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.