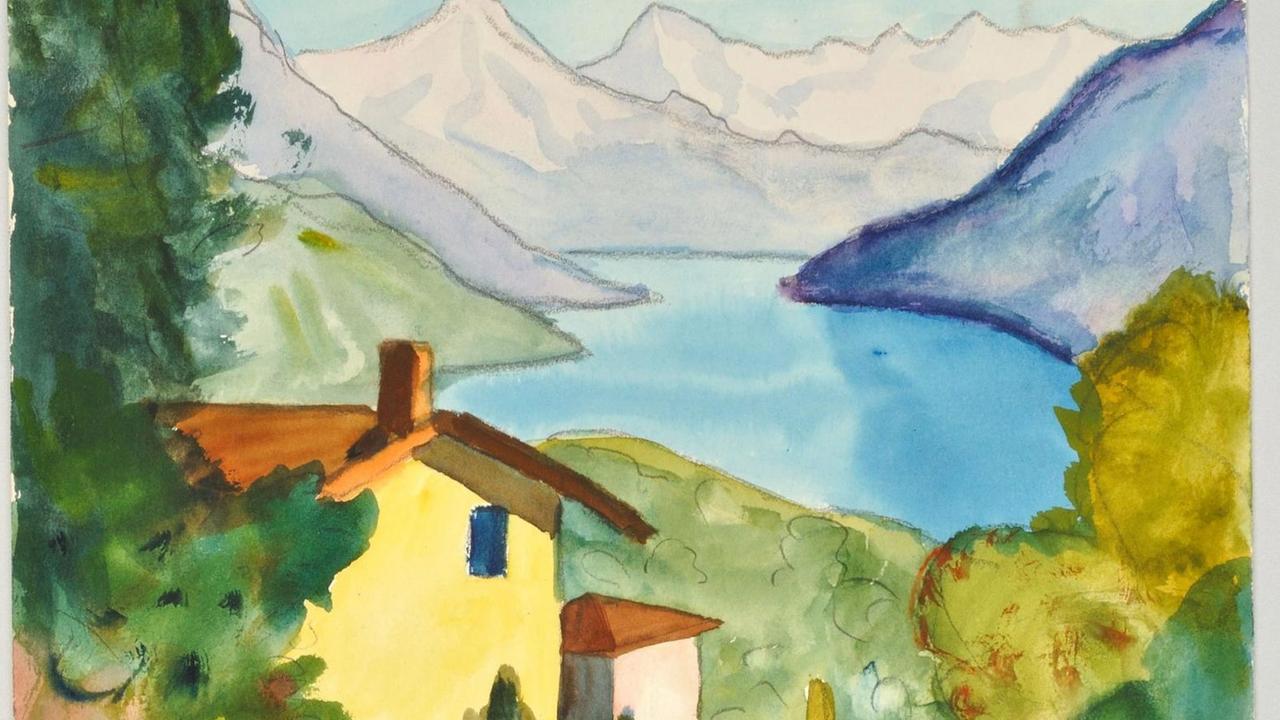Es ist eine Horde von Dämonen, die sich auf dem Podium im "Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe" drängt, grell bemalte Figurinen aus Sackleinen, Sperrholz und Draht: eine mit Namen "Springvieh", ein von Kopf bis Fuß gezackter Blitz in grellem Rot. Ein Dreiecks-Wesen aus Spanten und Streben, dem bei jeder Bewegung eine hölzerne Brückenkonstruktion klatschend von der einen Seite des Schädels auf die andere schlägt. Und der dunkelblaue Ritter "Skirnir", der schon im Stillstand ahnen lässt, wie der Boden zittert, wenn er sich stampfend in Bewegung setzt. Die Hamburger Kunsthistorikerin Athinia Chadzis erklärt, wer dieses Spektakel gestaltet hat:
"Es war schon so: Sie hat auch gesagt, dass es für sie eben wichtig sei, dass diese Masken aus diesem schweren, aus diesem groben, teilweise unpraktischen Material hergestellt sind, weil nur so kann die Maske mir diktieren, wie ich mich zu bewegen hab’."
Lehrjahre in "Der Sturm"-Schule
Lavinia Schulz, geboren am 23. Juni 1896 in Lübben, Niederlausitz, war eine Künstlerin, deren Hingabe sich so leicht keiner Disziplin zuordnen lässt. Zeichnen, das hatte sie, hoch talentiert, an der Schule gelernt, die aus dem Kreis um die Avantgarde-Galerie und Zeitschrift "Der Sturm" hervorgegangen war. Aber das akademische Zeichnen war nur der Anfang, so Athinia Chadzis.
"Gelb klingt irgendwie anders als Blau"
"Sie ist dann ja mit 16, 17 Jahren schon nach Berlin gegangen, in die Stadt. Und das war im Alter eines Teenagers, das war so magisch. Wenn man Kunst sieht von Kandinsky und enthusiastische Menschen, die eben sagen, ja, Farbe ist nicht Farbe, sondern das Gelb klingt irgendwie anders als Blau und kommt in so eine Szene und lässt sich da einfach dann mitreißen."

Im Who's Who der Avantgarde
Den Bildern und Farben gab Lavinia Schulz eine dritte Dimension, indem sie Masken formte, Köpfe, Rüstungen und Kleider, die ganze Figuren definierten. Und eine vierte, Tanz, Bewegung und darstellendes Spiel, nachdem der Theatermann Lothar Schreyer ihr überschäumendes Talent entdeckt hatte. Sie gingen nach Hamburg, 1919; Schreyer selbst zog weiter ans Bauhaus – Lavinia Schulz blieb, um mit ihrem Mann Walter Holdt die Turbulenzen der Zeit in akribisch einstudierten Inszenierungen zu bündeln: ihre Begegnungen mit Expressionismus und Konstruktivismus; die Impulse durch Emil Nolde und den russischen Revolutionskünstler El Lissitzky, deren Rat und Freundschaft sie suchte.
Getreuliches Abbild einer Zeit in Wallung
Die dunklen Mythen der nordischen Sagenwelt. Und die Botschaft der Aussteiger vom Monte Verità bei Ascona in der Schweiz, Sonnenanbeter, Esoteriker und Anhänger der Freikörperkultur, deren Sehnsucht nach Erlösung nun, nach den Schrecken des Weltkrieges, eine ganze Generation ergriffen hatte - das getreuliche Abbild einer Zeit in Wallung., meint die Schulz-Forscherin Athinia Chadzis:
"Es gibt sogar Schriften von ihr, wo sie sagt: Ich bin ein Weib, ich kann nicht logisch denken. Aber ich kann fühlen, und da kann ich Euch ’ne ganze Menge zu sagen. Sie war einfach so ein impulsiver Mensch. Ich glaube, sie hatte keinen Plan. Sie hat sich einfach so mitreißen lassen. Wenn sich was so entwickelte, sagte sie: Da fühle ich mich zuhause." Und mit ihren Masken, so Athinia Chadzis, weiter, habe Schulz alles miteinander verbinden können: Bewegung, Ton, Licht, Farbe. "Sie sagte, also Bühnenkunst ist im Prinzip so wie beim Bauhaus die Architektur, die ganz oben stand."
Es endete im Unglück. Zerrissen zwischen ihrer künstlerischen Besessenheit und dem völligen Kollaps ihrer bürgerlichen Existenz, erschoss Lavinia Schulz im Juni 1924 erst ihren schlafenden Mann und dann sich selbst. In der Zeitung stand lapidar: "Als Grund für die Bluttat werden Nahrungssorgen vermutet."
Das Werk geriet über Jahrzehnte in Vergessenheit
Ein Jahr nach ihrem gewaltsamen Tod erinnerte das Hamburger Museum noch einmal an das Werk des Künstlerpaars. Dann verschwand alles im Depot. Es vergingen mehr als 60 Jahre, bis jemand die Kisten mit den Kostümen wieder öffnete. Das Werk von Lavinia Schulz und Walter Holdt ist immer noch zu entdecken.