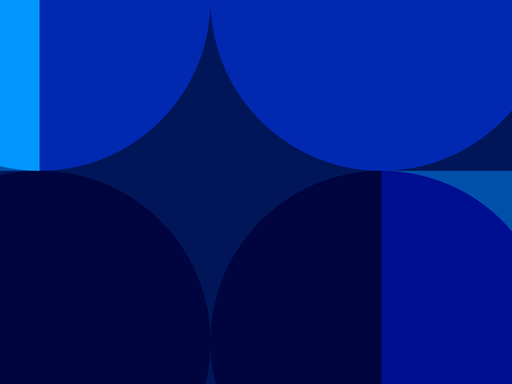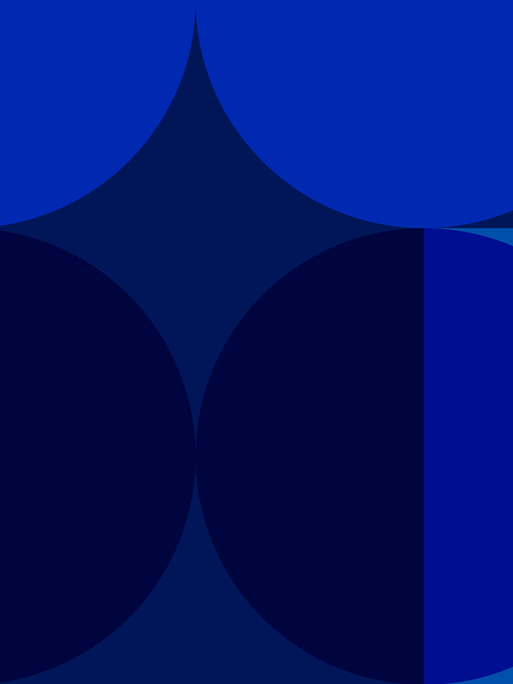Begonnen haben die Diskussionen darüber, ob wir in einem Erdzeitalter leben, das hauptsächlich vom Menschen beeinflusst wird, spätestens im Jahr 2000, als der Nobelpreisträger und Atmosphärenchemiker Paul Crutzen sich in einer Rede dafür aussprach, die Epoche des Anthropozäns einzuläuten.
Nach derzeitiger Einteilung lebt die Menschheit im Holozän. Diese geologische Epoche begann vor rund 11.700 Jahren, nach dem Ende der letzten Eiszeit.
Was heißt Anthropozän?
Der Begriff Anthropozän setzt sich zusammen aus dem altgriechischen Wort "Ánthropos" für "Mensch" und der Endung "-zän", die von "kainós" abgeleitet ist und "neu" bedeutet. 1873 stellte der italienische Geologe Antonio Stoppani erstmals einen wachsenden Einfluss des Menschen auf die Umwelt fest und prägte den Begriff „anthropozoische Ära“ oder auch „Anthropozoikum“. Das sollte zeigen, dass es ein neues Zeitalter in der Geschichte der Erde gibt, in dem der Mensch zum entscheidenden Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist.
Woran machen Forschende das Anthropozän fest?
Anhand von Sedimentproben unter anderem aus dem Crawford See im Süden Kanadas kamen die Geologen jetzt zu dem Schluss, dass das Zeitalter des Menschen, das Anthroprozän, 1950 begonnen habe. Sie sprechen deshalb auch vom Crawfordium als neuer Epoche.
Zunächst sei der Beginn der Industrialisierung vor rund 200 Jahren der Favorit gewesen, berichtet Colin Waters, Leiter der Arbeitsgruppe zum Anthropozän und Geologe an der University of Leicester. Denn Paul Crutzen hatte vorgeschlagen, die neue Epoche mit der Erfindung der Dampfmaschine zu verbinden. Aber es sei sehr schwierig, überall Beweise für eine Dampfmaschine in den Sedimenten zu finden, sagt Waters. „Wenn man in Nordeuropa ansässig ist, dann sieht man die ersten Anzeichen für die industrielle Revolution zwar bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Aber in großen Teilen Asiens oder Australasiens ist das nicht der Fall. Es dauerte bis etwa 2014, bis wir zu dem Schluss kamen, dass der Punkt, an dem man auf dem gesamten Planeten eine synchrone Veränderung feststellt, in der Mitte des 20. Jahrhunderts liegt.“
Plutonium aus oberirdischen Atomtests als Marker
Das Jahr 1950 als Startpunkt wurde schließlich gewählt, weil hier ein sehr präziser geochemischer Marker, der weltweit vorhanden ist, einen Peak erreicht: Das Plutonium aus den oberirdischen Atomtests. Doch das sei bei Weitem nicht das einzige Kennzeichen des Anthropozäns, sagt Waters. Dem Wissenschaftler zufolge fanden sich an allen zwölf Orten, die als mögliche Referenzpunkte in den vergangenen Jahren untersucht wurden, viele weitere Spuren der sogenannten „Großen Beschleunigung“ – der zunehmenden Belastung des Erdsystems durch den Menschen.
„Der steigende Verbrauch fossiler Brennstoffe, der verstärkte Einsatz von Stickstoffdüngern, der zunehmende globale Handel, die Ausbreitung der Arten über den Planeten und die Homogenisierung der Lebewesen – all diese Dinge ändern sich zu diesem Zeitpunkt sehr schnell“, sagt Waters. Gerade weil sie diese Prozesse im Boden der Ostsee, in einem chinesischen Vulkankrater, einer japanischen Bucht und auch in einer Ausgrabungsstätte in Wien gefunden hätten, seien die Forscher der Arbeitsgruppe vom Konzept „Anthropozän“ überzeugt.
Warum hat das Expertengremium abgelehnt?
Die Mitglieder des Subcommission on Quaternary Stratigraphy (SQS) stimmten mit deutlicher Mehrheit von zwölf Nein-Stimmen bei vier Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen gegen den Vorschlag. Nötig wäre eine Mehrheit von 60 Prozent gewesen. Grund für die Ablehnung sei gewesen, dass die menschengemachten Veränderungen noch nicht die Dimension einer Erdepoche erreicht und zudem bereits deutlich früher begonnen hätten, berichtete am 5. März 2024 die New York Times.
Erdepochen stehen für große Einschnitte in der Erdgeschichte, etwa das Pleistozän für die Eiszeit, die vor etwa 2,6 Millionen Jahren begann und vor 11.700 Jahren endete.
Um als neues Erdzeitalter anerkannt zu werden, hätten insgesamt drei Gremien zustimmen müssen. Nach dem SQS in einem weiteren Schritt die Internationale Kommission für Stratigraphie (ICS) und schließlich das Exekutivkomitee der International Union of Geological Sciences (IUGS).
Was soll Benennung eines neuen Zeitalters bringen?
Unabhängig vom Votum des SQS ist das Anthropozän bei Forschenden unterschiedlicher Fachrichtungen bereits ein gängiger Begriff für den immensen Einfluss des Menschen auf die Erde.
Die offizielle Anerkennung als geologisches Zeitalter könne die Verantwortung des Menschen für seine Umwelt betonen, meint Wissenschaftshistoriker Jürgen Renn, Direktor des Max-Planck-Instituts für Geoanthropologie. „Mit diesem einen Wort Anthropozän erfasst man schlagartig, dass wir in einer neuen Zeit leben, in der Menschen für ihre gesamte Umwelt Verantwortung haben als globale Menschheit. Das ist die Größenordnung, über die wir sprechen. Ob das nun ein gutes, ein schönes Anthropozän werden kann oder ein Anthropozän, das nur synonym ist für multiple Krisen, das hängt letztlich an uns. Wir haben immer noch Gestaltungsmacht.“
Die Arbeitsgruppe Anthropozän (AWG), die hinter dem Vorstoß steht, offiziell das Erdzeitalter des Menschen auszurufen, will sich mit dem ablehnenden Votum nicht abfinden. So seien die Ergebnisse ohne die Genehmigung des SQS-Vorsitzenden veröffentlicht worden. Es blieben zudem Fragen offen in Bezug auf die Gültigkeit der Abstimmung und deren Begleitumstände. Man stehe weiterhin voll hinter dem eigenen Vorschlag, teilte die AWG mit.
Tomma Schröder, Jenny Genzmer, Vera Linß, gue, jk