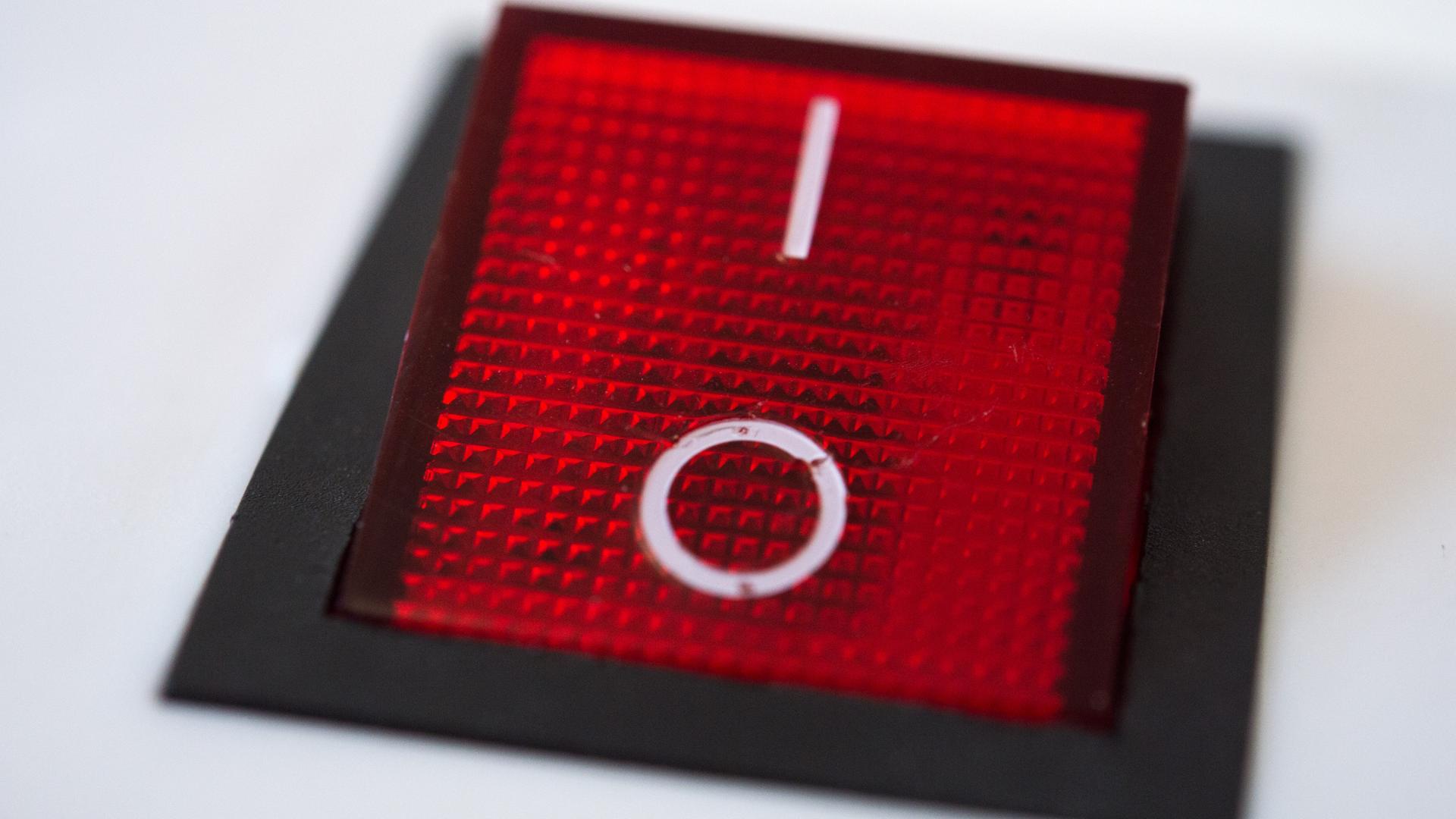TRIGGERWARNUNG: In diesem Beitrag werden Sterbehilfe und Suizid thematisiert. Es gibt Menschen, die helfen können. Wenden Sie sich zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter 0800-1110111 (kostenfrei) und 0800-1110222 (kostenfrei). Diese Menschen nehmen sich Zeit für Sie.
Trauer, Verzweiflung, Wut, Überforderung, aber auch Liebe und Dankbarkeit: Einen geliebten Menschen im Sterbeprozess zu begleiten, kann jede Menge Emotionen auslösen. Dazu kommen etliche konkrete Probleme, die gelöst werden müssen.
Die palliativmedizinische Sterbebegleitung nimmt deswegen meist auch die Angehörigen oder Freunde der todkranken Menschen in den Blick. Bei professionellen Sterbehelfern sieht das anders aus. Freunde und Angehörigen können sich bei den Sterbehilfeorganisationen kaum Unterstützung erhoffen.
Dabei nimmt die Zahl der Suizidassistenzen stetig zu, seit das Bundesverfassungsgericht 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für nichtig erklärt hat. Im Jahr 2024 töteten sich nach Angaben der in Deutschland aktiven Sterbehilfeorganisationen bereits mehr als 1000 Menschen mit Unterstützung. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Menschen, die durch Einzelpersonen wie Ärzte, Pfleger, Juristen oder Lehrer im Suizid begleitet werden.
Was beinhalten bislang Angebote zur Sterbebegleitung?
Palliativmedizinische Sterbebegleitung kümmert sich sowohl um die Sterbenden, als auch um die Angehörigen. Die Helfer beraten Familienmitglieder zum Beispiel bei der Pflege, informieren über Symptome oder erklären, wie sich ein Schwerstkranker im Laufe seines Leidens verändert oder was geschieht, wenn der Sterbeprozess einsetzt. Palliativmediziner wissen auch um das Spektrum der Gefühle, mit denen Angehörige möglicherweise konfrontiert sind. Es umfasst bereichernde Empfindungen wie Liebe, Dankbarkeit und Verbundenheit ebenso wie das Gefühl von Überforderung, Wut oder Enttäuschung.
Bei Angehörigen von Menschen, die sich mit Unterstützung geschäftsmäßiger Sterbehelfer das Leben nehmen, sieht die Situation anders aus. Sterbehilfeorganisationen haben ihren Fokus bislang nahezu ausschließlich bei den Personen, die beim Suizid begleitet werden sollen. Ihre kostenpflichtige Dienstleistung besteht darin, Anträge auf Suizidassistenz entgegenzunehmen und nach eigenen Regeln zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine straffreie Suizidhilfe gegeben sind. Ist dies nach Einschätzung der Organisationen der Fall, kann – mitunter nach einer Frist – ein Sterbetermin vereinbart werden. Meist nehmen sich die Antragsteller im Beisein von Suizidhelfern das Leben. Dies können etwa Ärzte oder Pfleger sein, die einen Zugang in die Vene legen, über den sich die Suizidwilligen das Sterbemedikament selbst zuführen. Die Kosten für diese Dienstleistung legen die Vereine selbst fest. Mal werden zum Beispiel 4000 Euro verlangt, mal knapp 9000 Euro.
Die Möglichkeiten, sich auszutauschen, beraten zu lassen oder Unterstützung zu suchen, sind für betroffene Angehörige bislang begrenzt. Jakub Jaros, der Geschäftsführer des "Verein Sterbehilfe" mit Sitz in Zürich und einem Büro in Hamburg, räumt Defizite ein. Der Umgang mit Angehörigen sei verbesserungswürdig. Allerdings liege dies „aus finanziellen Kapazitätsgrenzen zurzeit nicht in unserer Kraft und Macht“. Ähnlich äußert sich Robert Roßbruch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, der größten Organisation, die in Deutschland Suizidhilfe vermittelt. Man habe nicht die Ressourcen, die Trauerbegleitung anschließend zu machen.
Wo können Angehörige von Menschen, die Suizidhilfe in Anspruch nehmen, Unterstützung finden?
Betroffene können sich an die Spezialambulanz Suizidprävention der Medical School Berlin wenden. Vermutlich ist dies derzeit das einzige spezialisierte Beratungsangebot in Deutschland. Dort werden Angehörige, Freunde oder Bekannte von Menschen beraten, die sich begleitet das Leben nehmen möchten oder es bereits getan haben.
Bei vielen Ratsuchenden sei die vorherrschende Emotion Angst, sagt Birgit Wagner, Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie und Leiterin der Berliner Beratungsstelle: „Angst, was passiert? Angst, wie läuft das ab? Angst, halt ich das überhaupt aus?“ Wagner und ihre Mitarbeiterin Laura Hofmann haben die ersten Erfahrungen des Unterstützungsangebots kürzlich in einer wissenschaftlichen Publikation ausgewertet. Manche Angehörige berichten demnach von Schuldgefühlen, stellten sich etwa die Frage, ob sie etwas hätten anders machen können, sodass sich der Suizid hätte vermeiden lassen. Als problematisch empfinden nahezu alle Ratsuchenden, dass der Sterbetag wie ein Termin geplant werden muss, in Abstimmung etwa mit beruflichen Terminen oder Urlaubsplänen, den eigenen oder denen der Sterbehelferin.
Noch existieren erst wenige Studien, die psychologische Folgen des assistierten Suizids bei Angehörigen untersucht haben. Wagner selbst hatte eine solche Studie bereits vor Jahren in der Schweiz mit 85 Angehörigen durchgeführt, die 14 bis 24 Monate nach einem assistierten Suizid befragt wurden. 13 Prozent erfüllten die Kriterien einer klinisch relevanten Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), 6,5 Prozent zeigten subklinische PTBS-Symptome - eine PTBS kann zum Beispiel Unruhe, Nervosität, wiederkehrende Erinnerungen an das traumatische Ereignis bedeuten. Knapp fünf Prozent litten an einer anhaltenden Trauerstörung, 16 Prozent an Depressionen und sechs Prozent an Angstsymptomen. Das Vorkommen von PTBS und Depression lag höher als in der Schweizer Allgemeinbevölkerung, während eine anhaltende Trauerstörung etwa so häufig wie in der Allgemeinbevölkerung auftrat.
Was sind Risiken beim assistierten Suizid?
Suizidassistenz wird in Deutschland meist über einen Zugang in die Vene geleistet. Der Verein Sterbehilfe allerdings stellt auch eine andere Methode zur Verfügung – die Einnahme von Tabletten. Diese Methode ist häufig mit Komplikationen verbunden, etwa Erbrechen, Aspiration des Sterbemittels oder einem verzögerten Todeseintritt. Laut einer Studie, die alle assistierten Suizide in München zwischen 2020 und 2023 auswertete, kam es in sechs von 13 Fällen zu Problemen. Über diese Münchener Studie hinaus berichtet Jakub Jaros vom Verein Sterbehilfe, „dass es bei vier Fällen einfach gar nicht funktioniert hat. Die Leute haben überlebt und mussten zusätzlich am nächsten Tag oder wann auch immer intravenös begleitet werden.“ Gemäß der Münchener Studie waren in den meisten Fällen, in denen Komplikationen auftraten, ausschließlich die Angehörigen vor Ort, während gleichzeitig kein assistierender Arzt oder Ärztin den Sterbeprozess begleitete.
Ein weiterer Faktor, der problematisch sein kann: Assistierte Suizide müssen als unnatürliche Todesfälle der Polizei gemeldet werden. Wenn aber Polizisten zum Sterbeort gerufen werden, die mit den Umständen eines assistierten Suizids nicht vertraut sind, kann es zu belastenden Erlebnissen für Angehörige kommen. Diese brauchen eigentlich emotionale Unterstützung, das Rechtssystem erfordert dagegen Maßnahmen, die sicherstellen sollen, dass der Tod legal war. Sechs Prozent der Teilnehmer der Schweizer Studie berichteten über Schwierigkeiten wegen möglicher Ungereimtheiten im Prozess der Suizidassistenz. Mal war es eine fehlende Unterschrift des Verstorbenen, mal eine leere Flasche Wein, die als Hinweis gedeutet werden konnte, dass die Suizidentscheidung unter Alkoholeinfluss getroffen wurde. Drei Teilnehmende empfanden es als problematisch, dass die Polizei bewaffnet erschien.
Was sagt die Rechtsprechung?
Das entscheidende Kriterium, das straffreie Suizidhilfe von einer strafbaren Tötungshandlung unterscheidet, ist die sogenannte Freiverantwortlichkeit, so hat es das Bundesverfassungsgericht in einem historischen Urteil 2020 entschieden. Demnach hat jeder Mensch das verfassungsmäßig geschützte Recht, sich selbst zu töten und dabei die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen, sofern er seinen Entschluss aus freiem Willen fasst. Die Verfassungsrichter nannten mehrere Bedingungen, die für einen freiverantwortlichen Suizidentschluss gegeben sein müssen. Zum Beispiel muss der Suizidwillige seinen Willen unbeeinflusst von einer akuten psychischen Störung bilden können. Er muss über mögliche Handlungsalternativen informiert sein und sich frei von unzulässigem Druck zur Selbsttötung entschließen. Zudem bedarf eine Entscheidung der Dauerhaftigkeit und inneren Festigkeit.
Seit 2020 wurden bislang zwei Suizidhelfer wegen Totschlags verurteilt, eines der Urteile ist rechtskräftig, das andere noch nicht.
Was muss sich aus Sicht von Angehörigen verbessern?
Der assistierte Suizid sollte weder stigmatisiert noch heroisiert werden – beides erschwert eine wertungsfreie Auseinandersetzung mit dem Geschehen. Sterbehilfeorganisationen müssen ihrer Verantwortung auch für Angehörige nachkommen, indem sie zum Beispiel auf Unterstützungsangebote verweisen. Für Angehörige sollten weitere spezielle Beratungsangebote geschaffen werden. Es braucht eine Regulierung der Suizidassistenz, um Menschen, die in ihrer Autonomie eingeschränkt sind, vor unfreien Suizidentscheidungen zu schützen – und damit auch Angehörige vor dem Zweifel an der Freiveranwortlichkeit des Suizidentschlusses einer geliebten Person.