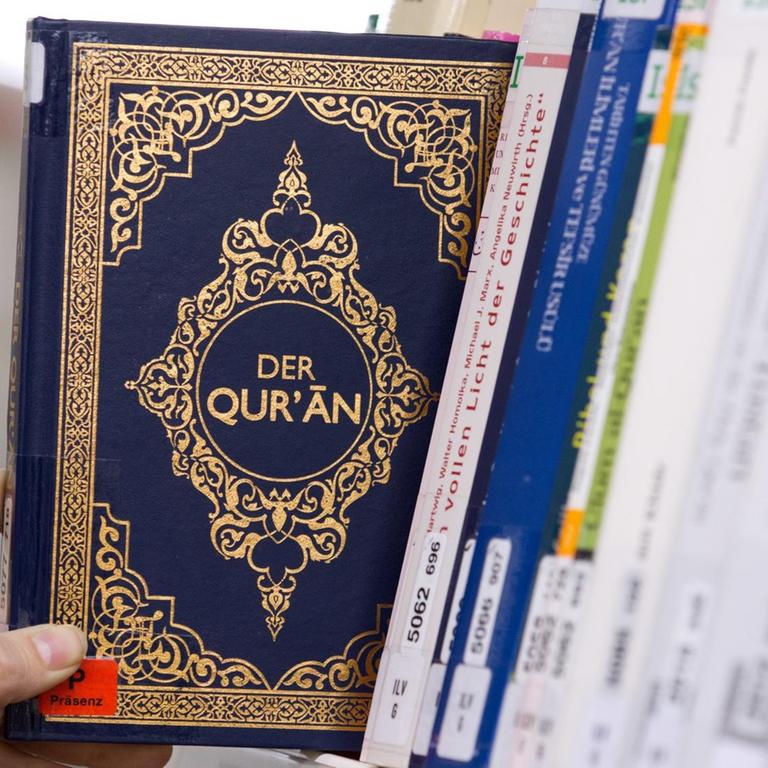"Wie können wir einen Islam in Deutschland fördern, der in unserer Gesellschaft verwurzelt ist, die Werte unseres Grundgesetzes teilt und die Lebensarten dieses Landes achtet? Einen Islam in, aus und für Deutschland, einen Islam der deutschen Muslime."
Horst Seehofer (CSU) im November 2020 auf der Deutschen Islam Konferenz. Zweieinhalb Jahre zuvor klang das noch anders. Im März 2018 stellte die "Bild"-Zeitung dem frisch ernannten Bundesinnenminister die islampolitische Gretchenfrage: "Gehört der Islam zu Deutschland?"
Und Horst Seehofer antwortete damals: Nein, gehöre er nicht. Spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA ist der Islam eines der großen Themen der deutschen Innenpolitik – und wird oft verknüpft mit Fragen der Sicherheitspolitik. Im Fokus standen und stehen: Islamismus, Dschihadismus, Terrorismus. Der Islam als Religion, die Lebensrealitäten von Musliminnen und Muslimen spielten meist nur eine untergeordnete Rolle. Doch Horst Seehofer setzte vor drei Jahren im "Bild"-Interview auch einen anderen Akzent, indem er sagte, dass die in Deutschland lebenden Muslime selbstverständlich dazugehörten.
Islam in deutscher Sprache
Der CSU-Politiker ist nicht nur Innen-, sondern auch Heimatminister. Und inzwischen nutzt er den Begriff "Heimat" auch im Zusammenhang mit dem Islam: "Es geht um die Beheimatung religiöser und kultureller Bestandteile im Leben der deutschen muslimischen Bürger und Bürgerinnen im Rahmen der deutschen Verfassungsordnung und kulturellen Gepflogenheiten."
Seehofer strebt also offenbar einen Islam an, der aus seiner Sicht zur deutschen Verfassung und Kultur passt. Ein wesentlicher Schritt hin zu einem solchen "deutschen Islam" soll die Imam-Ausbildung sein: religiöses Personal für Moschee-Gemeinden, das in Deutschland ausgebildet wird – in deutscher Sprache. Bislang wurden Imame vor allem im Ausland ausgebildet und nach Deutschland entsandt. Das soll sich nun ändern: durch das Islamkolleg Deutschland in Osnabrück.
"Die Grundidee, die dahintersteht, ist, dass wir in Deutschland Imame brauchen, die hier idealerweise geboren, aufgewachsen und sozialisiert sind, um sowohl auf die Bedarfe in den muslimischen Gemeinden, in den Moscheen eingehen zu können, wie auch Brücken in die Mehrheitsgesellschaft bauen können."
Bülent Uçar ist an der Universität Osnabrück Professor für Islamische Theologie und Religionspädagogik. Außerdem ist Uçar Wissenschaftlicher Direktor des Islamkollegs Deutschland. Dieses Kolleg wurde 2019 gegründet – durch islamische Verbände. Das Bundesinnenministerium stieß später als Geldgeber dazu. Das Kolleg ist als Verein organisiert, im April 2021 soll die Ausbildung beginnen.
"Mit dem Islamkolleg haben wir nun eine weitere, wenn Sie so wollen, Autonomisierung der in Deutschland lebenden Muslime", sagt Markus Kerber. Er gilt als "Erfinder" der Deutschen Islamkonferenz. Das Format gibt es seit dem Jahr 2006. Kerber hat es damals aufgebaut – als Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium unter Wolfgang Schäuble (CDU). Zwischenzeitlich war Kerber Hautgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Industrie.
Schnittstelle zwischen Theologie und Verbänden
Seit 2018 ist er nun Staatssekretär im Bundesinnenministerium unter Horst Seehofer – und dort erneut für die Islampolitik zuständig. Das Islamkolleg Deutschland bezeichnet Kerber als: "Eine wichtige Signalfunktion an die in Deutschland lebenden Muslime: Man kann hier als muslimischer Staatsbürger seine Religion - im Rahmen der Religionsfreiheit - nicht nur leben, man kann sie sich auch organisieren."
Das Kolleg soll eine Schnittstelle sein: zwischen der universitären Islamischen Theologie und islamischen Verbänden. In Deutschland gibt es Schätzungen zufolge rund 2500 Moschee-Gemeinden und dutzende islamische Organisationen. Fünf Verbände sind bislang beteiligt am Islamkolleg: der Zentralrat der Muslime, der Zentralrat der Marokkaner, das Bündnis Malikitischer Gemeinden, die islamische Gemeinschaft der Bosniaken und der Verband Muslime in Niedersachsen. Es sind eher kleinere Organisationen. Die mitgliederstärksten deutschen Islamverbände – allen voran die Ditib – sind nicht dabei. Warum, das ist von außen nicht eindeutig nachzuvollziehen. Ein Grund ist sicher, dass die größeren Islamverbände bereits eigene Ausbildungsgänge aufgebaut haben. Das Islamkolleg Deutschland mit Sitz in Osnabrück wird finanziell unterstützt durch das niedersächsische Wissenschaftsministerium und das Bundesinnenministerium.
"Mir ist es lieber, der deutsche Staat fördert dieses Projekt, als etwa ausländische Staaten, die diese Strukturen dann für ihre politischen Ziele nutzen und möglicherweise unguten Einfluss nehmen könnten." Zunächst für fünf Jahre finanzieren die beiden Ministerien das Islamkolleg, pro Jahr mit rund einer Million Euro. Horst Seehofer erklärte, er erwarte: "Dass vor allem die Türkei von nun an Schritt für Schritt die Zahl der nach Deutschland entsendeten Imame reduziert."
Das Islamkolleg ist also nicht nur ein religiöses Projekt, sondern auch ein politisches. Es soll den Einfluss ausländischer Staaten in deutschen Moscheen verringern – vor allem den Einfluss der Türkei durch den deutsch-türkischen Islamverband Ditib.
"Der Konflikt verläuft hier weniger mit einer Religionsgemeinschaft in dem Sinne, sondern eher mit einem Staat, der die Imame nach Deutschland entsendet. Also mit dem türkischen Staat gibt es hier eher einen Konflikt", sagt Yasemin El-Menouar. Sie ist Religionsexpertin der Bertelsmann Stiftung und beobachtet seit langem die deutsche Religionspolitik. El-Menouar gehört auch dem wissenschaftlichen Beirat des Islamkollegs an. Neben dem politischen Einfluss der Türkei soll die deutsche Imam-Ausbildung auch islamistischer Radikalisierung entgegenwirken.
"Ich denke, es ist immer gut, dass wir hier Imame haben, die die Lebenswelten der jungen Muslime hier kennen und somit auch auf die Bedürfnisse der jungen Muslime eingehen können. Also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, warum sich junge Muslime beispielsweise im Internet auf die Suche begeben, wenn sie sozusagen gar keine Anknüpfungspunkte in den Gemeinden finden, weil der Imam vielleicht gar nicht versteht, was gerade so die Themen sind, mit denen sich junge Muslime hier in Deutschland einfach beschäftigen."
"Der Konflikt verläuft hier weniger mit einer Religionsgemeinschaft in dem Sinne, sondern eher mit einem Staat, der die Imame nach Deutschland entsendet. Also mit dem türkischen Staat gibt es hier eher einen Konflikt", sagt Yasemin El-Menouar. Sie ist Religionsexpertin der Bertelsmann Stiftung und beobachtet seit langem die deutsche Religionspolitik. El-Menouar gehört auch dem wissenschaftlichen Beirat des Islamkollegs an. Neben dem politischen Einfluss der Türkei soll die deutsche Imam-Ausbildung auch islamistischer Radikalisierung entgegenwirken.
"Ich denke, es ist immer gut, dass wir hier Imame haben, die die Lebenswelten der jungen Muslime hier kennen und somit auch auf die Bedürfnisse der jungen Muslime eingehen können. Also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, warum sich junge Muslime beispielsweise im Internet auf die Suche begeben, wenn sie sozusagen gar keine Anknüpfungspunkte in den Gemeinden finden, weil der Imam vielleicht gar nicht versteht, was gerade so die Themen sind, mit denen sich junge Muslime hier in Deutschland einfach beschäftigen."
Multiethnisch und multikonfessionell
Um das zu ändern, ist Jugendarbeit ein wichtiger Aspekt im Lehrplan des Islamkollegs. Neben Predigtlehre, Koranrezitation oder Seelsorge soll auch politische Bildung unterrichtet werden.
"Zu Themenfeldern wie der Aufklärung, wie Meinungsfreiheit, Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau", erklärt Bülent Uçar, der Wissenschaftliche Direktor des Islamkollegs. Unter anderem darin unterscheide sich das Kolleg von anderen Einrichtungen zur Imam-Ausbildungen, die es in Deutschland bereits gibt. Seit einigen Jahren bildet die Ditib in der Eifel aus, die Ahmadiyya in Hessen, der Verband der Islamischen Kulturzentren in Köln und die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs in Mainz.
"Zu Themenfeldern wie der Aufklärung, wie Meinungsfreiheit, Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung von Mann und Frau", erklärt Bülent Uçar, der Wissenschaftliche Direktor des Islamkollegs. Unter anderem darin unterscheide sich das Kolleg von anderen Einrichtungen zur Imam-Ausbildungen, die es in Deutschland bereits gibt. Seit einigen Jahren bildet die Ditib in der Eifel aus, die Ahmadiyya in Hessen, der Verband der Islamischen Kulturzentren in Köln und die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs in Mainz.

Doch im Unterschied zu deren Einrichtungen sei das Islamkolleg Deutschland verbandsübergreifend, multiethnisch und multikonfessionell ausgerichtet, sagt Uçar: "Das Zweite ist, dass die Ausbildung ausschließlich in deutscher Sprache stattfindet. Das Dritte ist aber auch, dass wir wegkommen müssen von semiprofessionellen Strukturen und eine strikte wissenschaftliche Orientierung brauchen."
Nur das Islamkolleg ist an eine deutsche Universität angebunden. Und nur das Islamkolleg wird vom deutschen Staat gefördert. Dafür kritisieren manche islamischen Verbände das Kolleg und die beteiligten Ministerien. Etwa die Ditib oder der Islamrat befürchten, dass sich der deutsche Staat zu stark in religiöse Angelegenheiten einmischen könnte. Der niedersächsische Islamverband Schura sprach von einem möglichen "Verfassungsbruch". Und in einer Pressemitteilung der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş heißt es:
"So drängt sich der Verdacht auf, als wolle man mit staatlichen Mitteln den Islam in Deutschland in eine ganz bestimmte Richtung befördern. Ob sich dieses Verhalten mit der verfassungsrechtlich verankerten Neutralitätspflicht des Staates vereinbaren lässt, müssen die Entscheidungsträger auflösen. Fakt ist: Der Staat hat keine Religion oder Weltanschauung – und er darf auch keine haben."
Nur das Islamkolleg ist an eine deutsche Universität angebunden. Und nur das Islamkolleg wird vom deutschen Staat gefördert. Dafür kritisieren manche islamischen Verbände das Kolleg und die beteiligten Ministerien. Etwa die Ditib oder der Islamrat befürchten, dass sich der deutsche Staat zu stark in religiöse Angelegenheiten einmischen könnte. Der niedersächsische Islamverband Schura sprach von einem möglichen "Verfassungsbruch". Und in einer Pressemitteilung der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş heißt es:
"So drängt sich der Verdacht auf, als wolle man mit staatlichen Mitteln den Islam in Deutschland in eine ganz bestimmte Richtung befördern. Ob sich dieses Verhalten mit der verfassungsrechtlich verankerten Neutralitätspflicht des Staates vereinbaren lässt, müssen die Entscheidungsträger auflösen. Fakt ist: Der Staat hat keine Religion oder Weltanschauung – und er darf auch keine haben."
Vorwurf des "Staatsislams"
"Ich meine, prinzipiell ist diese Kritik natürlich berechtigt. Nur in unserem Fall trifft diese Kritik gar nicht zu. Weil zum einen ist die Förderung durch den Staat ja keine Einmischung in die Inhalte, sondern eine Unterstützung unter Beachtung der inhaltlichen Freiheit. Und zum anderen ist auch der Vorwurf des sogenannten 'Staatsislams' meines Erachtens nicht berechtigt, weil wir niemanden dazu zwingen, mitzuarbeiten", erwidert Kolleg-Direktor Uçar. Auch das Bundesinnenministerium weist die Kritik zurück.
"Die kommt zum Teil von Organisationen, die selbst in staatlicher Obhut mit Weisungsrecht aus der Türkei stehen. Und das verwundert mich dann ein bisschen. Wer im Glashaus sitzt, sagen wir in Deutschland, sollte nicht mit Steinen werfen", so Staatssekretär Markus Kerber. Das Ministerium nehme keinerlei inhaltlichen oder theologischen Einfluss auf das Kolleg, sondern fördere lediglich einen Organisationsverbund.
"Na ja, es besteht natürlich nach wie vor die berechtigte Sorge, dass sich der Staat zu stark in religiöse Angelegenheiten einmischt", meint hingegen Yasemin El-Menouar, Religionsexpertin der Bertelsmann Stiftung. "Es wird ja schon auch erwartet sozusagen, dass in diesen Akademien auch eine Form von politischer Bildung erfolgt. Also insofern gibt es da schon ein Interesse, auch ein inhaltliches Interesse seitens des Staates. Gerade, wenn es um die Themen Integration und Extremismusprävention geht. Beides ist durchaus auch im Interesse der muslimischen Gemeinden, aber es kann eben auch sein, dass die eine oder andere Gemeinde sich unter Verdacht gestellt fühlt. Und da denke ich, das Labeln mit ‚politischer Bildung‘ ist aus meiner Sicht nicht ganz so geschickt gewesen. Man hätte das Modul auch einfach ‚Bildungsarbeit‘ nennen können."
"Na ja, es besteht natürlich nach wie vor die berechtigte Sorge, dass sich der Staat zu stark in religiöse Angelegenheiten einmischt", meint hingegen Yasemin El-Menouar, Religionsexpertin der Bertelsmann Stiftung. "Es wird ja schon auch erwartet sozusagen, dass in diesen Akademien auch eine Form von politischer Bildung erfolgt. Also insofern gibt es da schon ein Interesse, auch ein inhaltliches Interesse seitens des Staates. Gerade, wenn es um die Themen Integration und Extremismusprävention geht. Beides ist durchaus auch im Interesse der muslimischen Gemeinden, aber es kann eben auch sein, dass die eine oder andere Gemeinde sich unter Verdacht gestellt fühlt. Und da denke ich, das Labeln mit ‚politischer Bildung‘ ist aus meiner Sicht nicht ganz so geschickt gewesen. Man hätte das Modul auch einfach ‚Bildungsarbeit‘ nennen können."
Und was ist mit Imaminnen?
Weitere Kritik an dem Kolleg kommt von der islamisch-liberalen Seite. "Mit Bedauern und Sorge stellen wir fest, dass insbesondere die Imam*innen-Funktion rein männlich gedacht wird." So heißt es in einer Pressemitteilung des Liberal-Islamischen Bundes. Hintergrund: Das Islamkolleg richtet sich zwar an Männer und Frauen und spricht auf seiner Internetseite von "TheologInnen" oder "SeelsorgerInnen", nutzt für "Imame" aber ausschließlich die männliche Form. Werden also keine Imaminnen ausgebildet?
"Wir als Islamkolleg halten uns da mit einer theologischen Positionierung zurück, weil wir letztlich auch darüber nicht entscheiden, wer als Imam nachher faktisch arbeitet. Sondern das entscheiden alleine die Vorstände der deutschen Moschee-Gemeinden."
Das Kolleg will also auch Frauen ausbilden, wenn diese sich bewerben und die Voraussetzungen erfüllen. Bislang arbeiten in Deutschland nur sehr wenige Imaminnen, genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Und nur in liberalen Gemeinden dürfen Frauen vor der gesamten Gemeinde predigen – und nicht nur vor den Frauen. Liberale Islamverbände sind am Islamkolleg Deutschland allerdings nicht beteiligt.
"Wir als Islamkolleg halten uns da mit einer theologischen Positionierung zurück, weil wir letztlich auch darüber nicht entscheiden, wer als Imam nachher faktisch arbeitet. Sondern das entscheiden alleine die Vorstände der deutschen Moschee-Gemeinden."
Das Kolleg will also auch Frauen ausbilden, wenn diese sich bewerben und die Voraussetzungen erfüllen. Bislang arbeiten in Deutschland nur sehr wenige Imaminnen, genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Und nur in liberalen Gemeinden dürfen Frauen vor der gesamten Gemeinde predigen – und nicht nur vor den Frauen. Liberale Islamverbände sind am Islamkolleg Deutschland allerdings nicht beteiligt.
"Offensichtlich hat sich die Bundesregierung entschieden, ausschließlich mit konservativen Verbänden solch eine Idee umzusetzen", sagt Seyran Ateş. Die Anwältin und Autorin ist Mitbegründerin einer liberalen Moschee in Berlin. Sie kritisiert: "Dass das Bundesinnenministerium mit all seinen Kräften und mit all seinem Wirken verhindert, dass liberale Muslime eine gleichberechtigte Unterstützung bekommen."
Das Ministerium weist diese Kritik zurück. Wer am Islamkolleg beteiligt sei, darauf habe die Politik keinen Einfluss genommen.
"Prinzipiell ist das Islamkolleg Deutschland offen für alle Akteurinnen und Akteure in Deutschland, die in ausreichender Zahl Moschee-Gemeinden unterhalten", sagt Bülent Uçar, der das Islamkolleg initiiert hat. Man habe verschiedene islamische Verbände kontaktiert. Ob darunter auch liberale Verbände waren, bleibt auf Nachfrage offen. Aber: "Da ist halt auch wichtig, dass wir nicht ins Nirwana ausbilden und dass wir auch eine gewisse Akzeptanz haben bei den jeweiligen Gemeinden."
Der liberale Islam gilt also womöglich als zu klein für das Kolleg und als zu wenig akzeptiert. Zum Liberal-Islamischen Bund gehören lediglich fünf Moscheen, und Seyran Ateşs Moschee in Berlin ist ein Einzelprojekt. Für das Kolleg sei sie nicht angefragt worden, sagt Ateş: "Deshalb liegt es jetzt an uns Liberalen, selbst ähnliche Kollegs zu gründen. Akademien, wo wir auch eine historisch-kritische Auslegung des Islam in den Vordergrund stellen."
Weitere Islamkollegs, die vom deutschen Staat gefördert werden? Durchaus denkbar, sagt Staatssekretär Markus Kerber: "Das würden wir anderen in ähnlichen Islamkolleg-Strukturen natürlich genauso ermöglichen."

Kostenlose Ausbildung
Vorerst bleibt es aber beim Islamkolleg Deutschland in Osnabrück. Im April 2021 soll der erste Jahrgang starten. 30 Frauen und Männer sollen dann ausgebildet werden – kostenlos. Bewerben können sich Menschen, die einen Abschluss in Islamischer Theologie haben – idealerweise von einer deutschen Universität – oder die bereits ohne Abschluss in Moscheen arbeiten. Kolleg-Direktor Bülent Uçar hätte sich gewünscht, dass die staatlich geförderte Imam-Ausbildung in Deutschland schon deutlich früher begonnen hätte.
"Als ich 2008, 2009, 2010 diese Themen öffentlich thematisiert habe in deutschen Medien, wollte keiner darüber sprechen, weder aus der Politik, noch aus den Medien. Und wenn man darüber sprechen wollten, wollte man halt nicht handeln."
Seit über zehn Jahren gibt es Lehrstühle für Islamische Theologie an mehreren deutschen Universitäten. Damit war der wissenschaftliche Grundstein gelegt für die Imam-Ausbildung. Aber der praktische Teil der Ausbildung fehlte bislang.
"Erst die politische Situation im Ausland hat die Politik so sehr in Deutschland unter Druck gesetzt, dass sie auch tatsächlich aktiv geworden ist." Gibt es das Islamkolleg jetzt also vor allem, weil dadurch der Einfluss der Türkei und anderer Staaten in Deutschland zurückgedrängt werden soll? Markus Kerber, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, spielt den Ball zurück an die Islamverbände: "Für uns war das eher eine logische Entwicklung, die wir uns immer erwünscht hatten, die wir aber nie steuern konnten."
"Als ich 2008, 2009, 2010 diese Themen öffentlich thematisiert habe in deutschen Medien, wollte keiner darüber sprechen, weder aus der Politik, noch aus den Medien. Und wenn man darüber sprechen wollten, wollte man halt nicht handeln."
Seit über zehn Jahren gibt es Lehrstühle für Islamische Theologie an mehreren deutschen Universitäten. Damit war der wissenschaftliche Grundstein gelegt für die Imam-Ausbildung. Aber der praktische Teil der Ausbildung fehlte bislang.
"Erst die politische Situation im Ausland hat die Politik so sehr in Deutschland unter Druck gesetzt, dass sie auch tatsächlich aktiv geworden ist." Gibt es das Islamkolleg jetzt also vor allem, weil dadurch der Einfluss der Türkei und anderer Staaten in Deutschland zurückgedrängt werden soll? Markus Kerber, Staatssekretär im Bundesinnenministerium, spielt den Ball zurück an die Islamverbände: "Für uns war das eher eine logische Entwicklung, die wir uns immer erwünscht hatten, die wir aber nie steuern konnten."
Weil die Initiative von den Islamverbänden selbst kommen sollte und erst jetzt gekommen sei. Yasemin El-Menouar von der Bertelsmann Stiftung sieht es kritisch, dass es eine staatlich geförderte deutsche Imam-Ausbildung ohne die wachsende Sorge vor ausländischem Einfluss wohl noch immer nicht geben würde. Zugleich stellt sie allerdings auch fest:
"Dass wir hier mit dem Islamkolleg einen weiteren Meilenstein eben haben hin zu einer Anerkennung des Islam in Deutschland als deutsche Normalität. Es gibt einen Wandel in der Islampolitik in dem Sinne, dass sich der Staat oder die Politik der religiösen Vielfalt zunehmend geöffnet hat. Auf der anderen Seite bleiben aber diese sicherheitspolitischen Erwägungen nach wie vor im Blick. Und insofern ist es beides: Kontinuität und Wandel."
Der Wandel im politischen Umgang mit Islam, Musliminnen und Muslimen drückte sich in den vergangenen 15 Jahren auch in anderen Projekten aus: angefangen bei der Deutschen Islam Konferenz, über die Islamische Theologie an Universitäten und ein islamisches Studienwerk, bis hin zum "Unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit". Den hat das Bundesinnenministerium 2020 gegründet, um nach dem Anschlag von Hanau Strategien gegen Muslimfeindlichkeit entwickeln zu lassen.

Yasemin El-Menouar gehört auch diesem Expertenkreis an. Für sie sind die Projekte: "Wichtige Schritte in die Richtung, dass auch wirklich die Belange der Muslime als Religionsgemeinschaft anerkannt werden und diese auch berücksichtigt werden in der Islampolitik."
Trotzdem bleibt die Islampolitik auch Teil der Sicherheitspolitik. Denn warum fördert das Bundesinnenministerium die Imam-Ausbildung? "Wenn Sie so wollen, für den inneren Frieden unserer Gesellschaft", sagt Staatssekretär Markus Kerber. Damit insbesondere junge Musliminnen und Muslime vor Extremismus besser geschützt seien, sollen die Imame, die mit den jungen Menschen arbeiten, im Sinne des deutschen Staates ausgebildet werden. Sie sollen einen Islam "für Deutschland" vermitteln, wie Horst Seehofer es ausdrückte. Gewissermaßen ein Islam im Dienst der deutschen Sicherheits-politik. Auf die meisten deutschen Musliminnen und Muslime und ihre Verbände schaue er allerdings bereits anders als früher, sagte der Bundesinnenminister bei der Islamkonferenz:
"Sie wollen diese Gesellschaft und dieses Land stärken, statt mit Gewehren und Messern zu morden." Doch dieser Satz macht auch deutlich: Das Verhältnis des deutschen Staates zu seinen muslimischen Bürgerinnen und Bürgern – gänzlich entspannt hat es sich noch nicht. Der Ausbildungsstart am neuen Islamkolleg kann aber ein weiterer Schritt sein auf diesem langen Weg.
Trotzdem bleibt die Islampolitik auch Teil der Sicherheitspolitik. Denn warum fördert das Bundesinnenministerium die Imam-Ausbildung? "Wenn Sie so wollen, für den inneren Frieden unserer Gesellschaft", sagt Staatssekretär Markus Kerber. Damit insbesondere junge Musliminnen und Muslime vor Extremismus besser geschützt seien, sollen die Imame, die mit den jungen Menschen arbeiten, im Sinne des deutschen Staates ausgebildet werden. Sie sollen einen Islam "für Deutschland" vermitteln, wie Horst Seehofer es ausdrückte. Gewissermaßen ein Islam im Dienst der deutschen Sicherheits-politik. Auf die meisten deutschen Musliminnen und Muslime und ihre Verbände schaue er allerdings bereits anders als früher, sagte der Bundesinnenminister bei der Islamkonferenz:
"Sie wollen diese Gesellschaft und dieses Land stärken, statt mit Gewehren und Messern zu morden." Doch dieser Satz macht auch deutlich: Das Verhältnis des deutschen Staates zu seinen muslimischen Bürgerinnen und Bürgern – gänzlich entspannt hat es sich noch nicht. Der Ausbildungsstart am neuen Islamkolleg kann aber ein weiterer Schritt sein auf diesem langen Weg.