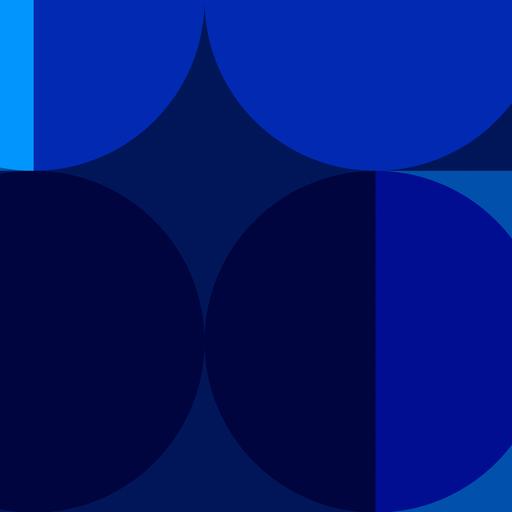Es ist vor allem die Leidenschaft für Osteuropa, die Gernot Erler seit vielen Jahrzehnten begleitet. Erst als Jugendlicher in Westberlin, später als Student, ab 1987 als Abgeordneter für die SPD im Bundestag.
30 Jahre gehörte Gernot Erler dem Parlament an. Er war unter Rot-Grün stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für Außenpolitik, in der folgenden Großen Koalition Staatsminister im Auswärtigen Amt, ab 2014 "Russland-Beauftragter" der Bundesregierung. Ämter, in denen Gernot Erler mit großen politischen Herausforderungen konfrontiert war.
Ende der 1990er-Jahre wurde hitzig über die deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg diskutiert, wenig später ging es um den Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Gernot Erler musste die politischen Mehrheiten organisieren. Als Russland 2014 die Krim annektierte und der Krieg in der Ostukraine begann, war seine Osteuropa-Expertise gefragt. Eine Zeit, die Spuren in seiner politischen Biografie hinterlassen hat – und auch zu persönlichen Enttäuschungen führte.
2017 schied Gernot Erler aus dem Bundestag aus. Die großen außenpolitischen Fragestellungen aber beschäftigen den in Freiburg lebenden Sozialdemokraten bis heute.
Eine Kindheit und Jugend in Westberlin
Frederik Rother: Ich würde zu Beginn gerne etwas zurückschauen. In diesem Jahr, 2020, jährt sich zum 75. Mal das Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie sind 1944 geboren. Haben Sie denn in der letzten Zeit öfters mal zurückgedacht an diese einschneidenden Jahre?
Gernot Erler: Ich habe eigentlich regelmäßig zurückgedacht, besonders an diesem Termin, weil eben dieser Termin auch für mich und meine Familie wichtig war. Wenige Tage oder wenige Wochen vor Ende des Krieges ist mein Vater an der Ostfront gefallen, ist in Borna bei Leipzig begraben, und ich habe immer mich mit dieser Zeit und mit dieser Geschichte auch schon vor meinem Studium beschäftigt.
Rother: Jetzt sagen Sie, Ihr Vater ist kurz vor Kriegsende an der Ostfront gefallen. Wie war das denn im Nachkriegsdeutschland, ohne Vater aufzuwachsen?
Erler: Man konnte noch nicht mal zu dem Grab hingehen, und es war eben so, dass meine Mutter einer Kriegerwitwe war mit zwei kleinen Kindern, und der Mann war gefallen, der Großvater verschollen, und es waren also meine Mutter und meine Großmutter, und sie mussten eben versuchen - ohne eine Pension für meinen Vater zu kriegen - durchzukommen. Das ging nur dadurch, dass die Großmutter gearbeitet hat. Das hat sich dann erst verbessert, als die Bundeswehr wieder aufgebaut wurde. Dann hat man die Situation der Kriegerwitwen deutlich verbessert. Dann kriegten wir eine Pension, weil mein Vater war Berufssoldat und Majorsrang, gefallen, hatte aber zu wenig Dienstjahre. Dann ging es uns besser, aber ich habe natürlich die Erinnerung an die schweren Jahre, wo es auch nicht einfach war, die Kinder satt zu kriegen.
Rother: Wie sah das aus, diese schwierige Zeit?
Erler: Die sah aus: umgeben von dem zerbombten Berlin, Trümmergrundstücke als Spielplatz für kleine Kinder, zu Essen eben gerade so, dass man satt werden konnte, aber doch mit etwas eintönigen Gerichten. Ich besinne mich noch an die Erbswurstsuppe. Das war so eine Rolle, die man kaufen konnte, wo dann Suppe aus den Einzelteilen gemacht werden konnte. Das hat es nicht selten gegeben. Oder so Gerichte wie Himmel und Erde, also einfach Äpfel und Kartoffeln zusammen in einem Gemüsetopf und ähnliche Dinge. Man hatte schon manchmal etwas zu wenig von dem Essen.
Rother: Wir sind jetzt in Westberlin. Also Sie sind in Meißen geboren und dann in Westberlin aufgewachsen in den 50er-Jahren. Hat Sie diese Zeit, die Sie eben beschrieben haben, hat Sie die geprägt?
Erler: Ja, also natürlich nicht die Kindheitszeit, sondern dann die Zeit, wo ich etwas wacher das wahrgenommen habe, was um mich herum war. Da tauchten natürlich schon Fragen auf, wie ist das gekommen, dass ich in einer geteilten Stadt lebe, dass da 1961 eine Mauer gebaut wurde vor meinen Augen. Ich habe dann 1963 den Besuch von John F. Kennedy in Berlin erlebt, aber eben im November dann auch der Schock über seine Ermordung. Wir konnten aus Berlin praktisch nie raus, dazu fehlten auch die Geldmittel. Wir sind ein-, zweimal mit einem Milchwagen mitgefahren in den Kabinen. Das kostete nicht so viel, da nach Westdeutschland durch die Zone, wie man damals sagte, zu fahren zu einer Freundin von meiner Mutter. Das war zweimal in meiner ganzen Jugendzeit als Schüler, dass ich überhaupt aus der Stadt rauskam. Da können Sie sich denken, dass ich mich damit beschäftigt hab. Der Vater gefallen in einem Krieg zwischen Ost und West, zwischen Nazi-Deutschland und Russland, der Sowjetunion, und auf diese Weise kam das zustande, dass ich mir vorgenommen habe, mich mit den Hintergründen dieses biografischen Schicksals zu beschäftigen. So bin ich auf die Idee gekommen, mich mit dem Osten intensiver auseinanderzusetzen.
Mit Interesse in die Sowjetunion
Rother: Sie haben 1963 Ihr Studium angefangen, Geschichte, slawische Sprachen und Politik. Da schimmert ja Ihr politisches Lebensthema schon durch, also Osteuropa, Russland. Ich finde das ungewöhnlich im Kalten Krieg. Wie kam es dazu?
Erler: Ja, weil ich das Gefühl habe, dass der Kern der Sache in diesem Ost-West-Verhältnis besteht und man natürlich viel mehr Wissen über den Westen hatte, auch durch die Schule und dann auch natürlich durch die Möglichkeiten, das zu studieren. Während ich doch das Gefühl habe, dass das Wissen und das Engagement mit dem Osten, vor allen Dingen mit den Nachbarn, mit Polen und Tschechien, damals noch Tschechoslowakei, und dann mit der Sowjetunion, dass das viel weniger waren, die sich damit beschäftigten. Da schien mir ein Defizit zu sein, und da habe ich gedacht, das ist mein Thema. Das hat sich dann nachher herausgestellt, dass es ein Lebensthema war, und ich hatte das unglaubliche Privileg, dass ich eigentlich in 20 Berufsjahren und 30 Jahren als Berufspolitiker dieses Thema immer weiter vertiefen konnte und mich damit beschäftigen konnte. Das ist ja nicht selbstverständlich.
Rother: Sie haben Ihr Studium 1963 begonnen in West-Berlin, es vier Jahre später in Freiburg abgeschlossen und waren dann danach wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für osteuropäische Geschichte, und in diesem Jahr, 1970, fand ein sechsmonatiger Forschungsaufenthalt statt in Moskau und Leningrad, an dem Sie teilnehmen konnten. Vom beschaulichen Freiburg im Breisgau quasi ins Herz der Sowjetunion, wenn man so möchte. Wie war das, war das eine andere Welt?
Erler: Ja, das war eine andere Welt, und das war also möglich durch ein Programm und ein Stipendium von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, zu dem ich eingeladen wurde. Ich hatte damals ein wissenschaftliches Interesse an der frühsowjetischen Kulturpolitik, und da hatte ich die große Chance, also nicht nur in großen Bibliotheken zu arbeiten, wie etwa der berühmten Lenin-Bibliothek in Moskau, sondern auch in Leningrad, wie es damals hieß, und auch in Archive Einblick zu bekommen. Das war also ein wirklich spannender Teil meines Lebens, dort in dieser Zeit in der Sowjetunion zu sein. Wir waren in diesem damaligen Jahrgang der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, nur zehn junge Wissenschaftler, die im Austausch in der Sowjetunion arbeiten konnten. Das heißt, daran sieht man, dass das die allerersten Anfänge waren.
Rother: Wie muss ich mir denn den Alltag vorstellen im Moskau der 70er-Jahre oder auch in Leningrad, im Leningrad der 70er-Jahre?
Erler: Also auf jeden Fall aufreibend war der Alltag, weil zum Beispiel weite Wege zu gehen waren von den verschiedenen Einrichtungen, von der MGU, der Moskauer Staatsuniversität, zu der Lenin-Bibliothek und wieder zurück und zu anderen Städten, wo man gearbeitet hat. Taxis waren immer ein Problem. Die Taxifahrer, die fragten immer, wo man hinwill, und wenn man nicht in die Richtung wollte, die sie fahren wollten, dann haben sie einen stehen lassen. Das vor allen Dingen abends und nachts, wenn man mal mit Freunden unterwegs war, immer ein Problem. Im Gedächtnis bleibt natürlich auch die Community, die man vorfand in der Staatsuniversität, wo aus aller Herren Länder junge Studenten zusammenkamen, auch aus Afrika, aus Asien, aus der DDR. Da traf man sich mit der Lingua franca Russisch. Also das war die Verkehrssprache zwischen allen. Das sind dann Beziehungen zu Menschen gewesen, die also unvergessen geblieben sind in dieser ganz besonderen Atmosphäre der Staatsuniversität auf den Lenin-Sperlingsbergen.
Mit Idealismus in die SPD
Rother: Prägende Zeiten also. 1970 sind wir jetzt. Das war ja auch in anderer Hinsicht ein wichtiges Jahr für Ihre politische Prägung. Sie sind nämlich in diesem Jahr, 1970, in die SPD eingetreten. Warum sind es die Sozialdemokraten geworden?
Erler: Ja, das hing auch wieder mit meinem Lebensthema zusammen, weil es ging um die Ost- und Friedenspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr. Das hat mir natürlich sehr imponiert, was damals erreicht wurde mit den Ostverträgen, mit Moskau, mit Polen, mit der Tschechoslowakei.
Rother: Das war ja auch alles in diesem Jahr, 1970.
Erler: Zwei Verträge davon waren 1970, das war der Moskauer Vertrag und der Warschauer Vertrag. In dieses Jahr fiel ja auch der berühmte Kniefall im Dezember 1970 von Willy Brandt vor dem Ghettodenkmal in Warschau, was mich sehr beeindruckt hat. Darauf bekam er dann auch den Friedensnobelpreis im Jahr darauf. Ich war eben begeistert für diese Ostpolitik, weil ich das Gefühl hatte, auf diese Weise könnte diese unheilvolle Feindseligkeit zwischen den Blöcken aufgelöst werden und damit auch ein Schritt zur Einigung in Deutschland getan werden. Da war ich engagiert. Dann im April 1970 habe ich mich dann entschlossen, in die SPD einzutreten, also vor 50 Jahren.
Rother: Wegen Willy Brandt, wenn man so möchte. Also sind Sie Generation Willy?
Erler: Ja, ich bin Generation Willy. Also wenn man Leute, die 40 bis 50 Jahre in der SPD sind, fragt, warum bist du denn eingetreten, dann kriegt man eigentlich durchgängig die Antwort: wegen Willy Brandt, der ja eine sehr eindrucksvolle Figur war. Aber bei mir ging es nicht nur um das Beeindruckende seiner Figur und seines Verhaltens. Er ist sehr schwer bekämpft worden und beschimpft worden und auch beleidigt worden und hat aber diesen enormen Mut aufgebracht, zu sagen, ich weiß, dass ich bisher für meine Politik keine Mehrheit habe, aber im Wahlkampf dann von 1972, Bundestagswahlkampf, hat er nicht einen Zentimeter zurückgewichen von seiner Politik und hat also sozusagen das zu einer Schicksalswahl gemacht und ist für seinen Mut belohnt worden, mit dem besten Ergebnis von, ich glaube, 45,8 Prozent der Stimmen für die SPD. Ich fand das ein Vorbild, und nicht nur ich. Für viele ist das ein Vorbild geworden, dieses Verhalten, nicht nach Umfragen zu gucken und zu schauen, wo sind die Mehrheiten, wo kann ich hin, sondern zu sagen, ich habe ein Programm, und ihr könnt jetzt abstimmen, ja oder nein, und ich gehe volles Risiko. Ich fand das angebracht, also diese Waagschale, weil aus meiner Sicht das ein neues Kapitel in dem Verhältnis zwischen Ost und West eröffnete. Das hat sich ja dann auch bestätigt.
Rother: Aber, Sie haben es erwähnt, es wurde hart gekämpft, hart gerungen, und die Ostpolitik stieß in konservativen Kreisen, in der Union, aber auch in Teilen der SPD, natürlich auf Widerstand. Konnten Sie denn diese Bedenken verstehen?
Erler: Ja, darüber haben wir uns sehr aktiv auseinandergesetzt. Es gab – haben Sie vollkommen recht – allerdings auch sehr unschöne Kampfmittel, die da eingesetzt worden sind, der Diffamierung, der Beleidigung und so weiter. Das war eine Herausforderung, auch für die politische Kultur in Deutschland. Es wird, sag ich mal, bis heute in Erinnerung bleiben, dass trotz dieser Einsätze von gewalttätigen Worten zumindest und von beleidigenden Worten sich doch diese Politik durchgesetzt hat. Das ist eine Lehre auch, die wir aus dieser Geschichte behalten.
Herausforderungen im Bundestag
Rother: Die SPD hat oft mit sich selbst und mit der Außenpolitik gerungen. Es gab die schwierige Debatte in den 70er-Jahren – Sie haben es gerade angedeutet –, die Nachrüstungsdebatte Anfang der 80er. Ich würde gern zeitlich etwas nach vorne springen in das Jahr 1999. Damals greift die NATO in Serbien, im damaligen Jugoslawien, ein - ohne UN-Mandat. Es war der erste Kampfeinsatz von deutschen Bundeswehrsoldaten nach dem Zweiten Weltkrieg, unter Rot-Grün, muss man sagen. Sie haben dem zugestimmt. Wie schwer war das für Sie?
Erler: Ja, das ist, sage ich mal, die Kurzform von einem Prozess, der mich wirklich sehr beansprucht hat. 1998 bin ich stellvertretender Fraktionsvorsitzender, zuständig für Außen-, Sicherheits-, Menschenrechts- und Entwicklungspolitik, geworden. Das heißt, ich war zuständig auch für diese ganze Frage Kosovo und hatte die Aufgabe, im Grunde genommen zu versuchen, die Fraktion zusammenzuführen bei diesem Thema, und natürlich weg von der Regierung unter Gerhard Schröder. Das war ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen, gerade auch für mich, weil ich aus der Friedensbewegung kam und dort sozusagen vieles mitgebracht hatte in meine politische Arbeit als Full-Time-Politiker und das natürlich jetzt auf die Probe gestellt wurde bei dieser Frage. Das Problem war ja, dass im Grunde genommen zwei Dinge gegeneinanderstanden: Auf der einen Seite das Souveränitätsrecht der Staaten, das selbstverständlich verbot, einfach militärisch in einem anderen Land einzugreifen, aber auch das Gebot, massive Menschenrechtsverletzungen nicht einfach hinzunehmen und beiseite zu gucken. Genau das war ja in dem Kosovokrieg der Fall, dass hier Milosevic damals die albanische Bevölkerung zu Hunderttausenden vertrieben hat aus dem Kosovo.
Damals gab es einen UN-Vorsitzenden, Kofi Annan, der hat sehr schnell erkannt, dass es sich hier auch um ein Problem für das Völkerrecht handelt und hat von einer Grauzone gesprochen. Das war dann auch sozusagen die Formel, mit der ich versucht habe, Mehrheiten zu bilden, dass ich gesagt habe, beides gilt, beides ist richtig, das Gebot, schwere Menschenrechtsverletzungen nicht zuzulassen und natürlich auch das Völkerrecht mit der Souveränitätssituation anderer Länder anzuerkennen. Da ist eben eine Grauzone, weil das damals noch nicht geregelt war, wie das ist mit den Menschenrechtsverletzungen. Das ist dann später versucht worden, im Völkerrecht zu regeln, aber damals gab es das noch nicht, und das war eine ganz schwierige Auseinandersetzung.
Der Kosovokrieg und seine Folgen - Historikerin: Eine Lösung wäre möglich
Vor 20 Jahren endete der Krieg im Kosovo. Das Verhältnis zum einstigen Kriegsgegner Serbien ist jedoch noch immer angespannt. Eine Stabilisierung des Verhältnisses sei aber möglich, so die Historikerin Marie-Janine Calic im Dlf.
Vor 20 Jahren endete der Krieg im Kosovo. Das Verhältnis zum einstigen Kriegsgegner Serbien ist jedoch noch immer angespannt. Eine Stabilisierung des Verhältnisses sei aber möglich, so die Historikerin Marie-Janine Calic im Dlf.
Rother: Was hat Sie dann letztlich dazu bewogen, dem Einsatz zuzustimmen?
Erler: Sie müssen sich Folgendes vorstellen: Ich werde das nie vergessen, den Oktober 1998, wo die Bundestagswahlen rum waren und eine neue Regierung gebildet wurde, die sich viel vorgenommen hatte, auch mit friedenspolitischen Ideen im Rucksack sozusagen, aber das Primat sollte unter Gerhard Schröder in der Reformpolitik im Innern des Landes liegen. Nach den 16 Jahren Kohl, die so etwas bleiern geendet hatten, war da ein Aufbruch erwartet und auch angesagt, und plötzlich kommt dann diese Frage von der NATO: Wir machen jetzt ein Ultimatum gegen den Milosevic, und die Frage ist, macht ihr mit oder nicht. Natürlich, wir hatten einen grünen Außenminister. Ich besinne mich noch an eine Reise nach New York im Wahljahr, wo ich über Deutschland was erzählen wollte und plötzlich mich alle nur noch gefragt haben, was ist denn das mit dem grünen Außenminister, was bedeutet das, heißt das, dass Deutschland aus der NATO austritt? Das heißt, solche Befürchtungen waren schon ohne den Kosovo-Konflikt bei den westlichen Partnern und Freunden ganz akut, weil die sich nicht vorstellen konnten, was eine rot-grüne Regierung anstellt mit der bisherigen Tradition der deutschen Politik. Da kann man sich vorstellen, was das bedeutet hätte, wenn als erster Akt diese neue Regierung nein gesagt hätte zu dem Druck auf Milosevic.
Das war ja sozusagen die Vorgeschichte des Krieges. Kein Mensch hatte sich vorstellen können, dass der jugoslawische Präsident da tatsächlich es wagen würde, ein NATO-Ultimatum einfach beiseite zu legen. Als er das dann gemacht hat, gab es eine Automatik. Dann gab es noch einmal Versuche, miteinander zu reden, verschiedene Konferenzen, und als das alles nichts nützte, dann waren wir automatisch plötzlich im Krieg. So ist das gewesen damals, und das war ein Schock für alle, weil das natürlich bedeutete, dass plötzlich die Außenpolitik in der dramatischen Form, die man sich vorstellen konnte, sozusagen alle innenpolitischen Pläne beiseiteschob. Das hat dann also diese neue Bundesregierung beschäftigt bis zum Gehtnichtmehr.
Erst der Kosovo, dann Afghanistan
Rother: Aber das heißt, der Druck kam von außen, und das war das entscheidende Moment, was dazu beigetragen hat, diesem Einsatz zuzustimmen?
Erler: Also ich bin bis heute noch überzeugt, dass, wenn das nicht gelungen wäre, diese Mehrheiten zu bekommen und die auch argumentativ zu bekommen, dass dann dieses rot-grüne Experiment sehr schnell beendet gewesen wäre. Das hätten wir nicht durchgehalten, wenn der erste Schritt gewesen wäre, sozusagen aus der NATO-Gemeinschaft auszutreten und dann das sich vielleicht fortgesetzt hätte 2001, das hätte nicht glücken können. Das war uns allen klar.
Rother: Sie waren Vizefraktionschef, das haben Sie gesagt. Gab es denn starken Druck aus der Regierung von Gerhard Schröder, dass Sie da die Fraktion auf Linie bringen, als es um den Einsatz im Kosovo ging?
Erler: Ja, also ich würde es anders ausdrücken. Es war meine Aufgabe im Grunde genommen, den Dialog herzustellen zwischen den zwei verschiedenen Positionen innerhalb der Fraktion und natürlich dann am Ende eines solchen Dialoges auch Entscheidungen zu haben, die hoffentlich von der Mehrheit getragen wurden. Das war tatsächlich die Erwartung an mich und mein Portfolio, was ich da als stellvertretender Fraktionsvorsitzender zu vertreten hatte.
Rother: Also die Erwartung, dass Sie den Laden zusammenhalten.
Erler: Ja, und das wiederholte sich dann zwei Jahre später noch mal, denn da war ja eine ähnlich harte Auseinandersetzung über den Einsatz in Afghanistan auf der Tagesordnung. Das heißt, es war nicht ein Einzelfall, sondern es ging weiter.
Rother: Afghanistan ist ein gutes Stichwort. Das war Ende 2001 Thema im Bundestag. Bis heute sind Bundeswehrsoldaten im Einsatz, etwas mehr als 1.000, mehr als 50 sind in den letzten Jahren dort gefallen in Afghanistan. Wussten Sie, als Sie damals diesem Einsatz zustimmten, dem Afghanistan-Einsatz, wussten Sie, was da auf Sie zukommt?
Erler: Nein, natürlich nicht. Das wusste ich genauso wenig wie die anderen. Es war natürlich insofern eine andere Situation, als also der Teil des Afghanistan-Einsatzes, bei dem auch Deutsche beteiligt waren, in jedem Fall dem Völkerrecht entsprochen hat, weil es entsprechende Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats gegeben hatte. Also insofern musste man nicht sich verteidigen gegen den Vorwurf, dass es hier um Völkerrecht geht, das gebrochen wird, sondern es ging eher um die Frage, wie realistisch sind die Chancen, einen solchen Konflikt von außen mit militärischen Mitteln zu entscheiden. Das hat einen Lernprozess ausgelöst ab 2001, wo ich heute nur zusammenfassend sagen kann, es hat sich gezeigt – da kam natürlich auch noch der Irakkrieg ab 2003 dazu –, es hat sich gezeigt, dass eine solche massive militärische Intervention nicht geeignet ist, um einen dauerhaften Frieden zu schaffen, den es heute noch nicht gibt, um den heute noch politisch gerungen wird.
Das Ganze hat sich ja dann noch mal dramatisch verstärkt in dem Irakkrieg, wo scheinbar nach kurzer Zeit ein militärischer Sieg da war, aber dann hinterher ein Zerfall des Landes stattgefunden hat. Insofern kommt man zu einer insgesamt doch sehr, sehr kritischen Bilanz dieser Kriegsereignisse von 1998 bis heute, weil im Grunde genommen die Probleme verdoppelt und verdreifacht worden sind durch diese militärischen Einsätze. Aber das hat natürlich damals, als es aktuell entschieden werden musste, noch kaum jemand auf dem Schirm gehabt, obwohl ich mich dran besinne, dass wir damals bestimmte Papiere, vor allen Dingen zum Irakkrieg dann geschrieben haben, wo eine Prognose darüber, was das für die Gesamtregion bedeuten könnte, schon drin waren. Aber da waren wir uns einig, dass es keine deutsche Beteiligung gibt und dass auch die Begründung für diesen Irakkrieg ja herbeigemogelt wurde. Das ist ja bekannt.
"Groteske Fehleinschätzung" der Auslandseinsätze
Rother: Ja, Gerhard Schröder, der sprach, als es um Afghanistan ging, noch von einem kurzen, gezielten Einsatz.
Erler: Ja, das haben wir gedacht. Das war beim Kosovokrieg übrigens genauso. Auch da kam von der militärischen Seite in Deutschland die Ankündigung, das dauert eine Woche. Nachher hat das über 70 Tage gedauert.
Rother: Wurden Sie schlecht beraten?
Erler: Na ja, auf jeden Fall war das eine groteske Fehleinschätzung dessen, was da passiert. Das habe ich auch nicht vergessen.
Rother: Jetzt rütteln beide Auslandseinsätze, also der Kosovo wie auch Afghanistan, ja am Selbstverständnis von vielen in der SPD, die Außenpolitik eigentlich als Friedenspolitik sehen. Was würden Sie rückblickend sagen? Ist es mit diesem Thema – also Außenpolitik ist auch Friedenspolitik –, ist es damit um die Jahrtausendwende vorbeigewesen?
Erler: Naja, also wenn ich die deutsche Politik ansehe, dann stelle ich fest, dass in den Jahren, wo eigentlich andere Prioritäten stehen sollten, die Priorität auf die Außenpolitik zurückfiel über den Kosovokrieg und Afghanistankrieg und dann aber doch, was Deutschland angeht, ein entscheidender Schritt in die andere Richtung vollzogen wurde mit Gerhard Schröders Ablehnung der Beteiligung an dem Irakkrieg. Das hat dann sozusagen eine neue Linie aufgemacht und hat dann auch geholfen, zu verstehen, dass insgesamt die Fragen, ob man solche komplizierten Konflikte militärisch überhaupt lösen kann, dann doch sehr kritisch in der Öffentlichkeit diskutiert worden sind und dann auch den Weg öffneten für eine andere Politik, eine andere Krisenpolitik.
Rother: Dabei ringt die SPD ja bis heute mit ihren außenpolitischen Positionen. Also ich denke, an den Fraktionschef im Bundestag, an Rolf Mützenich, der erst vor Kurzem die nukleare Teilhabe infrage gestellt hat über die Medien. Das hat dann direkt Widerspruch hervorgerufen, auch in der SPD selbst vom Außenminister, vom Vizekanzler. Das zeigt doch, dass immer noch gerungen wird über die richtige außenpolitische Haltung. Wie soll denn die Ihrer Meinung nach aussehen?
Erler: Also ich finde es völlig normal und auch wichtig, dass über außen- und sicherheitspolitische Fragen gerungen wird und dass da auch also unterschiedliche Auffassungen herrschen. Das ist nicht ein typisches Merkmal der SPD, das ist, sage ich mal, ein Normalzustand. Was diese nukleare Teilhabe angeht und die Existenz von amerikanischen Atombomben auf deutschem Boden, das ist lange bekannt, und das ist insofern also nicht neu erfunden von Rolf Mützenich, hier das noch mal zur Debatte zu stellen, sondern das hat uns schon ein paar Mal in der Politik sehr intensiv beschäftigt. Ich glaube nur, dass es schwierig ist, das sozusagen alleine von Deutschland her zu regeln. Ich glaube, es sind ja fünf Länder insgesamt in Europa, die von diesen Stationierungen amerikanischer Atomwaffen betroffen sind. Ich würde dafür plädieren, dass man mit diesen Ländern Kontakt aufnimmt und natürlich am Ende auch einen transatlantischen Dialog dazu braucht, denn eine einseitige Aktion hier wird das Problem, dass Europa gefährdet ist durch die Stationierung von Atomwaffen – und das steckt ja dahinter, hinter dieser Kontroverse –, wird das nicht lösen.
Schwieriger Umgang mit Russland
Rother: Herr Erler, das zweite Großthema in Ihrer Zeit als Abgeordneter im Deutschen Bundestag, das ist Russland, vor allem seit 2014, also seitdem es ja zur Krim-Annexion kam, zum Krieg in der Ostukraine. Sie waren damals Russland-Koordinator der Bundesregierung. Wie haben Sie denn, als das alles losging, diese Zeit erlebt? Konnten Sie noch ruhig schlafen?
Erler: Also das war natürlich für jemanden, der sich nicht alleine mit Russland beschäftigt hat, sondern auch mit Osteuropa und damit auch mit der Ukraine, ein absoluter Schock, was da passiert ist. Insofern, als hier die europäische Friedensordnung, die über viele Jahrzehnte entstanden ist und auch mit Zustimmung und Mitwirkung der Sowjetunion und später der Russischen Föderation entstanden ist, schwer beschädigt wurde und ja bis heute nicht einer Regelung den Weg gemacht hat, sondern wir haben heute noch, wie 2014, eine Situation, wo täglich gekämpft wird, wo jede Woche Opfer zu beklagen sind an der line of contact, also der Kontrolllinie, die zwischen den Kämpfenden da in der Ostukraine besteht, und das, obwohl immer wieder zurückgewiesen wird auf die entsprechenden Beschlüsse, die gefasst worden sind, und die Äußerungen, die bei den Gipfeltreffen im Normandie-Format gemacht worden sind. Trotzdem wird einfach immer weitergekämpft, und keiner hat richtig die Verantwortung dafür übernommen.
Rother: Als die Kämpfe eskalierten und es zur Annexion der Krim kam, war da auch eine militärische Antwort auf Russlands Verhalten eine Option?
Erler: Also nach meiner Kenntnis nicht. Ob es irgendwo in irgendwelchen Etagen solche Überlegungen gegeben hat, kann ich nicht ausschließen, halte ich aber eher für unwahrscheinlich, denn ich meine, wir haben es gerade, was konventionelle Kräfte angeht, doch mit einer der leistungsfähigsten Kräfte, militärischen Kräfte hier in Russland zu tun. Also das wäre viel zu gefährlich, hier eine solche Überlegung überhaupt zu treffen. Es ist ja gut gewesen, dass dieser Normandie-Prozess zwischen Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland dann eingesetzt worden ist. Das hat als Hintergrund, dass die Amerikaner auch, sag ich mal, andere Prioritäten hatten und auf jeden Fall nicht in eine Auseinandersetzung in Europa gezogen werden wollten. Obama wollte als Friedenspräsident in die Geschichte eingehen. Er hatte ja die amerikanischen Truppen aus Afghanistan und aus dem Irak weitgehend zurückgezogen, und das hat dann zu diesem Normandie-Format der vier Kräfte geführt, die ja auch was erreicht haben mit den zwei Abkommen, aber es scheitert nach wie vor an der Umsetzung.
Rother: Ist das Format an sich gescheitert oder eher nicht?
Erler: Es gab eigentlich gar keine andere große Möglichkeit. Es ist immer mal wieder erwogen worden, ob man Polen noch dazu nimmt, oder die Ukrainer hätten am liebsten die Amerikaner mit dabei, aber es gibt Gründe, dass die amerikanische Seite das nicht will und das Ganze als ein europäisches Problem ansieht und erwartet, dass auch das hier von Europa aus gelöst wird.
Rother: Sie sind mit der Ostpolitik von Willy Brandt politisch sozialisiert worden. Wie hat denn der Ukrainekrieg Ihren Blick auf Russland verändert? Waren Sie auch enttäuscht, oder haben vielleicht auch persönliche Verhältnisse mit Russinnen und Russen, die Sie haben, darunter gelitten?
Erler: Ja, auf jeden Fall. Das war unvermeidlich, dass diese völlig unterschiedlichen Sichtweisen hier dann auch in meinem Umfeld aufeinandergetroffen sind, zum Beispiel, dass ein guter Freund, ein russischer, mich gefragt hat, Gernot, du hast doch Erinnerung an das Zwei-plus-Vier-Abkommen von 1990, was zur deutschen Einigung geführt hat, und da ging es um die Wiedervereinigung, und jetzt bei der Krim, bei uns geht es auch wieder um die Wiedervereinigung, also damals haben wir euch geholfen, heute müsst ihr uns helfen. Das ist dann eine ziemliche Herausforderung mit einer solchen Position, aber das ist keine Einzelpositionen, sondern das trifft man also bei vielen Kollegen aus der Russischen Föderation an. Da ist auch eine große Enttäuschung da, dass gerade Deutschland diese Sichtweise, dass es um eine Wiedervereinigung sich handelt, nicht versteht oder nicht anerkennen will. Das spielt bis heute eine große Rolle.
Der Ukrainekonflikt hat das Fass zum Überlaufen gebracht
Rother: Sind auch persönliche Beziehungen zerbrochen daran?
Erler: Nein, zum Glück nicht. Also das konnten wir vermeiden. Allerdings war der Dialog dann für eine längere Zeit schwierig, aber ich habe selber die Konsequenz aus diesen Problemen gezogen und hatte mir vorgenommen, zu versuchen zu verstehen, was hier eigentlich vor sich geht. Ich bin also stark auf diesen Pfad der Entfremdung gekommen. Da hat sich etwas auseinanderentwickelt. Der Westen hat immer gedacht, er hätte eigentlich ein gutes Verhältnis zu Russland mit den regelmäßigen Gipfeltreffen, die man gemacht hat, und Klausuren der entsprechenden Kabinette. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass diese positiven Dinge, die unbestreitbar sind und die ganz besonders auch zwischen Deutschland und Russland sich etabliert haben, da völlig andere Auffassungen in Moskau sich entwickelt haben, nämlich dass der Westen die Schwächeperiode Russlands direkt nach der Auflösung der Sowjetunion in den 90er-Jahren ausgenutzt hätte gegen russische Interessen und die NATO-Erweiterung weiter vorangetrieben hat, obwohl das früher mal anders zugesagt worden ist, und dann dadurch eine Entfremdung stattgefunden hat, dass im Grunde genommen die einen gedacht haben, sie seien doch eigentlich faire Partner von Russland, aber in Russland wurde das völlig anders gesehen. Da war dann dieser ganze Ukrainekonflikt sozusagen wie ein Tropfen auf … oder ein letzter Tropfen auf … Nein, wie sagt man da?
Rother: Tropfen auf den heißen Stein.
Erler: Nein, ich meinte einen Tropfen zum Überlaufen.
Rother: Der das Fass zum Überlaufen bringt.
Erler: Der das Fass zum Überlaufen bringt, war dann die Ukraine, wo das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine angesehen wurde in Moskau als ein letzter geopolitischer Zugriff auf die Kontrolle dieses Nachbarn von Russland, während es in Wirklichkeit von westlicher Seite als ein Ersatz gesehen wurde für den unerfüllbaren Wunsch aus Kiew, nämlich sobald wie möglich Mitglied der EU zu werden.
Rother: Ich denke, eine Entfremdung zwischen Russland und dem Westen, die lässt sich konstatieren. Die Frage, die jetzt im Raum steht, ist aber doch, ob und wie sich das Verhältnis mit Russland wieder verbessern lässt. Welche Möglichkeiten sehen Sie da? Braucht es eine neue Ostpolitik?
Erler: Es braucht auf jeden Fall eine Erinnerung daran, was mal möglich war und was an Vertrauen eigentlich aufgebaut worden ist und eine kritische Diskussion untereinander darüber, wie wir das verstehen sollen, was zum Teil von Russland jetzt gemacht wird. In den letzten Tagen hat die Bundeskanzlerin sich öffentlich dazu geäußert, dass diese Hackerangriffe auf den Bundestag und auch auf das Kanzleramt stattgefunden haben und man inzwischen sogar einen Täter benennen kann, warum das eigentlich passiert, warum zerstört man so die Vertrauensgrundlage, und was ist die Legitimation dafür, und was ist der politische Sinn, der dahintersteckt. Wir haben eine russische Politik, die versucht, die EU zu destabilisieren. Das ist ein Erschwerendes natürlich für alle konstruktiven Stimmen, die es zum Glück auch gibt, die sagen – und Sie haben eben das zitiert –, dass man im Geiste sozusagen der Ost- und Verständigungspolitik und Entspannungspolitik ansetzen könnte, um das Verhältnis zu verbessern, aber dann müssen solche unerklärlichen Feindseligkeiten natürlich ausgeräumt werden, sonst wird das sehr schwer. Ich meine, dazu gehört auch die Unterstützung von nationalistischen und rechtsradikalen Gruppierungen, nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland. Was soll das, also diese Frage stelle ich meinen russischen Kollegen und Bekannten und kriege darüber immer nur die Antwort, dass wir die Verantwortung für die Verschlechterung des Verhältnisses hätten. Das ist so eine Pattsituation, wie soll man da weiter kommen.
Da komme ich immer nur wieder auf die OSZE zurück. Die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, ist eine Konstruktion von 57 Staaten, wozu Amerika und Russland gehört. Da ist schon vieles Gutes gemacht worden, und ich glaube, dass wir so eine Art Helsinki 2 brauchen, das heißt also, den Helsinki-Prozess wieder aufnehmen müssten. Diese Entfremdungen, die ich geschildert habe, die sind nicht lösbar, indem sich Putin und Merkel an einen Tisch setzen und sich eine Stunde freundlich unterhalten, sondern das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der da notwendig ist, um diese ganzen Irritationen und Fehlwahrnehmungen aufzuarbeiten. Wir haben damals erlebt in den 70ern, dass mehrjährige Konferenzen dann zu diesem großartigen Ergebnis der Helsinki-Grundakte geführt haben. Ich glaube, wir sind heute an einem ähnlichen Punkt, dass wir eine solche wirklich große Anstrengung brauchen. Mit Petitessen sich zu beschäftigen macht keinen Sinn in dieser Situation.
Erklärer, Zuhörer – und immer noch ein bisschen Außenpolitiker
Rother: Herr Erler, wir haben über außenpolitische Herausforderungen für Deutschland gesprochen. Zu welchen Schlüssen kommen Sie, der Außenpolitik-Fachmann Gernot Erler? Wo steht Ihrer Meinung nach die deutsche Außenpolitik 2020?
Erler: Naja, sie steht vor der Riesenaufgabe, das Experiment Europa nicht zu riskieren, besonders in dieser Herausforderung durch die Coronakrise. Es ist jetzt ganz wichtig, dass Deutschland zeigt, dass es nicht über Europas Köpfe hinweg Regelungen finden will, sondern gemeinsam mit den anderen Staaten, und dass vor allen Dingen jetzt zur Debatte steht, ob Europa gemeinsam handelt oder ob jeder guckt, dass er seine eigenen Interessen vertritt. Gerade jetzt in der Coronakrise wäre es unerhört eindrucksvoll und sinnvoll und auch erfolgreich für Europa, wenn Europa jetzt stattfinden würde. Es hat ja jetzt gerade diese Vereinbarung zwischen Frankreich und Deutschland gegeben, über diesen 500-Milliarden-Kredit, der ohne Rückzahlpflicht ausgegeben werden soll. Keine Ahnung, was daraus wird, ob das realisiert wird, aber es ist ein mutiger Schritt in die Richtung, jetzt in einer Zeit, wo also auch viele Zweifel gesät werden von interessierter Hand, an der Zukunftsfähigkeit der EU und Europas, dass gerade in dieser Zeit dort Deutschland sich einbringt. Das ist auch eine Bringschuld, die wir da haben. Wir haben wie kein anderes Land profitiert schon ganz am Anfang der europäischen Idee, weil am Anfang stand die Westintegration, die uns rausgeholt hat aus der Schmuddelecke sozusagen der Weltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach, wie gesagt, kam als Ergänzung die Ostpolitik dazu. Das Ganze hat sich segensreich für Deutschland ausgewirkt, und ich finde, wir haben eine Verantwortung dafür, die Idee Europas aufrechtzuerhalten und alles, was wir können, dafür zu tun.
Rother: Das heißt, Sie haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass es auch weiterhin zu einem positiven deutschen Beitrag kommt?
Erler: Ja, also ich finde, dass wir die Chance haben und dass es genug Ideen gibt und dass wir nicht verzagen sollten in dieser Herausforderung und uns damit auch ganz deutlich positionieren gegen die Zweifler und die Kritiker und die, die im Grunde genommen auf etwas anderes lauern. Anders kann ich das nicht ausdrücken.
Rother: Sie sind 2017 aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden nach drei Jahrzehnten. Gab es denn einen Ratschlag, einen politischen oder außenpolitischen, vielleicht auch Leitgedanken, der Ihnen über all diese Jahre geholfen hat?
Erler: Naja, ich habe versucht, noch mal solche Leitgedanken auch zusammenzufassen und habe 2018 noch einmal also ein Buch geschrieben, "Weltordnung ohne den Westen? Europa zwischen Russland, China und Amerika". Das ist so ein bisschen mein Vermächtnis sozusagen, wenn man will, was da auch niedergelegt worden ist. Seit meinem Ausscheiden aus dem aktiven politischen Leben, also als Bundestagsabgeordneter, bin ich sozusagen so etwas wie ein Vortragsreisender geworden, der immer wieder diese Themen der Weltordnung, aber auch der russischen Politik und der europäischen Politik zum Gegenstand hat. Insofern gibt es da so etwas wie ein Vermächtnis.
Rother: Sie haben ihr Fachgebiet jetzt gerade noch einmal beschrieben. Das legt man ja nicht einfach ab, nur weil man kein Fachpolitiker mehr ist. Was begeistert Sie denn bis heute an diesem Thema?
Erler: Ich weiß nicht, ob es Begeisterung genannt werden kann, sondern es ist einfach jeden Tag auf der Tagesordnung. Jeden Tag gibt es Entwicklungen, und ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass wir uns hier nicht wegducken und dass wir uns einbringen mit unseren Erfahrungen und auch mit unserer Kreativität und unseren Ideen. Begeisterung taucht dann auf, wenn irgendetwas funktioniert, wenn irgendwas tatsächlich einen Neuanfang ermöglicht. Ich war damals begeistert über das, was Willy Brandt gemacht hat. Da ist das Wort angemessen. Heute empfinde ich einfach eine Herausforderung und denke, dass wir stark genug sind, uns der zu stellen.
Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.