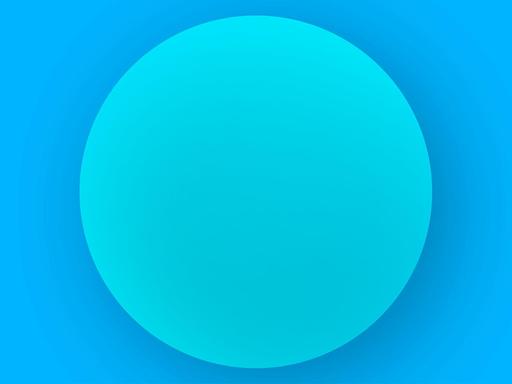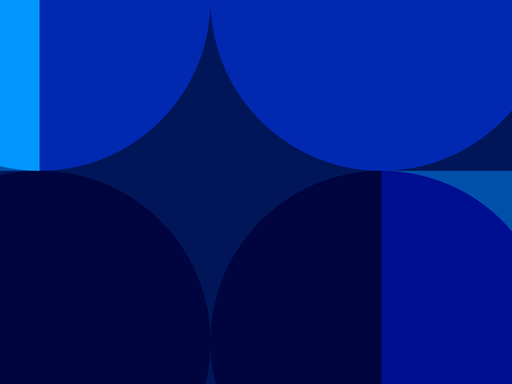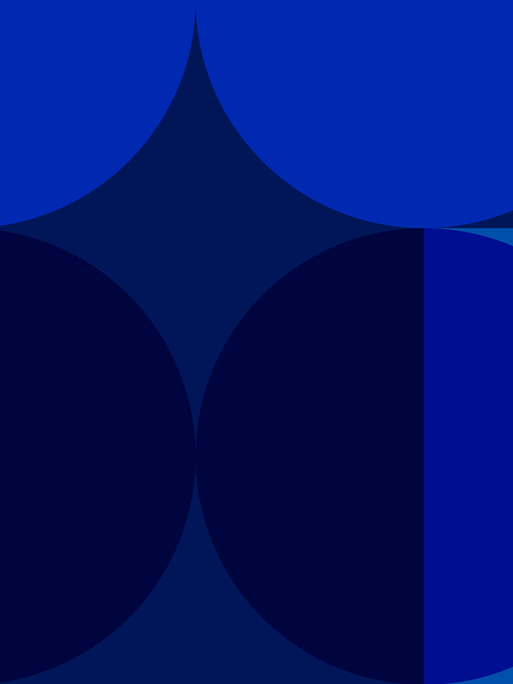Die Bundeswehr braucht Verstärkung. Daher setzt die Regierung auf eine verpflichtende Musterung aller jungen Männer, bietet ihnen ein Bruttogehalt von 2.600 Euro und einen Zuschuss für den Führerschein an. So sollen genügend Freiwillige für die Truppe gefunden werden.
Sollte dies jedoch nicht gelingen, könnte der Bundestag unter Abwägung der sicherheitspolitischen Lage die sogenannte Bedarfswehrpflicht einführen: Da die Bundeswehr gar nicht alle tauglichen Männer eines Jahrgangs einziehen kann, könnten die Rekruten über ein Losverfahren ausgewählt werden. Darüber ist aber bislang noch nicht entschieden.
Wehrdienst-Losverfahren nach dänischem Vorbild
Die Idee des Losens orientiert sich an Dänemark. Dort gibt es prinzipiell eine Wehrpflicht für alle. Allerdings wird nur ein Fünftel eines Jahrgangs auch tatsächlich einberufen. Reichen die Freiwilligen für den Dienst in der Armee nicht aus, werden die fehlenden Rekruten per Losverfahren gezogen - zumindest in der Theorie. Denn in den vergangenen Jahren meldeten sich stets genügend Freiwillige.
Was für ein Losverfahren beim Wehrdienst spricht
Befürworter des Verfahrens argumentieren, mit dem Losverfahren eine juristisch unbedenkliche und vor allem faire Lösung für den Wehrdienst gefunden zu haben. Entscheidet der Zufall hätten schließlich alle dieselbe Chance, was eine gewisse Gerechtigkeit herstelle.
Auch die Soziologin Christiane Bender sieht in der Chancengleichheit die große Stärke des Auslosens. Sie spricht von einem „objektivierten Verfahren“, weil Kriterien wie zum Beispiel Geld, Einfluss und Fitness beim Losen keine Rolle spielen. Bender betont zudem, dass auch Ausgeloste nicht verpflichtet werden können, den Wehrdienst zu leisten – das Recht, aus Gewissensgründen zu verweigern, besteht weiterhin.
Was gegen ein Losverfahren beim Wehrdienst spricht
Kritik am Losverfahren kommt etwa von der Rechtswissenschaftlerin Kathrin Groh, Professorin an der Universität der Bundeswehr in München. Sie bezweifelt, dass ein solches Auswahlverfahren vereinbar wäre mit dem Grundgesetz, genauer: mit dem Grundsatz der allgemeinen Wehrgerechtigkeit. Dieser besage, dass die Lasten der Landesverteidigung von allen Männern gleichermaßen getragen werden müssen.
Zwar sei das Los – und somit der Zufall – ein „sehr faires Auswahlverfahren“, so Groh. Allerdings müsse am Ende auch das Ergebnis gerecht sein. Laut Verfassung brauche es „sachlich rechtfertigende Gründe für diese massive Belastungsungleichheit, die dann zwischen den jungen Männern eines Jahrgangs eintritt“.
Allein auf die Legitimation durch ein gerechtes Verfahren zu setzen, reicht laut Groh nicht aus, zumal es bei der Frage um einen „extrem hohen Grundrechtseingriff“ gehe.
Ein Nachteil des Losverfahrens ist, dass möglicherweise nicht diejenigen ausgelost werden, die am besten für die verschiedenen Aufgaben in der Armee geeignet wären, meint der Journalist und Militärkenner Thomas Wiegold. Daher würde die Bundeswehr ihre Rekruten lieber selbst auswählen. Ein solches Verfahren aber könne zu Verfassungsklagen führen, weshalb die Regierung wohl am Losverfahren festhalte.
Das Losverfahren als politisches Instrument
Der Gedanke, staatliche Aufgaben per Los zu vergeben, ist so alt wie die Demokratie. Im antiken Athen wurden wichtige Ämter per Losverfahren verteilt, zum Beispiel die Mitglieder der Ratsversammlung bestimmt. Die 500 ausgelosten Bürger – Frauen und Sklaven waren ausgeschlossen – erarbeiteten Vorschläge für Gesetze, auch die Regierung ging aus dem Gremium hervor.
Die Griechen hielten Wahlen für problembehaftet: Faktoren wie Prominenz oder Vermögen, so fürchteten sie, könnten diese unfair beeinflussen. Entpersonalisierte Verfahren wie das Los waren hingegen beliebt, erklärt der Althistoriker Aaron Gebler. Bei der Auslosung der Ratsherren sei es darum gegangen, Repräsentation sicherzustellen und jedem den Zugang zu Ämtern zu öffnen. Das wird aleatorische Demokratie genannt – nach dem lateinischen „alea“ für „Würfel“.
Doch das demokratische Würfeln setzte sich letztlich nicht durch. Die Zweifel daran kamen mit der Aufklärung, sagt der Greifswalder Politikwissenschaftler Hubertus Buchstein: „Weil dann sofort gesagt wird: Zufall, Irrationalität, reine Willkür, das wollen wir doch nicht.“
Den Zweifeln zum Trotz ist das Losverfahren in den vergangenen Jahren aber als politische Idee wieder populärer geworden und findet zum Beispiel bei der Besetzung von Bürgerräten Anwendung, in denen Bürgerinnen und Bürger Themen diskutieren und Vorschläge für die Politik erarbeiten. Die Idee: Durch die Auswahl per Zufall sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Querschnitt der Bevölkerung abbilden, und so unterschiedliche Lebenserfahrungen und Perspektiven in die Beratungen einbringen.
Teilhabe und Akzeptanz
Aus Sicht der Philosophin Julia Jakobi gibt es mehrere Aspekte, die dafür sprechen, politische Ämter nach dem Zufallsprinzip zu besetzen. So sei das Verfahren partizipativer, weil Menschen aller Bevölkerungsschichten zu aktiven Teilnehmern in der Politik würden. Das wiederum kann laut Jakobi dafür sorgen, das politische Entscheidungen stärker dem Willen der breiten Bevölkerung entsprechen und auf mehr Akzeptanz stoßen.
Der Althistoriker Aaron Gebler gibt jedoch zu bedenken, dass es bei der Entscheidung für oder gegen Losverfahren stets um die Frage gehen müsse, was genau ausgelost werden soll. Nach Einschätzung von Politikwissenschaftler Buchstein bietet sich das Verfahren beispielsweise für den kommunalen Bereich an.
Fair oder nicht fair - was die Bevölkerung denkt
Zumindest was die Gewinnung neuer Rekruten für die Bundeswehr betrifft, ist eine Mehrheit der Deutschen klar gegen ein Losverfahren. In einer Umfrage des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" Mitte Oktober hielten 60 Prozent eine solche Regelung für falsch. Nur 21 Prozent der Befragten befürworteten das Zufallsprinzip.
Andere Umfragen kommen zu ähnlichen Ergebnissen: Im ZDF-Politbarometer Ende Oktober lehnten sogar 84 Prozent der Befragten den Vorschlag ab, nur 14 Prozent fanden ihn richtig. Die Ablehnung ist bei Anhängern aller Parteien hoch.
Eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins "Stern" rundet das Bild ab: Mitte Oktober sagten 76 Prozent der Befragten, eine Auswahl von Wehrdienstleistenden per Losverfahren sei ungerecht. Nur 21 Prozent hielten das für gerecht. Das Verfahren wird quer durch alle Altersgruppen als ungerecht empfunden. Interessant: Die höchsten Zustimmungswerte fanden sich ausgerechnet noch in der Gruppe der 18- bis 29-jährigen Männer, die potenziell betroffen sind. Hier denken immerhin rund ein Drittel, dass eine Auslosung zum Wehrdienst gerecht wäre.
jfr/irs/ahe/rey (mit Agenturen)