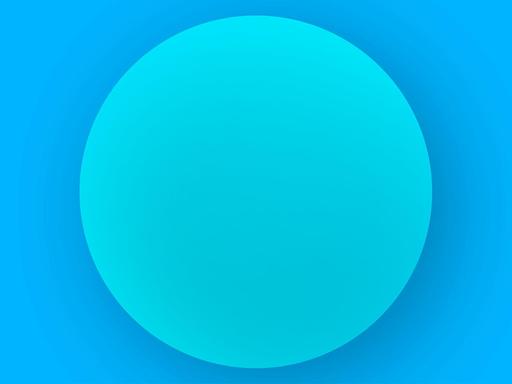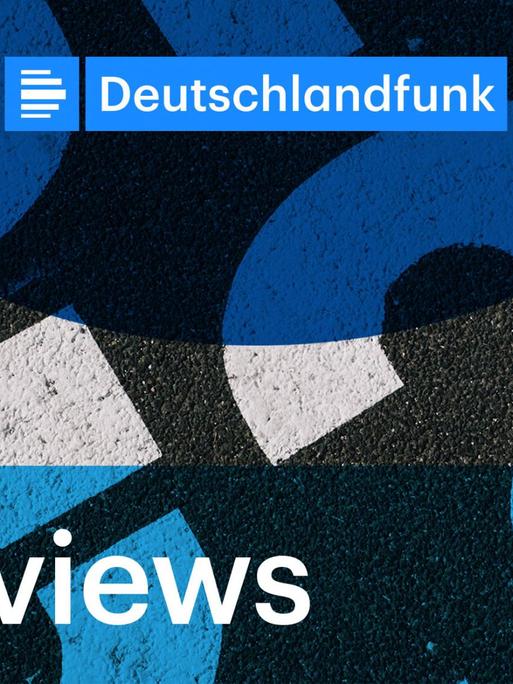Kompromiss gefunden. Nein, doch nicht. So streiten SPD und Union schon seit einer Weile über die künftige Ausgestaltung des Wehrdienstes.
Der ursprüngliche Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) – der bereits im Kabinett verabschiedet wurde - sah ein auf Freiwilligkeit basierendes Wehrdienstmodel vor. Nur wenn die Rekrutierungsziele nicht erreicht werden oder wenn die Sicherheitslage es erfordert, sollte sich das ändern.
Freiwillig kontra verpflichtend
Unionspolitiker – darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz – bezweifelten, dass dies der Bundeswehr ausreichend Personal bringt. Aufgrund ihrer Bedenken wurde die erste Lesung des Gesetzes im Bundestag erst einmal verschoben – und ein neuer Kompromiss verhandelt: Falls sich nicht ausreichend Soldaten freiwillig melden, sollen weitere junge Männer per Losverfahren zum Wehrdienst verpflichtet werden. Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung sollte bestehen bleiben.
Eine Pressekonferenz war bereits angesetzt, auf der die Details des geplanten Kompromisses vorgestellt werden sollten. Diese wurde aber kurzfristig abgesagt. Der Grund diesmal: Bedenken vonseiten der SPD-Fraktion. Umstritten ist, ob ein Losverfahren rechtlich möglich ist.
So geht es mit dem Wehrdienstgesetz weiter
Nun hoffen die Sozialdemokraten, dass eine Anhörung im Bundestag am 10. November 2025 – bei der Experten zu Wort kommen – zu einer Einigung führt. Der Gesetzentwurf von Pistorius soll trotzdem am 16.10.2025 ins Parlament eingebracht werden. Die Unstimmigkeiten darüber müssten dann im Laufe des parlamentarischen Verfahrens geklärt werden. Das Gesetz soll Anfang 2026 in Kraft treten.
Das steht im Pistorius-Gesetz
Das Wehrdienstgesetz von Pistorius sieht ursprünglich vor, dass allen jungen Menschen zum 18. Geburtstag ein Fragebogen zugeschickt wird. Darin sollen sie Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Wehrdienst geben. Wenn sie ausgewählt werden, müssen sie sich einer Musterung stellen. Ob sie dann aber Dienst bei der Bundeswehr leisten, bleibt ihnen überlassen. Die Männer müssen aber verpflichtend den Fragebogen ausfüllen und zurücksenden, bei Frauen ist auch das freiwillig. Das Gesetz sieht also keine Wehrpflicht vor, kann aber als Vorbereitung darauf verstanden werden.
So groß ist der Personalmangel bei der Bundeswehr
Dass die Bundeswehr unter Personalmangel leidet, ist nahezu unbestritten: Ende 2024 dienten rund 181.000 Soldatinnen und Soldaten – 19.000 weniger als eigentlich vorgesehen. Bis 2031 soll die Bundeswehr außerdem auf 203.000 Mann anwachsen. Dieser Zielwert könnte aber angesichts der derzeitigen Bedrohungslage auch noch nach oben gesetzt werden.
Ralf Stegner (SPD) sieht keine schwerwiegenden Konflikte zwischen SPD und Union. Es sei ein übliches Verfahren, dass sich in Beratungen und Anhörungen die Ausgestaltung des konkreten Gesetzestextes verändere. Wichtig sei es, zu einer guten Lösung zu kommen.
Hans-Peter Bartels, ehemaliger Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages und Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP), geht davon aus, dass langfristig nur eine Wehrpflicht ausreichend Personal für die Bundeswehr garantieren könne. Ein Losverfahren sei dabei ein mögliches, geeignetes Mittel. „Wichtig ist jetzt, dass die Pflicht bereits in diesem Gesetz stehen wird und nicht erst eine Perspektive ist, wenn die NATO tatsächlich von Russland angegriffen wird.“
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vermutet, dass die notwendige Aufstockung der Bundeswehr am Ende nur mit einer Wehrpflicht gelingen kann. "Ich bin dafür, dass wir das machen, was wir im Koalitionsvertrag verabredet haben, nämlich vorläufig freiwillig. Aber ich vermute, es wird bei Freiwilligkeit allein nicht bleiben", so Merz.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann will mehr Verbindlichkeit, als sie der Plan des Verteidigungsministers vorsieht: "Zwischen einem verpflichtenden Wehrdienst und einer Lösung - ich nenne es jetzt mal Fragebogen - gibt es sehr viel Platz, um etwas mehr Verbindlichkeit herzustellen. Das ist das Ziel der CDU/CSU-Bundestagsfraktion."
Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bezeichnet das Verhalten der Unionsfraktion als fahrlässig, weil es möglicherweise die Einführung des neuen Wehrdienstes verzögert. Er fordert die Unionsfraktion auf, am Zeitplan festzuhalten.
Falko Droßmann (SPD) lehnt eine sofortige Rückkehr zu einer Wehrpflicht ab. „Ich brauche doch heute keine Zehntausenden Wehrpflichtigen mehr“, so Droßmann. „Ich brauche gut ausgebildete Menschen, die hochtechnologisch unterwegs sind. Und dafür brauche ich länger dienende Soldatinnen und Soldaten - und dafür muss ich diesen Beruf attraktiver machen.“
Im Spannungs- und Verteidigungsfall könne außerdem der Wehrdienst verpflichtend werden. Dazu würden im Hintergrund auch bereits Musterbehörden und Kasernen aufgebaut und Waffen beschafft. Für eine sofortige Rückkehr zur Wehrpflicht fehle noch die Infrastruktur.
Eine weitere offene Frage bei der politischen Diskussion bleibt: Würde die Bevölkerung, würden vor allem die jungen Menschen eine Wehrpflicht mitmachen? Entscheidend dafür sei zum einen die Bedrohungslage, sagt die Historikerin Ute Frevert mit Blick auf alte Wehrpflichtdebatten. Zum anderen sei die Verbundenheit mit dem Land und den Prinzipien Freiheit und Selbstbestimmung wichtig. Auch wurde vielen jungen Männern die Idee vermittelt, dass sie diejenigen seien, die Haus und Herd verteidigen. „Das hat historisch immer eine große Rolle gespielt.“
Laut einer Befragung der Liz Mohn Stiftung von August sind nur rund 20 Prozent der 16- bis 18-Jährigen für eine Wehrpflicht. Beliebter ist die Idee eines Pflichtjahres, das sowohl bei der Bundeswehr als auch bei sozialen Einrichtungen absolviert werden könnte.
Onlinetext: Leila Knüppel, gue