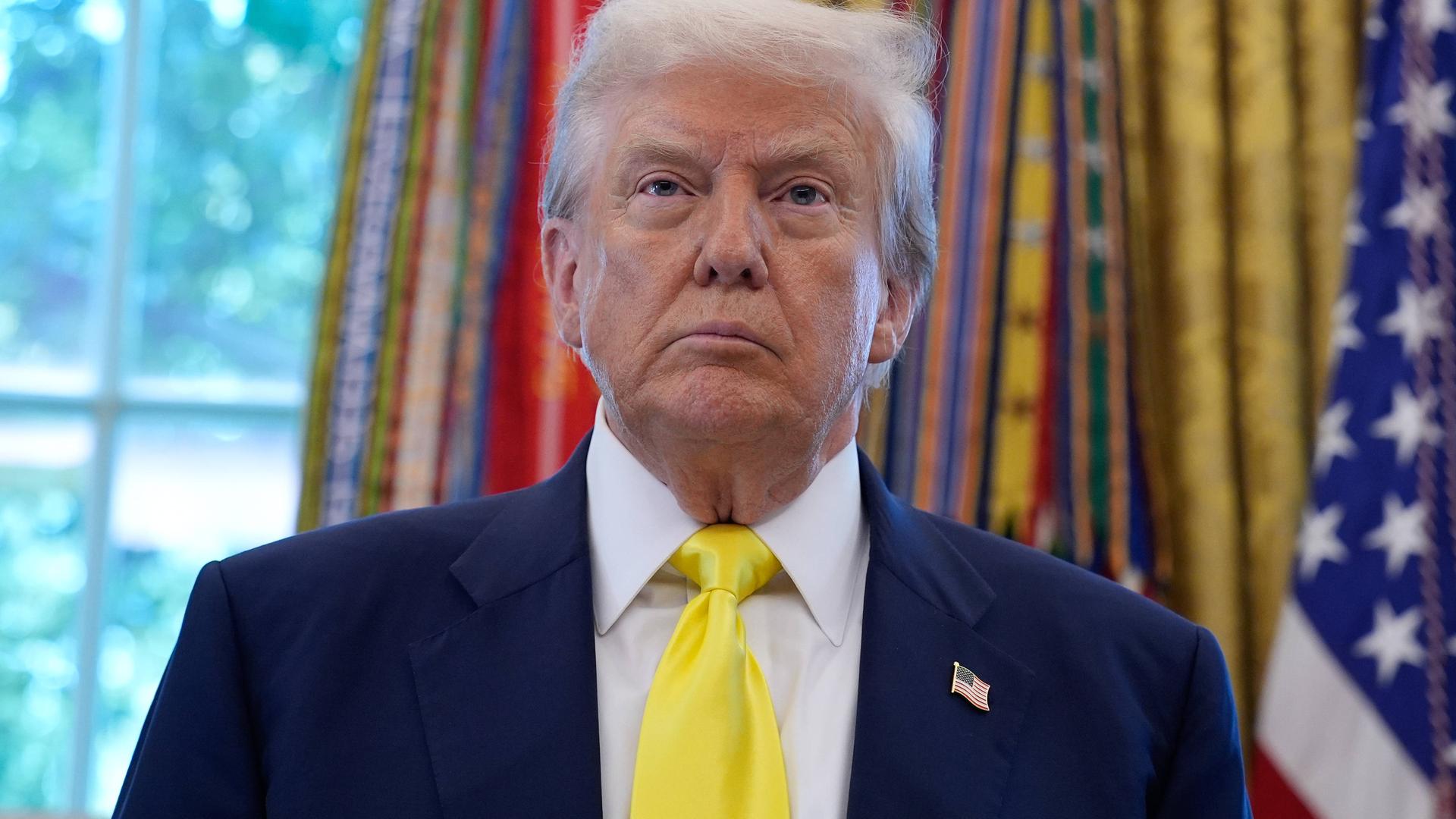In den schattigen Zwischenzonen des Internets, wo Silicon-Valley-Idealismus auf postdemokratischen Zynismus trifft, hat sich ein Denker etabliert, der wie kaum ein anderer den Zeitgeist der rechten Intelligenzija prägt – Curtis Yarvin, dessen Karriere unter dem Pseudonym Mencius Moldbug begann.
Yarvin ist kein Faschist, kein Populist, kein einfacher Ideologe – er ist ein Systemingenieur des Autoritären. Sein Vorschlag: Die liberale Demokratie sei ein irreparabler Codefehler – langsam, korrupt, uneffektiv. Was es brauche, sei ein „CEO-Monarch“, der ein Land wie ein Start-up regiert. Der Bürger? Kein Mitbestimmer mehr, sondern Kunde mit Kündigungsrecht. Wählen könne man zwar noch, indem man umzieht in einen anderen souveränen Kleinststaat. Die Zeit der großen Nationen ist für Yarvin nämlich vorbei.
Was wie Science-Fiction klingt, ist längst politischer Wirkstoff: Seine Ideen durchdringen Netzwerke um Peter Thiel, J.D. Vance, Marc Andreessen – Männer mit Macht, Geld und einem Hunger nach Ordnung.
Dabei funktioniert Yarvins Theorie nicht nur als radikales Staatsmodell, sondern als ästhetisches Angebot: Es ist das Versprechen, jenseits der liberalen Langeweile etwas Großes, Reines, Starkes zu denken – autoritär, aber intelligent. Seine Leser sind junge Männer, ironisch gebildet, moralisch müde, süchtig nach Struktur.
Dass er damit heute Einlass zu Empfängen der Macht erhält – in Washington, bei der Biennale, in Thiels Wohnzimmer –, ist kein Unfall. Es ist das leise Klirren einer kommenden Ordnung, die keine Massen mobilisieren muss, sondern ein paar reiche Männer und ein bisschen Code.
Ava Kofman ist staff writer bei The New Yorker. Zuvor arbeitete sie als investigative Reporterin beim Investigativrecherchemedium ProPublica. Ihre Texte erschienen darüber hinaus in namhaften Publikationen wie The New York Times Magazine, Harper’s Magazine, The New York Review of Books und n+1. Zu ihren Auszeichnungen zählen unter anderem der Hillman Prize for Magazine Journalism (2023) oder im selben Jahr der Bartlett & Steele Award for Outstanding Young Journalist. Der hier vorliegende Text ist eine gekürzte Fassung ihres Essays „Curtis Yarvin’s Plot Against America“, erschienen im Juni 2025 im New Yorker.
Im Frühjahr und Sommer des Jahres 2008, als Donald Trump noch als Demokrat registriert war, veröffentlichte ein anonymer Blogger namens Mencius Moldbug ein mehrteiliges Manifest mit dem Titel „Ein offener Brief an aufgeschlossene Progressive“. Im spöttisch-verdrießlichen Ton eines Abtrünnigen argumentierte der mehrere hundert Seiten lange Brief, dass der Egalitarismus nicht nur weit davon entfernt sei, die Welt zu verbessern, sondern vielmehr die meisten Übel auf Erden zu verantworten habe. Dass seine leichtgläubigen Leserinnen und vor allem Leser dies anders sähen, so Moldbug, liege am Einfluss der Medien und der Wissenschaft, die, wenn auch unbeabsichtigt, gemeinsame Sache machten, um einen linksliberalen Konsens aufrechtzuerhalten. Diese ruchlose Allianz taufte er „die Kathedrale“. Moldbug forderte nichts weniger als deren Zerstörung sowie einen vollständigen „Neustart“ der Gesellschaftsordnung. Er schlug vor, „Demokratie, Verfassung und Rechtsstaatlichkeit abzuschaffen“ und die Macht an eine Art obersten CEO zu übergeben – jemanden wie Steve Jobs oder den Softwareentwickler Marc Andreessen, so Moldbug –, der aus der Regierung einen „schwerbewaffneten, ultraprofitablen Konzern“ machen würde. Dieses neue Regime würde öffentliche Schulen veräußern, Universitäten zerschlagen, die Presse abschaffen und „entzivilisierte Teile der Bevölkerung“ ins Gefängnis stecken. Außerdem würde die Regierung massenhaft Beamte feuern und internationale Beziehungen etwa in Form von „Sicherheitsgarantien, Entwicklungshilfe und Masseneinwanderung“ beenden.
Zugegeben, so Moldbug, seine Vision stehe und falle mit der Zurechnungsfähigkeit des oder der Vorstandsvorsitzenden: „Sollte er oder sie sich als Hitler oder Stalin herausstellen, dann hätten wir mal eben den Nationalsozialismus oder Stalinismus wiederbelebt, klar.“ Wirklich ernst nahm er die Diktatoren des 20. Jahrhunderts allerdings ohnehin nicht, da sie für seinen Geschmack viel zu sehr auf öffentliche Unterstützung angewiesen waren. Jedes System, das seine Legitimität aus den Vorlieben der Masse beziehe, sei zum Scheitern verurteilt, so Moldbug. Kritiker haben ihn als Technofaschisten bezeichnet, er selbst nannte sich lieber einen Royalisten oder Jakobiten – in Anspielung auf die Anhänger von König James II. und dem Hause Stuart, die sich im 17. und 18. Jahrhundert gegen den britischen Parlamentarismus stellten und das königliche Gottesgnadentum verteidigten.
Bald darauf verbreitete sich Moldbugs Blog Unqualified Reservations online immer weiter, dank libertärer Technikfreaks, mürrischer Bürokraten und selbsternannter Rationalisten – von denen viele zu den Stoßtrupps einer virtuellen Geistesbewegung gehörten, die als Neoreaktion oder Dunkle Aufklärung bekannt werden sollte. Nur wenige von ihnen wurden zu handfesten Monarchisten, doch mit seinen Ketzereien gelang es Moldbug offenbar, ihre Verachtung für die Entwicklungen unter Obama in Worte zu fassen. Moldbug forderte seine Leserinnen und Leser auf, sich aus ihrem ideologischen Schlummer aufrütteln zu lassen und die „rote Pille“ zu schlucken – wie Keanu Reeves im Film Matrix, der sich für die beängstigende Wahrheit entscheidet, anstatt sich in der Unwissenheit behaglich einzurichten. Die „rote Pille“ war Moldbugs einflussreichste Wortschöpfung, die von der damals noch jungen Alt-Right-Bewegung rasch aufgegriffen wurde.
Unter der Überschrift „Geeks for Monarchy“ – „Computerfreaks für die Monarchie“ – enthüllte ein Artikel auf dem Nachrichtenportal TechCrunch im Jahr 2013, dass es sich bei Mencius Moldbug um das Pseudonym eines vierzigjährigen Programmierers aus San Francisco namens Curtis Yarvin handelte. Während er versuchte, die US‑Regierung umzubauen, träumte Yarvin zugleich von einem neuen Computerbetriebssystem, das als, so hoffte er, „digitale Republik“ fungieren würde. Er gründete ein Unternehmen namens Tlon, in Anlehnung an die Erzählung „Tlön, Uqbar, Orbis Tertius“ von Jorge Luis Borges, in der eine Geheimgesellschaft eine ausgeklügelte Parallelwelt beschreibt, die die Realität Stück für Stück überholt. Yarvin sammelte Geld für sein Start-up und wurde unterdessen für seine Big-Tech-Spender zu einer Art Machiavelli – ebenso wie Yarvin glaubten auch sie, dass die Welt besser dran wäre, wenn sie das Sagen hätten.
Zu den Investoren von Tlon gehörten die beiden Risikokapitalfirmen Andreessen Horowitz und Founders Fund. Bei letzterer handelte es sich um eine Gründung des Milliardärs Peter Thiel, und sowohl Thiel als auch Balaji Srinivasan, zu jener Zeit Teilhaber bei Andreessen Horowitz, hatten sich nach der Lektüre von Yarvins Blog mit ihm angefreundet – wobei aus E-Mails, die ich einsehen konnte, hervorging, dass damals keiner der beiden Wert darauf legte, öffentlich mit ihm in einem Atemzug genannt zu werden. „Wie gefährlich ist es, dass man uns miteinander in Verbindung bringt?“, schrieb Thiel 2014 an Yarvin. „Beruhigender Gedanke: Unter der Hand ist es für uns von Vorteil, dass diese Leute“ – gemeint sind alle, die sich für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen – „selbst dann nicht an eine Verschwörung glauben, wenn sie ihnen direkt vor der Nase baumelt (daran lässt sich der Niedergang der Linken vielleicht am besten ablesen). Wenn die von Verflechtung sprechen, klingen sie völlig gaga, und irgendwie wissen die das auch.“
Rund zehn Jahre später, zu Zeiten von Trump und seiner Politik des starken Mannes, sind Yarvins Verbindungen zu den Eliten im Silicon Valley und in Washington kein Geheimnis mehr. J. D. Vance, der heutige Vizepräsident und frühere Mitarbeiter in einer von Peter Thiels Risikokapitalfirmen, zitierte Yarvin 2021 bei seinem Auftritt in einem rechtsextremen Podcast, als er vorschlug, eine künftige Trump-Regierung solle „jeden einzelnen mittleren Beamten, sämtliche Staatsdiener im Verwaltungsapparat feuern und durch unsere Leute ersetzen“. Gerichte, die daran Anstoß nähmen, solle man ignorieren. Marc Andreessen, Co-Chef von Andreessen Horowitz und informeller Berater im sogenannten Department of Government Efficiency (DOGE), zitiert inzwischen seinen „guten Freund“ Yarvin, wenn er anmahnt, dass eine Gründergestalt unsere „außer Kontrolle geratene“ Bürokratie in die Hand nehmen müsse. Andrew Kloster, der neue Chefjustiziar im Amt für Personalverwaltung der Regierung, hat erklärt, der Austausch von Beamten durch loyale Anhänger könne Trump dabei helfen, „die Kathedrale“ zu besiegen.
„Es gibt Leute, die den Zeitgeist lenken – Nietzsche nennt sie ‚zeitgemäße Menschen’ –, und Curtis ist definitiv ein zeitgemäßer Mensch“, erzählte mir ein Beamter im Außenministerium, der Yarvins Texte schon seit Moldbug-Zeiten liest. 2011 sagte Yarvin, Trump sei eine von zwei Persönlichkeiten, die „biologisch“ das Zeug zum amerikanischen Monarchen hätten. 2022 empfahl er Trump, im Falle seiner Wiederwahl die Leitung der Exekutive an Elon Musk zu übergeben. In einem Podcast mit seinem Freund Michael Anton, dem heutigen Leiter des Planungsstabs im Außenministerium, sprach sich Yarvin dafür aus, zivilgesellschaftliche Institutionen wie etwa die Harvard University zu schließen.
Zu anderen Zeiten wäre Yarvin womöglich ein obskurer Internet-Spinner ohne jede Außenwirkung geblieben, ein digitaler Joseph de Maistre. Stattdessen wurde er zu einem der einflussreichsten autoritären Vordenker Amerikas, einem Ingenieur des geistigen Quellcodes für die zweite Trump-Regierung.
Jetzt, da seine Ideen in Gestalt von DOGE auf geradezu surreale Weise umgesetzt wurden und Trump sich selbst gern als König bezeichnet, sollte man meinen, dass bei Yarvin Jubelstimmung herrscht. Doch stattdessen ärgerte er sich in den vergangenen Monaten darüber, dass der günstige Augenblick am Ende noch ungenutzt vorüberziehen werde. „Falls du gerade einen Trump-Ständer hast, genieß’ ihn“, schrieb er zwei Tage nach der Wahl. „So hart wirst du nie wieder werden.“ Was viele für den gefährlichsten Angriff auf die Demokratie in der Geschichte der USA halten, tut Yarvin als jämmerlich und unzureichend ab, weit entfernt von einem echten Putsch. Ohne eine kompromisslose autokratische Machtübernahme, so glaubt er, sei mit Sicherheit ein Backlash zu erwarten. Als ich vor Kurzem mit ihm sprach, zitierte er den französischen Philosophen Louis de Saint-Just, einen Verfechter der Schreckensherrschaft: „Wer eine halbe Revolution macht, gräbt sein eigenes Grab.“
Anfang des Jahres traf ich mich mit Yarvin in Washington, D.C., zum Mittagessen. Er war in der Stadt, um den Regimewechsel zu feiern, und trug sein übliches Outfit: Jeans, Chelsea-Boots, ein zerknittertes Hemd unter einer Bikerjacke. Nach ein paar Bissen von seinem Cheeseburger mit Röstzwiebeln schob er seinen Teller beiseite. Im Jahr zuvor, erklärte er, habe er nach einer Diskussion mit dem rechten Kommentator Richard Hanania über die jeweiligen Vorzüge von Monarchie und Demokratie beschlossen, ein Ozempic-artiges Medikament zu nehmen. „Ich habe ihn in fast jedem Punkt in der Luft zerrissen“, sagte Yarvin und stupste mit seiner Gabel eine Tomate umher. „Aber er hatte einen riesigen Vorteil: Nämlich, ich war dick und er nicht.“ Die Spritzen schienen zu wirken. Während ich weiteraß, liefen auf Yarvins Handy immer mehr Nachrichten auf, darunter auch einige, die seine Verwandlung lobten. An jenem Morgen hatte das New York Times Magazine ein Interview mit ihm veröffentlicht, samt einem knurrigen Schwarz-Weiß-Porträt. Sein Freund Steve Sailer, der für weiß-nationalistische Websites schreibt, meinte, er sehe aus wie „der fünfte Ramone“.
Yarvin seinerseits war erleichtert darüber, wie das Interview mit der Times gelaufen war. „Vor allem hatte ich mir überlegt: Wie schaffe ich es, keine meiner Beziehungen zu beschädigen?“, sagte er. Jahrelang war Yarvin, wenn überhaupt, vor allem als Hofphilosoph im „Thielverse“ bekannt, jenem Netzwerk aus abweichlerischen Unternehmern, Intellektuellen und Mitläufern, das den Tech-Mogul umgibt.
Außerdem, sagte Yarvin, habe er das Publikum der New York Times erreichen wollen. Was erstaunlich ist, hatte er von der Regierung doch gefordert, die Zeitung dichtzumachen.
Als Kind wurde Yarvin gelegentlich zu Hause von seiner Mutter unterrichtet und übersprang drei Klassen. (Sein älterer Bruder Norman sogar vier.) Schließlich zog die Familie nach Columbia im Bundestaat Maryland, wo Yarvin im Alter von zwölf Jahren die zehnte Klasse der Highschool besuchte. „Wenn man viel jünger ist als seine Klassenkameraden, dann ist man entweder ein liebenswertes Maskottchen oder ein komischer, bedrohlicher, verstörender Alien“, sagte Yarvin. Er sei Letzteres gewesen.
Nach anderthalb Jahren Promotionsstudium ließ Yarvin die akademische Welt hinter sich, um sein Glück in der Tech-Branche zu versuchen. Er war an der Entwicklung einer frühen Version eines mobilen Webbrowsers für ein Unternehmen beteiligt, das später unter dem Namen Phone.com bekannt wurde.
Als Phone.com an die Börse ging, bescherte ihm das einen Geldregen in Höhe von einer Million Dollar. Mit einem Teil des Geldes kaufte er eine Wohnung in der Nähe des Stadtteils Haight-Ashbury in San Francisco, den Rest steckte er in ein Selbststudium der Informatik und der politischen Theorie.
In der freien Wildbahn vertiefte sich Yarvin in obskure Geschichts- und Wirtschaftstexte, von denen viele über Google Books wieder zugänglich geworden waren. Er las Thomas Carlyle, James Burnham und Albert Jay Nock.
Seinen eigenen „Rote-Pille-Moment“ führt Yarvin auf die Präsidentschaftswahlen von 2004 zurück. Während die Lügen über Massenvernichtungswaffen im Irak viele aus seiner Generation weiter nach links drängten, ließ sich Yarvin von Fantasiegespinsten anderer Art in die entgegengesetzte Richtung ziehen: Bei der sogenannten Swift‑Boat‑Verschwörungstheorie warfen Veteranen mit Verbindungen zur Wahlkampagne von George W. Bush dem demokratischen Kandidaten John Kerry vor, er habe in Bezug auf seinen Militärdienst in Vietnam gelogen. Fakten waren offenbar nicht mehr verlässlich. Wie konnte er all dem noch trauen, was er über Joseph McCarthy, den Bürgerkrieg oder die Erderwärmung gehört hatte? Und was war mit der Demokratie? Jahrelang führte er lebhafte Diskussionen in den Kommentarbereichen diverser Blogs, bis er beschloss, einen eigenen Blog zu starten. An Ehrgeiz mangelte es ihm nicht. Der erste Post begann mit den Worten: „Neulich habe ich in meiner Garage herumgetüftelt und mir gedacht, ich baue mal eine neue Ideologie.“
Der deutsche Wissenschaftler Hans-Hermann Hoppe wird mitunter als geistiger Türöffner zur extremen Rechten bezeichnet. Hoppe, emeritierter Wirtschaftsprofessor an der University of Nevada in Las Vegas, ist der Ansicht, das allgemeine Wahlrecht habe die Herrschaft einer „natürlichen Elite“ verdrängt; außerdem plädiert er dafür, Nationen in kleinere, homogene Gemeinschaften aufzuteilen und Kommunisten, Homosexuelle und andere, die eine solche starre Gesellschaftsordnung ablehnen, „physisch zu entfernen“. Obwohl Hoppe einen Minimalstaat befürwortet, ist er davon überzeugt, dass eine Monarchie die Freiheit wirksamer schütze als eine Demokratie.
Schon bald übernahm Yarvin Hoppes Ideal des wohlmeinenden Alleinherrschers – der effizient regiert, sinnlosen Kriegen aus dem Weg geht und vor allem das Wohlergehen seiner Untertanen im Sinn hat.
Wer sich mit der Geschichte von Diktaturen auskennt, mag diesen Gedanken für heuchlerisch halten. Nicht so Yarvin.
„Niemand plündert sein eigenes Haus“, sagte er mir eines Nachmittags in einem Straßencafé in Venice Beach. Ich hatte ihn gefragt, was seinen CEO-Monarchen davon abhalten würde, das Land auszubeuten – oder sein Volk zu versklaven –, um sich persönlich zu bereichern. In Anlehnung an Hoppe regt Yarvin an, Nationen in einen „Flickenteppich“ aus Kleinstaaten wie Singapur oder Dubai aufzuteilen, mit jeweils eigenen souveränen Herrschern. Die ewigen politischen Probleme von Legitimität, Rechenschaft und Nachfolge würden mithilfe eines Geheimausschusses gelöst, der befugt wäre, den ansonsten allmächtigen CEO dieser „hoheitlichen Unternehmen“, sogenannter sovereign corporations, kurz: SovCorp, zu bestimmen und abzuberufen.
Wählen könnten die Menschen allein mit den Füßen, indem sie von einem SovCorp in ein anderes umziehen, sobald ihnen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) nicht mehr passen, so wie man von X zu Bluesky wechselt. Die Ironie, dass Dissidenten wie Yarvin in einem solchen Staat vermutlich unterdrückt würden, scheint ihn nicht zu beunruhigen. „Man darf denken, sagen oder schreiben, was man will“, verspricht er. „Weil es dem Staat egal sein kann.“
Während Yarvin in seinen frittierten Calamari herumstocherte, lobte er China und Ruanda (beides Länder, in denen er noch nie gewesen ist) für deren starke Regierungen, die für öffentliche Sicherheit und persönliche Freiheit gleichermaßen sorgten.
Für bestimmte Menschen könne zu viel Freiheit tödlich sein, sagte Yarvin, für Meth‑Süchtige etwa oder für vierjährige Kinder. Dann deutete er auf die Obdachlosen, die in der Nähe kampierten, und begann plötzlich zu weinen. „Dass das hier Erfolg darstellen soll oder die ‚schlechteste aller Staatsformen, mit Ausnahme aller anderen‘“ – dabei bezog er sich auf Churchills berühmten Satz über die Demokratie, den ich zuvor frei zitiert hatte –, „ist doch wahnwitzig“, sagte er und wischte sich die Tränen ab. (Ein paar Wochen später war ich in London und sah, wie er bei einer ähnlichen Rede vor einem Mitglied des House of Lords die Fassung verlor. Beim zweiten Mal war es weniger ergreifend.)
Yarvins Forderung nach einem starken Mann für Amerika wird gern als exzentrische Provokation abgetan. Dabei hält er genau das für die einzige Antwort auf eine Welt, in der die wenigsten Menschen demokratietauglich seien.
Yarvin ist nicht gerade für seine Diskretion bekannt. Wie ich feststellte, hat er die Angewohnheit, private Textnachrichten und E-Mails weiterzuleiten. Was seine Freundschaft mit Peter Thiel angeht, war er zurückhaltender, erwähnte aber ein Gespräch, das die beiden im Jahr zuvor privat gefilmt hatten, und prahlte mit einem Buch, das der Milliardär ihm zum 40. Geburtstag geschenkt hatte: Francis Neilsons The Tragedy of Europe, ein zeitgenössischer Kommentar zum Zweiten Weltkrieg, wenn auch nicht die Erstausgabe, auf die Yarvin gehofft hatte.
Peter Thiel hatte schon immer ein Händchen fürs Prophetische. Er war Mitbegründer von PayPal, investierte als erster Außenstehender in Facebook und gründete Palantir, eine Data-Mining-Firma, die seit Neuestem damit beauftragt ist, den Beamten der Einwanderungsbehörde ICE bei Abschiebungen zu helfen. Thiel unterstützte Trump schon zu Zeiten, als man dafür im Silicon Valley noch geächtet wurde. Bei den Senatswahlen 2022 spendete er der Kampagne von J. D. Vance 15 Millionen Dollar – die höchste Summe in der Geschichte der Kongresswahlen, die ein einzelner Kandidat je erhalten hat. Der lange Zeit libertär eingestellte Thiel ist offenbar um 2009 herum in Richtung Yarvinismus abgebogen; in einem vom Cato Institute online veröffentlichten und viel zitierten Essay schrieb er damals: „Ich glaube nicht mehr daran, dass Freiheit mit Demokratie zu vereinbaren ist.“
In E-Mails, die dem Medienportal BuzzFeed vorliegen, prahlte Yarvin gegenüber dem Breitbart-Redakteur Milo Yiannopoulos, er habe Trumps erste Wahl bei Thiel zu Hause gesehen und sei dessen „Coach“ gewesen. „Politikmäßig hat Peter auf jeden Fall Beratungsbedarf“, antwortete Yiannopoulos. Yarvin schrieb zurück: „Weniger als man meint! … Er ist komplett aufgeklärt, agiert nur sehr vorsichtig.”
Als ich Yarvin vor kurzem in seinem Craftsman-Haus in Berkeley besuchte, fiel mir ein Gemälde auf, das Thiel ihm geschenkt hatte: ein Porträt Yarvins im Stil einer Rollenspiel-Charakterkarte mit der Aufschrift „Philosoph”. Während ich Tee aus einer Motivtasse schlürfte, auf der sein Konterfei mit einer Comic-Krone prangte, erzählte er mir, es wäre „cringe“ für ihn, seine Beziehung zu Peter Thiel herumzuposaunen – oder zu J. D. Vance, den er um 2015 herum über Thiel kennengelernt hatte. „Liest ein gewöhnlicher Wähler aus Ohio … Mencius Moldbug? Nein”, soll Vance eines Abends in einer Bar gesagt haben, am Rande der National Conservatism Conference 2021. „Aber sind sie grundsätzlich mit der Richtung einverstanden, die die amerikanische Politik unserer Meinung nach einschlagen sollte? Absolut.” „Er ist ein echt cooler Typ”, sagte Yarvin über den Vizepräsidenten.
Am Abend vor Trumps Amtseinführung fuhr ich Yarvin zu einem feierlichen „Krönungsball“ im Watergate Hotel in Washington, D.C. Veranstaltet wurde die Gala von dem neoreaktionären Verlag Passage Press, der kurz zuvor Yarvins Buch Gray Mirror, Fascicle I: Disturbance herausgebracht hatte, den ersten Band einer vierteiligen Reihe, in der er seine Vision für ein neues politisches Regime umreißt. Die Endnoten bestehen überwiegend aus QR-Code-Links zu Wikipedia-Seiten. Während ich mich durch die vereisten Straßen kämpfte, erklärte Yarvin, dass im Elisabethanischen Zeitalter die besten Köpfe aus Kunst und Wissenschaft bei Hofe zu finden waren. Als ich ihn fragte, ob er da eine Parallele zu Trumps engstem Zirkel sehe, brach er in schallendes Gelächter aus. „Oh nein”, sagte er. „Mein Gott.”
Wie den meisten Journalisten war mir der Zutritt zum Ball verwehrt, also bestellte ich mir einen Drink an einer Bar in der Lobby. Neben mir stand ein Mann mit Cowboyhut und burgunderrotem Samtanzug – ein Yarvin-Verehrer namens Alex Maxa, wie sich herausstellte. Er betrieb ein Partybus-Unternehmen in San Francisco und in seiner Freizeit entwarf er Memes mit Yarvins Konterfei. Yarvins Werk fasziniere ihn, sagte er, weil „es mir das Gefühl gibt, etwas in der Hand zu haben, gegen das die Leute in Washington, die sich für besonders schlau halten, kein schlagendes Argument vorbringen können“. Er hatte eigentlich auf den Ball gehen wollen, aber die Tickets, die inzwischen stolze 20.000 Dollar kosteten, waren ausverkauft. Wenig später traf ich zwei Freunde von Yarvin, die mir und meiner Begleitung, ebenfalls von der Presse, rieten, zusammen mit ihnen ganz selbstbewusst auf die Party zu gehen. Maxa war die Sache ähnlich angegangen und schon drinnen. „Lol, ich hab nach der Garderobe gefragt und bin einfach reinspaziert“, textete er mir.
Passage Press hatte die Veranstaltung unter dem Titel „MAGA trifft die Tech Right“ angekündigt. Das war nicht zuviel versprochen. In einem rosa und violett ausgeleuchteten Bankettsaal tummelten sich Michael Anton aus dem Außenministerium, Laura Loomer, eine Trump-Vertraute und fanatische Muslimgegnerin, und Jack Posobiec, der die Pizzagate-Verschwörungstheorie verbreitet hatte, sowie Risikokapitalgeber, Krypto-Akzelerationisten und Substack-Stars. Zuvor, während die Gäste scharf angebratene Jakobsmuscheln und Filet Mignon verspeisten, hatte Steve Bannon, der Keynote-Redner des Balls, Massenabschiebungen gefordert, die „Götterdämmerung“ des Verwaltungsstaates sowie die Inhaftierung von Mark Zuckerberg.
Nach einer halben Stunde wurde ich nach draußen eskortiert, anderen Reportern erging es im Laufe des Abends ähnlich. Der Sicherheitsdienst hielt Maxa, meinen Freund aus der Lobby, für einen von uns und warf ihn ebenfalls raus; allerdings war es ihm zuvor noch gelungen, sich durch die Menge zu zwängen, um sich mit Yarvin fotografieren zu lassen.
Selbst die pessimistischsten Kritiker Donald Trumps sind erschrocken angesichts des Tempos, mit dem der Präsident in seiner zweiten Amtszeit Amerika eine Autokratie aufbürdet und die Macht in der Exekutive bündelt – und oft genug in den Händen der reichsten Männer der Welt.
Unterdessen hat die Regierung einen Angriff auf die Zivilgesellschaft gestartet, etwa, indem sie Harvard und anderen Universitäten – angeblich Bastionen ideologischer Indoktrination – die Mittel strich und Anwaltskanzleien abstrafte, die Trumps Gegner vertreten hatten. Sie hat den Apparat der Einwanderungsbehörde ausgebaut und drei in den USA geborene Kinder nach Honduras deportiert, eine Gruppe asiatischer und lateinamerikanischer Einwanderer nach Afrika und über 200 venezolanische Migranten in ein Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador, wo sie womöglich für den Rest ihres Lebens bleiben müssen.
US-Bürgerinnen und -Bürger sehen sich nun einer Regierung gegenüber, die sich das Recht herausnimmt, sie ohne ordentliches Gerichtsverfahren einfach verschwinden zu lassen: Oder wie Trump es während eines Treffens im Oval Office zum Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele, sagte: „Einheimische sind als nächstes dran.“ Ohne ein wirksames System der Gewaltenteilung gibt es keinen Filter für die bizarren Ideen eines einzelnen Mannes – etwa die, einen widersprüchlichen Handelskrieg vom Zaun zu brechen, der die Weltwirtschaft auf den Kopf stellt. Diese Ideen werden zu konkreten Maßnahmen, an denen sich seine Familie und seine Verbündeten bereichern.
Im Mai 2025 sagte ein anonymer DOGE-Berater gegenüber der Washington Post, es sei „ein offenes Geheimnis, dass alle politischen Entscheidungsträger Yarvin gelesen haben“. Stephen Miller, der stellvertretende Stabschef des Präsidenten, hat ihn kürzlich in einem Tweet zitiert. J. D. Vance hat gefordert, dass sich die USA aus Europa zurückziehen, was Yarvin seit langem ein Bedürfnis ist. Im April 2024 schlug Yarvin vor, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben und das Gebiet in ein Luxusresort zu verwandeln. „Hat da jemand ‚Strandhaus‘ gesagt?“, schrieb er auf Substack. „Das neue Gaza – natürlich von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner entwickelt – ist das LA des Mittelmeers, eine nagelneue Charter City am ältesten Ozean der Menschheit, ein Filetgrundstück samt einer absolut perfekten, einer absolut perfekten Regierung in Apple-Qualität.“ Im Februar 2025 überraschte Trump seine Berater während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, als er einen beinahe identischen Vorschlag machte und sein saniertes Gaza als „die Riviera des Nahen Ostens“ bezeichnete.
Wann immer ich Yarvin nach Parallelen zwischen seinen Texten und realen Ereignissen fragte, gab er sich lässig. Offenbar sah er sich selbst als Kanal für die reine Vernunft – rätselhaft war ihm allein, warum andere ihm immer so hinterherhinkten. „Eine Lüge kann man erfinden, die Wahrheit aber kann man nur entdecken“, sagte er zu mir.
Aus dem amerikanischen Englisch von Beatrice Faßbender