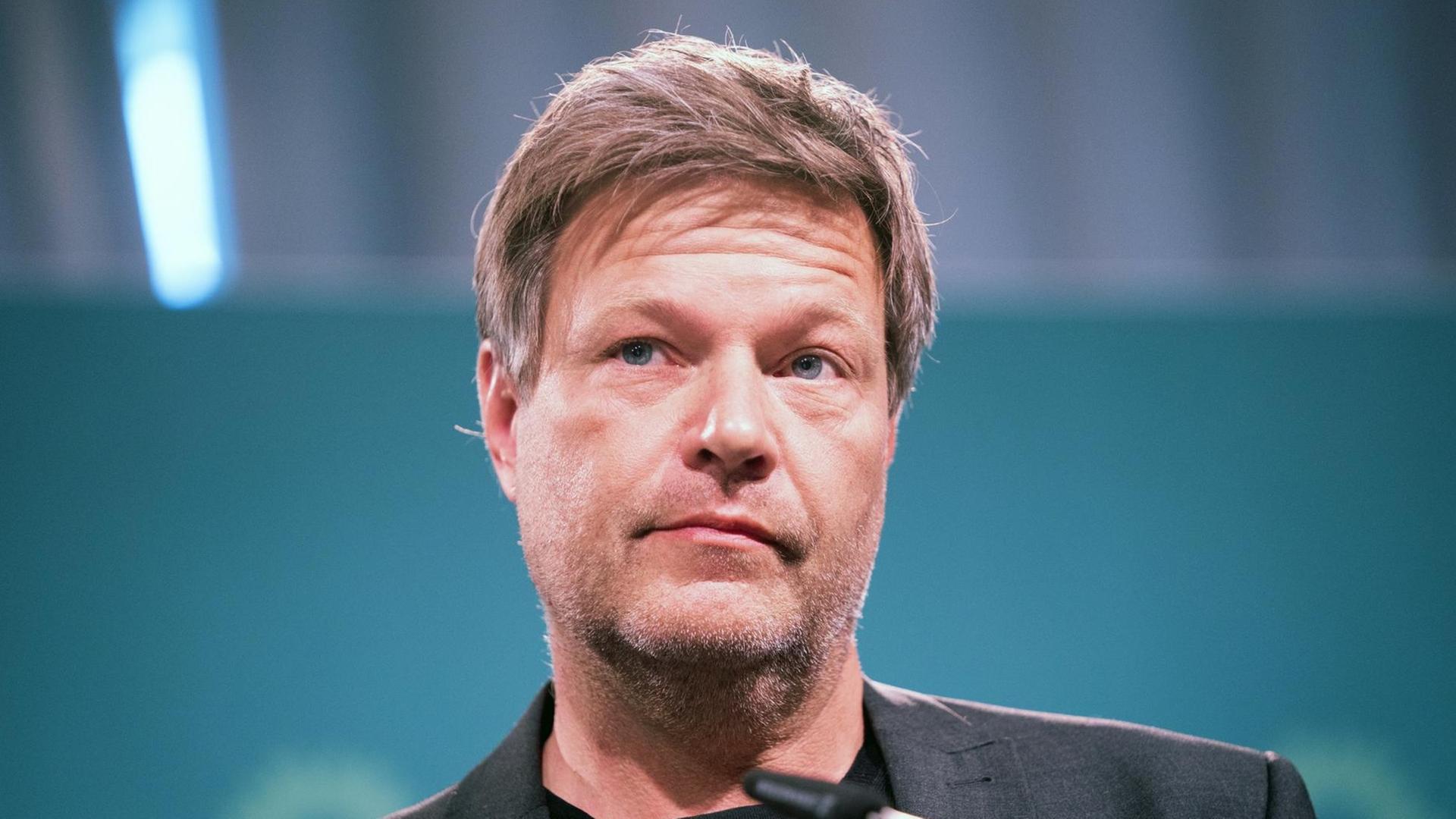Ein wolkiger Sommertag in einem Dorf in der südukrainischen Region Cherson. Zwei Fußballteams duellieren sich, gekleidet in Weiß und Hellblau, ein Livestream überträgt. Viel Publikum ist nicht vor Ort, die Rufe der Spieler vermischen sich mit Hundegebell. Am Ende gewinnt Tawrija Simferopol, das Team in Hellblau, mit 6:1. Bedeutsamer ist aber das Spiel an sich.
Der von der Krim stammende FK Tawrija ist im ukrainischen Fußball ein Traditionsverein. Nach der Annexion der Halbinsel durch Russland 2014 wurde der Klub aufgelöst. Dass er heute bereits wieder in der zweiten ukrainischen Liga spielt, ist auch Oleh Komuniar zu verdanken. Der 30-Jährige kommt aus Simferopol und ist glühender Tawrija-Fan. Er unterstützte 2013 die Maidan-Proteste und floh nach Kiew. Mit Gleichgesinnten half er, den Klub neu zu gründen:
"Wir haben viele Personen aus Politik und Fußball kontaktiert, zunächst ohne Erfolg. Nach etwa einem Jahr stießen wir auf einen von der Krim stammenden Politologen – er hatte auf Facebook gepostet, dass er die Auflösung von Tawrija bedauere. Also schrieb ich ihm. Er hatte viele Kontakte und organisierte eine Konferenz, unter anderem mit dem ehemaligen Klubpräsidenten. Im Jahr 2016 war Tawrija wiedergeboren."
Der von der Krim stammende FK Tawrija ist im ukrainischen Fußball ein Traditionsverein. Nach der Annexion der Halbinsel durch Russland 2014 wurde der Klub aufgelöst. Dass er heute bereits wieder in der zweiten ukrainischen Liga spielt, ist auch Oleh Komuniar zu verdanken. Der 30-Jährige kommt aus Simferopol und ist glühender Tawrija-Fan. Er unterstützte 2013 die Maidan-Proteste und floh nach Kiew. Mit Gleichgesinnten half er, den Klub neu zu gründen:
"Wir haben viele Personen aus Politik und Fußball kontaktiert, zunächst ohne Erfolg. Nach etwa einem Jahr stießen wir auf einen von der Krim stammenden Politologen – er hatte auf Facebook gepostet, dass er die Auflösung von Tawrija bedauere. Also schrieb ich ihm. Er hatte viele Kontakte und organisierte eine Konferenz, unter anderem mit dem ehemaligen Klubpräsidenten. Im Jahr 2016 war Tawrija wiedergeboren."
Vertriebene aus der Krim auf dem ukrainischen Festland
In Kiew arbeitet Komuniar als IT-Experte, den Klub unterstützt er ehrenamtlich. Häufig pendelt er zu den Heimspielen am neuen Sitz des Vereins. In dessen Neugründung sieht er eine politische Botschaft:
"Unsere Aufgabe hat informativen Charakter. Dadurch, dass unser Verein wieder im ukrainischen Profifußball spielt, zeigen wir, dass die Krim Teil der Ukraine ist. Von der Regierung erwarte ich, dass sie dies nachdrücklich vertritt und sich für Sanktionen gegen Russland einsetzt."
Die neue Existenz von Tawrija Simferopol zeigt, wie sich Teile des zivilen Lebens der Krim auf das ukrainische Festland verlagert haben. Offiziell wurden dort bisher 47.000 Binnenvertriebene von der Krim registriert. Tatsächlich sind es laut der Nichtregierungsorganisation "KrymSOS" etwa 100.000. Die Integration der von der Krim stammenden Menschen hält "KrymSOS" für relativ gut gelungen. Ein Großteil hat sich in Kiew und Lwiw niedergelassen, oft wurden eigene Firmen gegründet. Bei den Kommunalwahlen im Herbst 2020 durften Krim-Vertriebene erstmals ihre Stimme abgeben. Denys Savchenko von "KrymSOS" begrüßt dies. Doch er sieht noch Defizite:
"Es kommt weiterhin vor, dass Krim-Vertriebene diskriminiert werden, auch wenn es dazu keine Erhebungen gibt. Einige werden bei der Wohnungssuche benachteiligt. Oder potenzielle Arbeitgeber sagen, dass sie sie nur schwarz einstellen wollen. Außerdem haben die Krimtataren spezielle Anliegen. Für sie gibt es bis heute nicht genug muslimische Friedhöfe und Moscheen."
Savchenko fordert eine Erhöhung der staatlichen Beihilfe für Vertriebene von derzeit umgerechnet etwa 50 US-Dollar pro Monat und einen Ausbau staatlicher Wohnungen für sie. Außerdem beklagt er, dass die Krim in der Öffentlichkeit nach 2014 immer seltener thematisiert worden ist. Diesen Eindruck bestätigen auf Nachfrage auch Kiewer Akteure aus politischen Stiftungen, der Zivilgesellschaft und Medien. Ein wichtiger Grund sei die Psychologie. Der rapide Verlust der Halbinsel sei im kollektiven Gedächtnis eine schmerzliche Erfahrung, schrieb die Journalistin Oksana Hrytsenko für das Portal "Ukraine verstehen", einem Projekt des Thinktanks Liberale Moderne. Denys Savchenko von der Organisation "KrymSOS" betont, er habe lange auf eine nachhaltige Strategie zum Umgang mit der Annexion gewartet, damit sie nicht still hingenommen werde. Nun scheint sich etwas zu verändern.
"Unsere Aufgabe hat informativen Charakter. Dadurch, dass unser Verein wieder im ukrainischen Profifußball spielt, zeigen wir, dass die Krim Teil der Ukraine ist. Von der Regierung erwarte ich, dass sie dies nachdrücklich vertritt und sich für Sanktionen gegen Russland einsetzt."
Die neue Existenz von Tawrija Simferopol zeigt, wie sich Teile des zivilen Lebens der Krim auf das ukrainische Festland verlagert haben. Offiziell wurden dort bisher 47.000 Binnenvertriebene von der Krim registriert. Tatsächlich sind es laut der Nichtregierungsorganisation "KrymSOS" etwa 100.000. Die Integration der von der Krim stammenden Menschen hält "KrymSOS" für relativ gut gelungen. Ein Großteil hat sich in Kiew und Lwiw niedergelassen, oft wurden eigene Firmen gegründet. Bei den Kommunalwahlen im Herbst 2020 durften Krim-Vertriebene erstmals ihre Stimme abgeben. Denys Savchenko von "KrymSOS" begrüßt dies. Doch er sieht noch Defizite:
"Es kommt weiterhin vor, dass Krim-Vertriebene diskriminiert werden, auch wenn es dazu keine Erhebungen gibt. Einige werden bei der Wohnungssuche benachteiligt. Oder potenzielle Arbeitgeber sagen, dass sie sie nur schwarz einstellen wollen. Außerdem haben die Krimtataren spezielle Anliegen. Für sie gibt es bis heute nicht genug muslimische Friedhöfe und Moscheen."
Savchenko fordert eine Erhöhung der staatlichen Beihilfe für Vertriebene von derzeit umgerechnet etwa 50 US-Dollar pro Monat und einen Ausbau staatlicher Wohnungen für sie. Außerdem beklagt er, dass die Krim in der Öffentlichkeit nach 2014 immer seltener thematisiert worden ist. Diesen Eindruck bestätigen auf Nachfrage auch Kiewer Akteure aus politischen Stiftungen, der Zivilgesellschaft und Medien. Ein wichtiger Grund sei die Psychologie. Der rapide Verlust der Halbinsel sei im kollektiven Gedächtnis eine schmerzliche Erfahrung, schrieb die Journalistin Oksana Hrytsenko für das Portal "Ukraine verstehen", einem Projekt des Thinktanks Liberale Moderne. Denys Savchenko von der Organisation "KrymSOS" betont, er habe lange auf eine nachhaltige Strategie zum Umgang mit der Annexion gewartet, damit sie nicht still hingenommen werde. Nun scheint sich etwas zu verändern.
Präsident Selenskyjs Aufmerksamkeit für die Krim
Seit März 2020 ist wochentags "In Wirklichkeit" zu sehen, eine Magazinsendung des TV-Kanals "Dom", auf Deutsch Haus. Sie analysiert aktuelle politische Themen, oft im Interview mit Regierungsmitgliedern. Neben Infoformaten sendet "Dom" auch Filme und Unterhaltung, zu sehen über Satellit oder online. Der Kanal soll ein Gegengewicht zu kremlnahen russischen Medien bilden und richtet sich exklusiv an Bewohner der aus ukrainischer Sicht besetzten Gebiete wie der Krim.
Finanziert wird "TV Dom" aus dem Staatshaushalt. Der Sender stößt in der Ukraine aber auch auf Kritik – etwa, weil er nur auf Russisch sendet, anstatt die ukrainische Sprache zu fördern. Außerdem gebe es zu viel Regierungsnähe. In der Tat hat Wolodymyr Selenskyj den Sender explizit als Teil seiner Krim-Politik erwähnt. Überhaupt spricht der Präsident seit Monaten auffällig oft über die Halbinsel. Das tat er auch Ende 2020 im Parlament in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation:
"Wir vergessen nicht, dass auch auf der Krim unsere Mitbürger leben. Wir müssen und werden weiter für sie kämpfen, besonders für die junge Generation. Seit kurzem können dortige junge Menschen in allen Hochschulen der Ukraine kostenlos studieren. Und vielen Mitbürgern, die von den Invasoren als Geiseln gehalten werden, senden wir ein klares Signal: Fürchtet Euch nicht!"
Finanziert wird "TV Dom" aus dem Staatshaushalt. Der Sender stößt in der Ukraine aber auch auf Kritik – etwa, weil er nur auf Russisch sendet, anstatt die ukrainische Sprache zu fördern. Außerdem gebe es zu viel Regierungsnähe. In der Tat hat Wolodymyr Selenskyj den Sender explizit als Teil seiner Krim-Politik erwähnt. Überhaupt spricht der Präsident seit Monaten auffällig oft über die Halbinsel. Das tat er auch Ende 2020 im Parlament in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation:
"Wir vergessen nicht, dass auch auf der Krim unsere Mitbürger leben. Wir müssen und werden weiter für sie kämpfen, besonders für die junge Generation. Seit kurzem können dortige junge Menschen in allen Hochschulen der Ukraine kostenlos studieren. Und vielen Mitbürgern, die von den Invasoren als Geiseln gehalten werden, senden wir ein klares Signal: Fürchtet Euch nicht!"
Ende 2016 hatte der Kiewer Oligarch Viktor Pintschuk noch angeregt, die Krim-Frage vorerst ad acta zu legen, um sich mit Russland auf Frieden in der Ostukraine zu einigen. Pintschuk erntete dafür viel Kritik – dass die Ukraine die Krim-Annexion nicht akzeptiert, gilt politisch weitgehend als Konsens. Doch substanzielle Initiativen gab es kaum. 2019 schlug die liberale Oppositionspartei "Stimme" vor, die Krim-Frage in den Minsker Friedensprozess, das Gremium zur Beilegung des Krieges im Donbass, zu integrieren. Wegen des Widerstands Russlands war dies aussichtslos. Eine konkrete Krim-Strategie blieb Petro Poroschenko, Selenskyjs Vorgänger im Präsidentenamt, schuldig. Selenskyj selbst hat die Krim nun zu einer politischen Priorität erklärt. Das Ziel ist nichts weniger als die Wiedereingliederung der Halbinsel. Dafür signierte er ein fast 100 Punkte umfassendes Strategiepapier.
Die Deklarationen bündeln zum Teil bereits bestehende Maßnahmen wie die Förderung der Hochschulbildung für Studenten von der Krim auf dem Festland. Schwerpunkt der sogenannten De-Okkupationsstrategie ist die Außenpolitik. Für Susan Stewart, Politologin und Osteuropaexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist das keine Überraschung:
"Selenskyj hatte versprochen, dass er Frieden im Donbass bringen würde – was ihm nicht gelungen ist. Ich denke, dass er gesehen hat, dass es viel schwieriger ist, als er erwartet hatte, Reformschritte innerhalb der Ukraine zu unternehmen. Deshalb ist er stärker dazu übergangen zu dieser Schiene der ‚Ukraine als Opfer der russischen Aggression‘ übergangen – im Donbass, aber als zweite Schiene der Frage der Krim. Und dass das ihm ermöglicht, mit den ausländischen Partnern über diese Schiene ins Gespräch zu kommen."
Die Deklarationen bündeln zum Teil bereits bestehende Maßnahmen wie die Förderung der Hochschulbildung für Studenten von der Krim auf dem Festland. Schwerpunkt der sogenannten De-Okkupationsstrategie ist die Außenpolitik. Für Susan Stewart, Politologin und Osteuropaexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist das keine Überraschung:
"Selenskyj hatte versprochen, dass er Frieden im Donbass bringen würde – was ihm nicht gelungen ist. Ich denke, dass er gesehen hat, dass es viel schwieriger ist, als er erwartet hatte, Reformschritte innerhalb der Ukraine zu unternehmen. Deshalb ist er stärker dazu übergangen zu dieser Schiene der ‚Ukraine als Opfer der russischen Aggression‘ übergangen – im Donbass, aber als zweite Schiene der Frage der Krim. Und dass das ihm ermöglicht, mit den ausländischen Partnern über diese Schiene ins Gespräch zu kommen."
"Krim-Plattform" erregt Aufsehen
Selenskyj setze also einen neuen Akzent, um mehr Aufmerksamkeit für sich und seine Außenpolitik zu erzeugen.
Über das außenpolitische Kernprojekt der Krim-Strategie Selenskyjs wird seit Wochen berichtet. Krim-Plattform heißt die Initiative, die am 23. August mit einem Gipfeltreffen starten soll, tags darauf feiert die Ukraine den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. Erwartet werden Vertreter aus 40 Ländern wie den USA, Großbritannien und vielen EU-Mitgliedern, auch Deutschland. Laut Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Berlin, fehle ein politisches Format, das die Annexion weltweit in den Fokus rücke:
"Darauf zielt dieser Gipfel in Kiew. Nämlich, einen Prozess in Gang zu setzen, damit all die akuten Themen, über die nur wenig gesprochen wird – Menschenrechtslage, die militärischen Kapazitäten auf der Krim – auf die Tagesordnung zu bringen. Und um die De-Okkupation von diesen Gebieten letztendlich auch zu ermöglichen, und zwar auf einem diplomatischen Weg."
Die EU erkennt die Einverleibung der Krim durch Russland nicht an, seit sieben Jahren sind Sanktionen in Kraft. Sie enthalten etwa ein Einfuhrverbot für Waren von der Halbinsel, außerdem sind touristische Dienstleistungen dort untersagt. Kiew wünscht sich eine Ausweitung der Sanktionen auf weitere Sparten. Zudem soll die UNO Zugang zur Krim bekommen, um vor Ort die Lage der Bürgerrechte dokumentieren zu können. Seit Jahren gibt es Berichte über Restriktionen vor allem gegen die muslimische Minderheit der Krimtataren. Laut Botschafter Andrij Melnyk säßen viele aus politischen Gründen im Gefängnis. Für ihn wäre es kurzfristig ein Erfolg, wenn sich deren Lage verbessern ließe – durch weiteren Druck auf Russland. Die Krim-Plattform solle dafür entsprechende Maßnahmen koordinieren.
Über das außenpolitische Kernprojekt der Krim-Strategie Selenskyjs wird seit Wochen berichtet. Krim-Plattform heißt die Initiative, die am 23. August mit einem Gipfeltreffen starten soll, tags darauf feiert die Ukraine den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit. Erwartet werden Vertreter aus 40 Ländern wie den USA, Großbritannien und vielen EU-Mitgliedern, auch Deutschland. Laut Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Berlin, fehle ein politisches Format, das die Annexion weltweit in den Fokus rücke:
"Darauf zielt dieser Gipfel in Kiew. Nämlich, einen Prozess in Gang zu setzen, damit all die akuten Themen, über die nur wenig gesprochen wird – Menschenrechtslage, die militärischen Kapazitäten auf der Krim – auf die Tagesordnung zu bringen. Und um die De-Okkupation von diesen Gebieten letztendlich auch zu ermöglichen, und zwar auf einem diplomatischen Weg."
Die EU erkennt die Einverleibung der Krim durch Russland nicht an, seit sieben Jahren sind Sanktionen in Kraft. Sie enthalten etwa ein Einfuhrverbot für Waren von der Halbinsel, außerdem sind touristische Dienstleistungen dort untersagt. Kiew wünscht sich eine Ausweitung der Sanktionen auf weitere Sparten. Zudem soll die UNO Zugang zur Krim bekommen, um vor Ort die Lage der Bürgerrechte dokumentieren zu können. Seit Jahren gibt es Berichte über Restriktionen vor allem gegen die muslimische Minderheit der Krimtataren. Laut Botschafter Andrij Melnyk säßen viele aus politischen Gründen im Gefängnis. Für ihn wäre es kurzfristig ein Erfolg, wenn sich deren Lage verbessern ließe – durch weiteren Druck auf Russland. Die Krim-Plattform solle dafür entsprechende Maßnahmen koordinieren.
Russland: auf der Krim Fakten geschaffen
Moskau kritisiert die Initiative und betrachtet eine Teilnahme daran laut Außenministerium als Eingriff in die territoriale Integrität Russlands. In der 2020 überarbeiteten Verfassung wird die Krim explizit als russisches Gebiet definiert. Ukrainische Experten beobachten, dass Moskau diplomatischen Druck auf Teilnehmerstaaten ausübt. Politische Zugeständnisse zur Krim schließt Russland bisher kategorisch aus. Vielmehr hat Präsident Wladimir Putin auf der Halbinsel Fakten geschaffen. Die militärische Präsenz Russlands wurde vor Ort massiv ausgebaut, regelmäßig werden russische Staatsbürger angesiedelt. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk setzt aber darauf, dass sich diese Strategie auf Dauer nicht rentiert:
"Sie wissen, dass die Wirtschaft der Krim massiv subventioniert werden muss, auch wegen der Sanktionen, und sich die Halbinsel somit nicht erfolgreich entwickeln kann. Die heutige Situation ist für die meisten Menschen – für Bürger, die ihre Wohnung und Häuser zum Beispiel im Sommer vermietet haben – schlechter geworden."
Dass eine Wiedereingliederung jedoch in absehbarer Zeit kaum realistisch ist, räumt auch Melnyk ein. Er setzt auf einen langen Atem der Ukraine und ihrer Unterstützer. Susan Stewart, Osteuropaexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, sieht es ähnlich:
"Da müssten wir eine ganze andere internationale Lage haben – wo wir ein Russland haben, das keine andere Wahl hat, wie beim Zusammenbruch der Sowjetunion."
"Sie wissen, dass die Wirtschaft der Krim massiv subventioniert werden muss, auch wegen der Sanktionen, und sich die Halbinsel somit nicht erfolgreich entwickeln kann. Die heutige Situation ist für die meisten Menschen – für Bürger, die ihre Wohnung und Häuser zum Beispiel im Sommer vermietet haben – schlechter geworden."
Dass eine Wiedereingliederung jedoch in absehbarer Zeit kaum realistisch ist, räumt auch Melnyk ein. Er setzt auf einen langen Atem der Ukraine und ihrer Unterstützer. Susan Stewart, Osteuropaexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, sieht es ähnlich:
"Da müssten wir eine ganze andere internationale Lage haben – wo wir ein Russland haben, das keine andere Wahl hat, wie beim Zusammenbruch der Sowjetunion."
Stärkere Militärpräsenz Russlands im Schwarzen Meer
Die größte Aussicht auf Erfolge sieht die Politologin zunächst im Schwarzen Meer. Dort hat Russland seine Dominanz nach der Annexion ausgebaut, unter anderem durch den Bau einer Brücke zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland. Das nutzte Moskau im Herbst 2018, um ukrainischen Schiffen die Durchfahrt ins eigene Territorium im Asowschen Meer, einem Nebengewässer des Schwarzen Meeres, zu verweigern. Im April dieses Jahres verstärkte Russland im Rahmen von Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine auch das Kontingent auf der Krim – was Angst vor einer neuen Kriegsfront auslöste. Etwa mit Blick auf den dadurch gefährdeten Schiffsverkehr, sagt Susan Stewart, hätten Partner der Ukraine im Schwarzen Meer gleiche Interessen. Stärkere Präsenz dort könne Russland viel entgegensetzen:
"Wir haben in der Vergangenheit sehr oft gesehen, dass die russische Führung testet, wo die Schwächen anderer Akteure sind, und wenn sie diese Schwächen entdeckt, bohrt sie da nach. Von daher gilt es auch hier im Fall des Schwarzen Meeres, Stärke zu zeigen. Man sieht, dass wenn die Russen sich beobachtet fühlen, dann verhalten sie sich anders, als wenn das nicht der Fall ist."
"Wir haben in der Vergangenheit sehr oft gesehen, dass die russische Führung testet, wo die Schwächen anderer Akteure sind, und wenn sie diese Schwächen entdeckt, bohrt sie da nach. Von daher gilt es auch hier im Fall des Schwarzen Meeres, Stärke zu zeigen. Man sieht, dass wenn die Russen sich beobachtet fühlen, dann verhalten sie sich anders, als wenn das nicht der Fall ist."
Gleichwohl mahnt Stewart, die Ressourcen für die Krim-Plattform nicht zulasten innenpolitischer Reformen zu verwenden, die derzeit stockten. Im Kiewer Parlament gibt es für Selenskyjs Krim-Pläne zwar Lob, aber auch die Sorge, dass andere akute Themen kürzertreten. Die Oppositionsabgeordnete Valeriya Zaruzhko hat es so formuliert:
"Positiv ist, dass ein neuer Diskurs zur Krim entsteht. Die Regierung stellt die Krim-Plattform aber als eine Art Allheilmittel dar. So als ob sie mit einem Fingerschnippen zurückkäme. Ich selbst lasse den Donbass nicht aus dem Blick. Russland hat dieses Gebiet nicht annektiert. Es wäre einfacher und schneller, erst den Donbass zurückzuholen und danach über die Krim zu sprechen."
Zumindest öffentlich setzt die ukrainische Regierung die größten Akzente momentan klar in Bezug auf die Halbinsel. Hier wähnt Kiew außerdem noch ein anderes Druckmittel in der eigenen Hand.
"Positiv ist, dass ein neuer Diskurs zur Krim entsteht. Die Regierung stellt die Krim-Plattform aber als eine Art Allheilmittel dar. So als ob sie mit einem Fingerschnippen zurückkäme. Ich selbst lasse den Donbass nicht aus dem Blick. Russland hat dieses Gebiet nicht annektiert. Es wäre einfacher und schneller, erst den Donbass zurückzuholen und danach über die Krim zu sprechen."
Zumindest öffentlich setzt die ukrainische Regierung die größten Akzente momentan klar in Bezug auf die Halbinsel. Hier wähnt Kiew außerdem noch ein anderes Druckmittel in der eigenen Hand.
Streit um die Wasserversorgung
Auch die Krim war dieses Jahr von Wetterextremen betroffen. Der Sender "Radio Swaboda" schilderte im Juni, wie Starkregen die Stadt Kertsch unter Wasser setzte. Ganze Kioske schwammen durch die überfluteten Straßen. Das Naturereignis war eine bittere Pointe – meistens bestimmt Wassermangel den Alltag auf der Halbinsel. Bis zur russischen Annexion wurde etwa 85 Prozent des Bedarfs aus dem Fluss Dnjepr bezogen, abgeleitet über den Nord-Krim-Kanal. Kiew sperrte ihn aber. An vielen Orten wird die Wasserversorgung oft auf wenige Stunden pro Tag begrenzt. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andrij Melnyk, verteidigt die Maßnahme:
"Wir gehen davon aus, dass das falsch wäre, die Besatzer zu stärken, indem man das Wasser zur Verfügung stellt. Der Mangel an Wasser betrifft vor allem nicht die privaten Haushalte, sondern die Militärindustrie."
Für die Versorgung der Krim, so Kiew, sei Russland verantwortlich. Eine Ausnahme könnten Trinkwasserlieferungen in einer humanitären Notlage sein. Die harte Linie wird in der Ukraine generell unterstützt, aber auch hinterfragt. Ihor Kolykhaiev, Bürgermeister der Großstadt Cherson im Süden der Ukraine, sprach sich für den Verkauf von Wasser auf die Krim aus, auch um Kontakte zur dortigen Bevölkerung zu fördern. Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj werden solche Überlegungen nachgesagt, was innenpolitisch aber kaum vermittelbar wäre. In Selenskyjs offizieller Krim-Strategie heißt es, die Wasserversorgung der Halbinsel werde erst nach der De-Okkupation erfolgen.
Russland kritisiert das scharf. Selbst vor einer möglichen Invasion der Südukraine, um Zugang zum Nord-Krim-Kanal zu bekommen, warnten Sicherheitsexperten schon. Und Moskau ist wegen der Blockade vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Die Wasserengpässe ausgleichen konnte Russland trotz Investitionen in Brunnen und Stauseen bisher nicht. Verschärft wird die Knappheit durch Dürren und hohen Verbrauch russischer Touristen. Das Wasserproblem erschwert es Wladimir Putin, das Versprechen eines steigenden Wohlstands auf der Krim einzulösen. Jewgenij Repenkow, Einwohner der Krim-Metropole Sewastopol, macht aber nicht Russland als Schuldigen aus:
"Das ist ein Geschenk der Ukraine an uns. In Kiew heißt es immer: ‘Auf der Krim sind unsere Leute. Wir lieben euch, bald sind wir wieder beisammen.‘ Und dann stellen sie uns das Wasser ab. Diese Logik muss man mir mal erklären."
"Wir gehen davon aus, dass das falsch wäre, die Besatzer zu stärken, indem man das Wasser zur Verfügung stellt. Der Mangel an Wasser betrifft vor allem nicht die privaten Haushalte, sondern die Militärindustrie."
Für die Versorgung der Krim, so Kiew, sei Russland verantwortlich. Eine Ausnahme könnten Trinkwasserlieferungen in einer humanitären Notlage sein. Die harte Linie wird in der Ukraine generell unterstützt, aber auch hinterfragt. Ihor Kolykhaiev, Bürgermeister der Großstadt Cherson im Süden der Ukraine, sprach sich für den Verkauf von Wasser auf die Krim aus, auch um Kontakte zur dortigen Bevölkerung zu fördern. Auch Präsident Wolodymyr Selenskyj werden solche Überlegungen nachgesagt, was innenpolitisch aber kaum vermittelbar wäre. In Selenskyjs offizieller Krim-Strategie heißt es, die Wasserversorgung der Halbinsel werde erst nach der De-Okkupation erfolgen.
Russland kritisiert das scharf. Selbst vor einer möglichen Invasion der Südukraine, um Zugang zum Nord-Krim-Kanal zu bekommen, warnten Sicherheitsexperten schon. Und Moskau ist wegen der Blockade vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Die Wasserengpässe ausgleichen konnte Russland trotz Investitionen in Brunnen und Stauseen bisher nicht. Verschärft wird die Knappheit durch Dürren und hohen Verbrauch russischer Touristen. Das Wasserproblem erschwert es Wladimir Putin, das Versprechen eines steigenden Wohlstands auf der Krim einzulösen. Jewgenij Repenkow, Einwohner der Krim-Metropole Sewastopol, macht aber nicht Russland als Schuldigen aus:
"Das ist ein Geschenk der Ukraine an uns. In Kiew heißt es immer: ‘Auf der Krim sind unsere Leute. Wir lieben euch, bald sind wir wieder beisammen.‘ Und dann stellen sie uns das Wasser ab. Diese Logik muss man mir mal erklären."
Wasserblockade wird auf der Krim negativ gesehen
Für eine Wiedervereinigung mit der Krim müsste Kiew auch die Bevölkerung dort auf ihre Seite ziehen. Doch Worte wie die von Jewgenij Repenkow lassen daran zweifeln. Der Mittsechziger war jahrzehntelang im Fußball tätig und ist erklärter Lokalpatriot. Die Maidan-Proteste, die den damaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch in die Flucht trieben, lehnte er ab. Repenkow sagt, die Proteste seien von Rechtsextremen dominiert worden – was nicht stimmt und ein oft von Russland befeuertes Narrativ ist. Repenkow äußert sich aber auch differenziert:
"Ich kann über die Ukraine kein schlechtes Wort verlieren. Ich kenne viele wunderbare Menschen dort. Mir gefällt die ukrainische Sprache. Um es deutlich zu sagen – ich war nicht gegen die Ukraine oder für Russland. Ich war gegen die Schurken und den Umsturz in Kiew. So was macht man nicht. Janukowitsch war zwar ein Ganove – aber um ihn loszuwerden, gab es demokratische Mechanismen."
Wladislaw Ossipow wundern solche Aussagen nicht. Auch er lebt in Sewastopol und ist freier Journalist. Der Großteil der heutigen Einwohner der Krim, so Ossipow, lebe in einem von russischen Aspekten dominierten Alltag. Die Wasserblockade Kiews werde von fast allen negativ betrachtet:
"Das meiste Geld wird auf der Krim nicht mit Tourismus, sondern mit Landwirtschaft verdient. Heute wird zum Beispiel kein Reis mehr angebaut. Mit der Wasserblockade hat die Ukraine also zum großen Teil die eigenen Leute getroffen. Das war eine dumme Idee."
Ossipow hält eine Lösung des Wasserproblems für möglich, aber erst unter künftigen Präsidenten beider Länder, jetzt seien die Fronten verhärtet. Themen wie die De-Okkupationsstrategie der Ukraine werden laut Ossipow auf der Krim kaum registriert. Eine Wiedervereinigung, selbst theoretisch unter günstigen politischen Bedingungen, hält er auch emotional für schwer vermittelbar:
"Die Erschütterung von 2014 brachte enorme Veränderungen, dabei ist es unerheblich, ob zum Guten oder Schlechten. Es war schlicht eine schwere Zeit. Wenn man so etwas wiederholen wollte, wäre es genauso, als wenn die Ukraine einen neuen Maidan durchleben müsste. Ich bezweifle, dass das dort jemand will."
In Cherson im Süden der Ukraine ist Fußballklub Tawrija Simferopol jedenfalls gut in die neue Saison gestartet. Fan Oleh Komuniar glaubt, dass sein Verein bald in die höchste Spielklasse zurückkehrt. Auch hinsichtlich einer physischen Heimkehr auf die Krim äußert er Optimismus:
"Ich hoffe, dass ich das noch erlebe. Ich möchte gerne zurückkehren, und dass unser Klub heimkommt. Ich glaube, die Rückkehr der Krim in die Ukraine ist unausweichlich. Aber – wir müssen vorbereitet sein."
Doch vielleicht hofft auch er, dass bis dahin die Gräben zwischen dem ukrainischen Festland und der Halbinsel nicht zu tief werden.
"Ich kann über die Ukraine kein schlechtes Wort verlieren. Ich kenne viele wunderbare Menschen dort. Mir gefällt die ukrainische Sprache. Um es deutlich zu sagen – ich war nicht gegen die Ukraine oder für Russland. Ich war gegen die Schurken und den Umsturz in Kiew. So was macht man nicht. Janukowitsch war zwar ein Ganove – aber um ihn loszuwerden, gab es demokratische Mechanismen."
Wladislaw Ossipow wundern solche Aussagen nicht. Auch er lebt in Sewastopol und ist freier Journalist. Der Großteil der heutigen Einwohner der Krim, so Ossipow, lebe in einem von russischen Aspekten dominierten Alltag. Die Wasserblockade Kiews werde von fast allen negativ betrachtet:
"Das meiste Geld wird auf der Krim nicht mit Tourismus, sondern mit Landwirtschaft verdient. Heute wird zum Beispiel kein Reis mehr angebaut. Mit der Wasserblockade hat die Ukraine also zum großen Teil die eigenen Leute getroffen. Das war eine dumme Idee."
Ossipow hält eine Lösung des Wasserproblems für möglich, aber erst unter künftigen Präsidenten beider Länder, jetzt seien die Fronten verhärtet. Themen wie die De-Okkupationsstrategie der Ukraine werden laut Ossipow auf der Krim kaum registriert. Eine Wiedervereinigung, selbst theoretisch unter günstigen politischen Bedingungen, hält er auch emotional für schwer vermittelbar:
"Die Erschütterung von 2014 brachte enorme Veränderungen, dabei ist es unerheblich, ob zum Guten oder Schlechten. Es war schlicht eine schwere Zeit. Wenn man so etwas wiederholen wollte, wäre es genauso, als wenn die Ukraine einen neuen Maidan durchleben müsste. Ich bezweifle, dass das dort jemand will."
In Cherson im Süden der Ukraine ist Fußballklub Tawrija Simferopol jedenfalls gut in die neue Saison gestartet. Fan Oleh Komuniar glaubt, dass sein Verein bald in die höchste Spielklasse zurückkehrt. Auch hinsichtlich einer physischen Heimkehr auf die Krim äußert er Optimismus:
"Ich hoffe, dass ich das noch erlebe. Ich möchte gerne zurückkehren, und dass unser Klub heimkommt. Ich glaube, die Rückkehr der Krim in die Ukraine ist unausweichlich. Aber – wir müssen vorbereitet sein."
Doch vielleicht hofft auch er, dass bis dahin die Gräben zwischen dem ukrainischen Festland und der Halbinsel nicht zu tief werden.