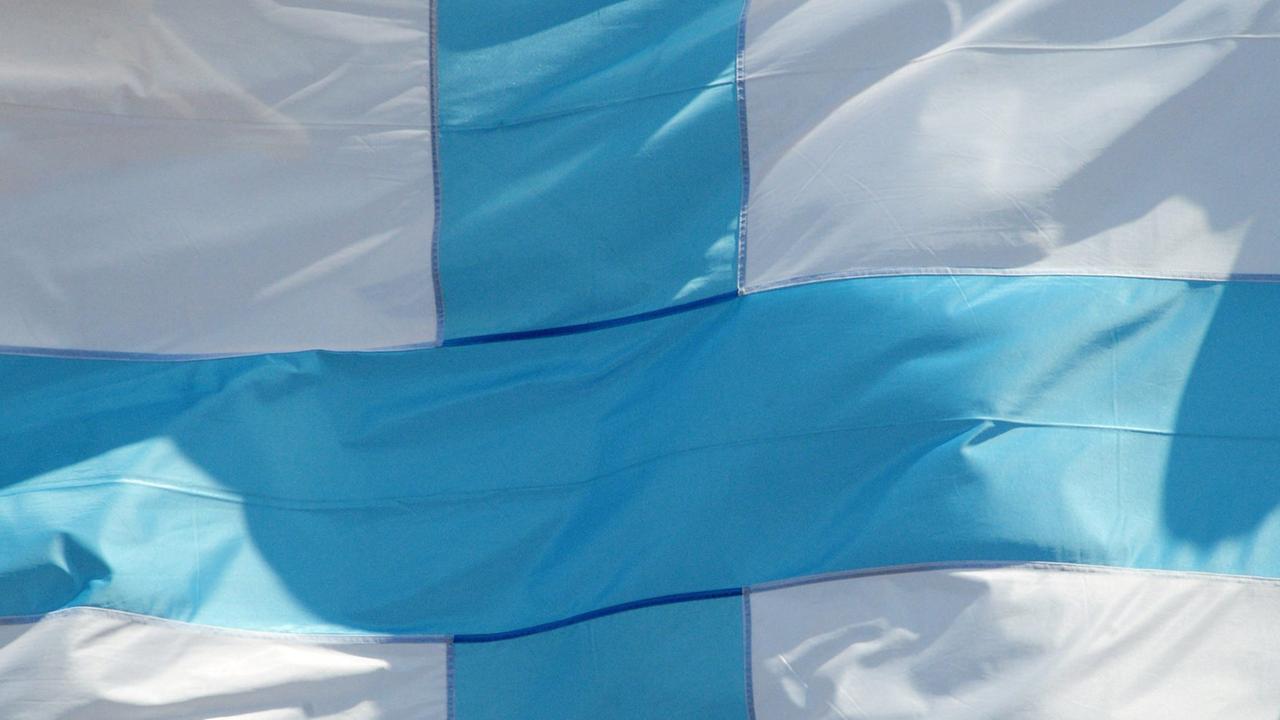"Das digitale Museum der Zukunft wird eines sein, wo uns alle Informationen zu unseren Objekten und Gegenständen tatsächlich digital in globalen Datenbanken zur Verfügung gestellt werden, dass ich tatsächlich an meinem Computer sitzen kann und habe ein Objekt in meiner Sammlung und bekomme online Informationen zu anderen Sammlungsstücken in anderen Museen der Welt, die ich dann digital zusammenführen kann, Sekundärliteratur dazu, sodass ich wirklich (die Möglichkeit habe), an meinem Bildschirm, am Schreibtisch alle Informationen, die es dazu gibt, abrufen kann und was ganz wichtig ist, ich kann mich austauschen mit anderen Menschen in anderen Ländern und das ist grade wichtig im Zusammenhang mit außereuropäischen Sammlungen."
Wissensaustausch sorgt für Transparenz
Noch ist die Vorstellung, die die Ethnologin und Direktorin des Übersee-Museums Bremen, Wiebke Ahrndt, entwirft, Zukunftsmusik. Der Vision von einem digitalen Weltmuseum, in dem jeder Zugriff auf jede Information hat, steht die Realität gegenüber: der oft schlechte Bearbeitungszustand der Ausstellungsobjekte oder das mangelnde Wissen über die Herkunft und Geschichte vieler Objekte in der eigenen Sammlung. Dabei wäre eine größere Transparenz durchaus wünschenswert. Grade die Völkerkundemuseen sehen sich zunehmend mit Rückgabeforderungen der Herkunftsländer konfrontiert, auch wenn diese selbst nicht über Ausstellungsmöglichkeiten und Forschungsmittel verfügen. Ein digitales Museum, das von jedem Ort der Welt aus besucht werden kann, könnte hier Abhilfe schaffen. Das Stichwort heißt: Wissensaustausch.
"Es ist ein Austausch auf Augenhöhe, der im Moment gar nicht so leicht möglich war, weil das Wissen über die Objekte gar nicht so leicht zu den Herkunftsländern zu bringen ist. Und da wird sich viel ändern, da brauchen wir noch viel, wir brauchen auch bessere Übersetzungsprogramme, denn wenn wir in Deutschland etwas in unsere Datenbanken eintragen, tun wir das auf deutsch, und das ist nicht unbedingt die Sprache, die global gesprochen wird."
Digitale Dokumentation im Wandel
Auf die schier unübersehbare Datenflut, die nicht nur eingespeist, sondern auch mit sinnvollen Suchbegriffen versehen neu katalogisiert werden muss, verwies Eckhard Groll vom Deutschen Entomologischen Institut Müncheberg. Doch auch wenn die Daten dann im Netz verfügbar sind, heißt das noch nicht, dass Forscher weltweit damit unbedenklich arbeiten können, wie Heinrich Mallison vom Berliner Museum für Naturkunde betonte:
"Das größte Problem ist eigentlich, dass, wenn man die Daten selbst nicht erhebt, sondern sie von anderen bekommt, man meistens keine Dokumentation hat, wie sind die aufgenommen worden, als Folge weiß ich nicht, was ich damit wirklich forschen darf, ich kenne einfach die Genauigkeit, die Präzision, die Wiederholgenauigkeit der Messung nicht. Viele Forscher denken beim ersten, zweiten Mal, wo sie so was machen, nicht groß drüber nach, aber wir fangen jetzt auch an, das klar anzusprechen, auf Tagungen wie zum Beispiel hier auf der Museum von Babel-Tagung. Es muss noch ein bisschen gestärkt werden."
Frage der Kommunikation
Die technischen Möglichkeiten sind zwar im schnellen Wandel, aber mittlerweile durchaus gegeben. Nun gehe es darum, nutzerorientierte, gemeinsame Standards und fachübergreifende, einheitliche Begriffe zu entwickeln. Dass man Gegenstände oder Bilder nicht mehr nur scannt, sondern gleichzeitig dokumentiert, wie man das getan hat, wie hoch beispielsweise die Auflösung eines 3D-Fotos ist, sollte zukünftig selbstverständlich sein und ist letztendlich eine Frage der Kommunikation.
"Machbar ist das meistens, es fehlt nur am Bewusstsein, dass das geht, einfach, weil wir aus verschiedenen Bereichen kommen. Wir haben den Forscher, wir haben den Kurator und wir haben den Ingenieur und wir haben den Informatiker. Und die Vier, die müssen gut miteinander reden, dann sind viele dieser Sachen auch ganz einfach zu regeln."
Soziale Netzwerke nicht außen vor lassen
Um Kommunikation ging es auch in den beiden anderen Themenschwerpunkten der Frankfurter Konferenz. Über neue Formen der Ausstellungsgestaltung berichtete beispielsweise der Direktor des Landesmuseums Natur und Mensch in Oldenburg, Peter Réné Becker, der ganz auf Interaktion mit seinen Besuchern setzt und sich sogar ein "ambulantes Museum" vorstellen kann, mit dem er über eine App auch bettlägerige Menschen oder mehr Kinder und Jugendliche erreicht oder diejenigen, die erst mal eine Scheu haben, ein Museum zu betreten. In einem Flüchtlingsheim hat das Oldenburger Museum da bereits gute Erfahrungen gemacht. Die Gefahr einer Trivialisierung des Museums sieht Becker dabei jedoch auch. Auf unterschiedliche Resonanz im Plenum stießen die Vorschläge zu einer digitalen Öffentlichkeitsarbeit, wie sie unter anderen die Social-Media-Beraterin Tanja Neumann entwickelte.
"Grundsätzlich geht es bei meinem Arbeitsschwerpunkt ja immer darum, dass die Besucher ihre Smartphones nutzen und dass sie sie nutzen, um über uns zu sprechen und wenn wir Glück haben, eben auch mit uns."
Der intensiven Nutzung von Facebook, WhatsApp, Instagram oder Twitter steht das Handy- und Fotografierverbot gegenüber, dass in den meisten Museen immer noch gilt. Für Tanja Neumann ist das nicht mehr zeitgemäß.
"Wenn Sie sich den Bereich Social Media anschauen, dann ist es eben oft so, dass Besucher sie nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten."
Und zwar direkt, schon während die Besucher in der Ausstellung sind, und nicht erst hinterher am heimischen Computer.
"Das ist ein Weg, um an die Besucher ranzukommen und das ist auch für die Besucher noch zusätzlich ein Weg, sich mit den Inhalten zu beschäftigen. Man beobachtet also sehr häufig, dass die Menschen sehr inhaltlich über Ausstellungen schreiben, dass sie bestimmte Punkte kritisieren, andere Hinterfragen oder ihre eigenen Erfahrungen dazu setzen, das ist auch eine sehr wertvolle Beschäftigung mit den Inhalten der Museen, die man durchaus fördern kann."
Persönliche Kontakte sollten nicht auf der Strecke bleiben
Dass Besucher auch negative Beurteilungen via Smartphone oder Tablett sofort und ungefiltert im Netz veröffentlichen können und dass das Museum darauf immer sofort reagieren soll, sah eine Teilnehmerin aber auch kritisch:
"Ich frag mich aber im Moment, ob ich wirklich auf alles eingehen muss. Es gibt immer die Möglichkeit, mit den Menschen direkt zu kommunizieren, wenn es wirklich auch personell gekennzeichnete Meldungen sind, aber auch so im Umgang mit anderen Menschen ist es ja nicht so, dass ich auf jede üble Nachrede direkt eingehen muss. Also das war jetzt für mich noch mal ein interessanter Aspekt darüber nachzudenken, ob man das wirklich machen muss."
Auf dem Weg zum Museum der Zukunft sollte eben der persönliche Kontakt nicht auf der Strecke bleiben, das gilt für die Präsentation und die Vermarktung genauso wie für die Forschung. Prof. Wiebke Ahrndt:
"Wir müssen auch gleichzeitig uns klarmachen, dass wir anfangen, unsere Originale nicht mehr so zu schätzen, wie wir das jetzt tun und da sehe ich eine Gefahr, wir müssen auch die nächsten Forschergenerationen dazu bringen, die Schränke, die Türen aufzumachen und zu gucken, was liegt da eigentlich, um neugierig zu bleiben für Kenntnisse rechts und links des Weges. Denn wenn ich eine Online-Frage starte, kriege ich ja nur die Antworten auf die Fragen, die ich gefragt habe und nicht Zufallsfunde, die vielleicht ganz spannend mich in ganz neue Wege leiten könnten."