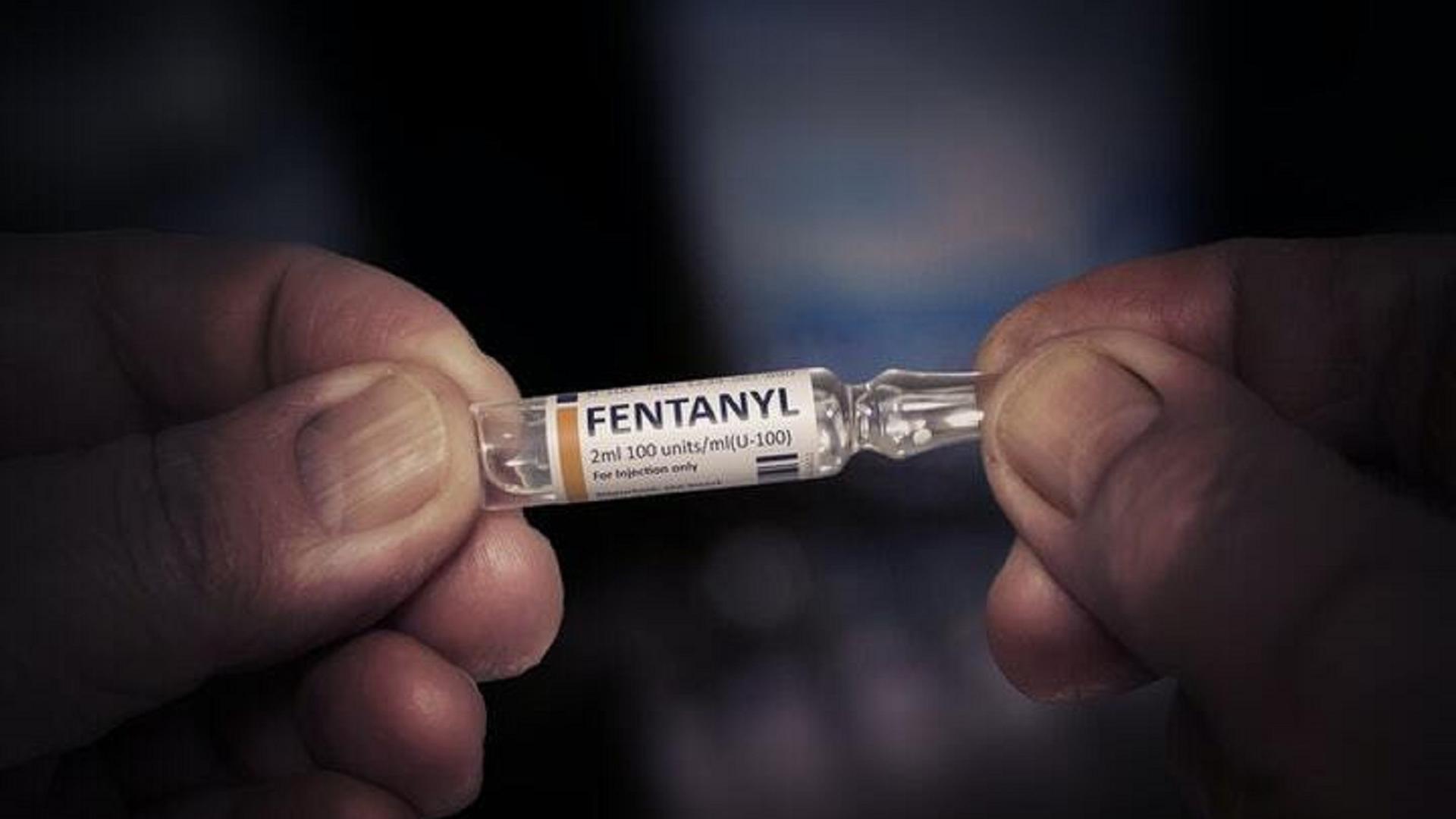Die offene Drogenszene, dazu zählen Menschen, die im öffentlichen Raum Drogen konsumieren, ist in vielen deutschen Städten immer sichtbarer geworden. Zum einen nimmt die Zahl der Konsumenten illegaler Drogen kontinuierlich zu, wie der REITOX-Jahresbericht 2024 zur Situation illegaler Drogen in Deutschland belegt. Zum anderen sind in letzter Zeit überall Baulücken geschlossen worden. Der Platz für Drogenkranke im öffentlichen Raum ist kleiner geworden, weshalb sich die Szene auf wenige Orte konzentriert. Diese sind aber von Passenten oft hochfrequentiert, da sie mitten in den Innenstädten liegen. Doch die meisten Vorbeigehenden schauen lieber weg. Wie können wir als Gesellschaft dazu beitragen, dass den Suchtkranken geholfen wird und die Innenstädte nicht weiter verwahrlosen?
Offene Drogenszene: Welche Rolle spielt Crack?
Seit einigen Jahren wird in Deutschland immer mehr Crack konsumiert. Die Droge ist weit verbreitet, weil sie erschwinglich und leicht zu beschaffen ist und schnell psychisch abhängig macht. In weiten Teilen Deutschlands, insbesondere in Großstädten, ist der Crackkonsum in den vergangenen Jahren angestiegen.
Crack wird aus Kokain hergestellt und geraucht. Der Konsum führt schon nach wenigen Sekunden zu einem intensiven Glücks- und Rauschzustand, der jedoch nur ein paar Minuten anhält. Klingt der Rausch ab, wollen Crackabhängige direkt den nächsten Kick erleben, wieder und immer wieder. Der „Binge-Konsum“ führt dazu, dass Suchtkranke nicht mehr auf ihre körperlichen Bedürfnisse achten, nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr trinken.
Psychosen, Depressionen, Herzrasen, Atemnot, körperlicher Verfall und erhöhte Aggressivität sind typische Folgen des Crackkonsums. Erschwerend kommt hinzu, dass es in Deutschland bislang keine Substitutionstherapien gibt.
Kokain ist in großer Menge im Umlauf. 2024 wurden in Deutschland von Zoll und Polizei 43 Tonnen Kokain sichergestellt. So viel wie nie zuvor. Zum Vergleich: 2017 wurden nur acht Tonnen Kokain beschlagnahmt. BKA-Präsident Holger Münch sprach im April von einer „Kokain-Schwemme“. Der internationale Drogenhandel konzentriere sich stärker auf Europa, weil der Markt in Nordamerika gesättigt sei. Kokain wird zunehmend über die Häfen in Rotterdam, Antwerpen und Hamburg nach Europa geschmuggelt.
Warum viele Menschen Drogenkranke ignorieren
Viele Passanten ignorieren Drogenkranke im öffentlichen Raum, indem sie schnell und wortlos an ihnen vorbeigehen. Das liegt nicht zwingend an mangelndem Mitgefühl, sondern daran, dass es Menschen unangenehm ist, andere Menschen zu sehen, die ungepflegt und verwahrlost erscheinen, erklärt die Sozialpsychologin Julia Degner. Darüber hinaus erinnere der Anblick von Drogenkranken daran, dass Dinge gewaltig schief gehen können im Leben. Einige Menschen wiederum sind überzeugt davon, dass jeder kriege, was er verdiene und die Suchtkranken selbst Schuld seien an ihrer Misere.
Empathie ist die angeborene Fähigkeit, die Zustände einer anderen Person zu teilen. Sie ist am stärksten ausgeprägt zu nahestehenden Menschen und Menschen, die uns ähnlich sind, sagt die Neurowissenschaftlerin Grit Hein. Empathisch zu sein und sich selbst zu schützen, indem man die Augen vor dem Leid anderer schließt, sei aber kein Widerspruch.
„Empathie, wie wir sie verstehen, ist erst mal ein relativ neutraler Zustand“, sagt Grit Hein. „Ich teile, was mit der anderen Person gerade passiert. Und dieses Teilen kann sich dann eben einerseits in Zuwendung und Helfen verwandeln, andererseits aber eben diese Stressreaktionen auslösen, die dann eine Abwehr hervorruft.“ Es ist sogar möglich, Empathie zu regulieren, quasi ein- und auszuschalten. In einigen Berufen ist dies notwendig, um angemessen auf Situationen reagieren zu können.
Können wir als Gesellschaft empathischer werden?
Es gibt Gesellschaften, in der Mitgefühl und Hilfe einen sehr hohen Stellenwert hat. Es gebe aber auch Gesellschaften, sagt Neurowissenschaftlerin Grit Hein, „wo das eher nicht der Fall ist, also wo es eher dann die Regel ist, dann tatsächlich wegzuschauen und all jene, denen es nicht so gut geht, dann auch als etwas zu definieren, was nicht zu uns gehört.“
Hinzu kommt, dass sich Empathie besser entfaltet, wenn die Menschen das Gefühl haben, überhaupt Hilfe leisten zu können. Doch wie man Drogenkranke auf der Straße unterstützen kann, ist vielen Menschen gar nicht bewusst.
Ich würd mir wünschen, dass man nicht so ignoriert wird, daran vorbei, mit Scheuklappen, möglichst noch auf ein Handy gucken, so tun, als seh ich nichts, sondern jemanden ansprechen und sagen: Wie geht’s Ihnen? Können wir dir helfen? Nicht mit Geld, mit Konsum oder so. Ein Gespräch tut’s schon. Einfach nur ein paar nette, warme Worte.
Michaela ist vor zwei Jahren zur Düsseldorfer Drogenszene gestoßen.
Ein Forscherteam um Neurowissenschaftlerin Grit Hein hat herausgefunden, dass Menschen empathischer agieren, wenn sie sich in einem empathischen Umfeld bewegen. Nicht nur Kinder, auch Erwachsene lernen von empathischen Vorbildern. Die positiven Effekte lassen sich neuronal im Gehirn messen. Diese Erkenntnisse zeigen, so Grit Hein, „dass wir als Gesellschaft, wenn wir ein kooperatives Umfeld erzeugen möchten, wenn wir eine empathische Gesellschaft werden möchten, dass wir empathische Rollenmodelle brauchen in der Politik, in der Öffentlichkeit und auch im alltäglichen Leben.“
Städtische Drogenpolitik: Konsumräume, Sozialberatung und Repression
Der Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik hat ganz konkrete Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Crack-Konsum an die Städte. Er plädiert für lebensweltnahe Präventionsmaßnahmen und verbesserte Kommunikation mit Drogenkranken. Es sollten mehr Drogenkonsumräume eröffnet und Suchtkranken Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum zugestanden werden. Zudem sollten die Städte einen niedrigschwelligen Zugang zu einer psychosozialen Betreuung und einer medizinischen Grundversorgung anbieten. Des Weiteren sei eine intensivere Vernetzung zwischen Städten, aber auch zwischen Polizei, Ordnungsamt und Drogenhilfe vonnöten.
„Frankfurter Weg“
Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist bundesweit als Hotspot der Drogenszene bekannt. Bis Ende der 1980er-Jahre setzte die Stadt auf massive Polizeipräsenz und Repression. Doch so gelang es nicht, die Dealer und Konsumenten von den Straßen zu vertreiben. Mit der „Frankfurter Resolution“ schlug die städtische Drogenpolitik seit 1990 einen anderen Weg ein. Ein zentrales Element sind Suchthilfezentren. In den Konsumräumen stehen sauberes Spritzbesteck und sterile Pfeifen bereit, es gibt medizinische Hilfe. All das soll Infektionen und Überdosierungen verhindern und Vertrauen schaffen, um Abhängige in Therapien vermitteln zu können. Aktuell plant die Stadt ein Crack-Suchthilfezentrum.
Die Zahl der Drogentoten ist zurückgegangen, seit die Stadt auf Hilfen statt Repressionen setzt. Manche Menschen schaffen es dank medizinischer Versorgung, Sozialberatung und Therapieangeboten nach Jahren raus aus der Drogenszene. Ein Problem aber ist, dass es landesweit keine weiteren Drogenkonsumräume gibt, obwohl es auch in Städten wie Darmstadt oder Wiesbaden offene Drogenszenen gibt. Die Folge ist, dass die Hilfseinrichtungen in Frankfurt auch Zufluchtsorte für Menschen werden, die gar nicht in Frankfurt leben.
„Züricher Modell“
Die Stadt Zürich in der Schweiz hatte bis in die 1990er-Jahre hinein eine offene Drogenszene, die sich zunächst im Platzspitz-Park mitten in der Innenstadt festsetzte. Der Ort verkam zusehends, Spritzen lagen überall herum, Kriminalität breitete sich aus, die Anwohner waren entsetzt. Jahr für Jahr starben hunderte Menschen an Drogen. Die vorübergehende Schließung des Parks 1992 führte jedoch nur dazu, dass sich die Drogenszene verlagerte. Erst mit dem Züricher Vier-Säulen-Modell, das 1994 eingeführt wurde, konnte die Stadt die Drogenproblematik in den Griff kriegen.
Heute gibt es in Zürich keine offene Drogenszene mehr, weil Polizei und Sozialdienste eng zusammenarbeiten. Das Aufkeimen einer offenen Drogenszene soll mit allen Mitteln verhindert werden. Zürichs Drogenpolitik setzt auf null Toleranz bei Drogenhandel und Drogenkonsum im öffentlichen Raum und bietet gleichzeitig niedrigschwellige Sozialberatungsangebote und Konsumräume für Suchtkranke mit einer Besonderheit: In den Einrichtungen dürfen sich Suchtkranke gegenseitig Drogen in Kleinstmengen verkaufen. Die Polizei trägt diese Strategie mit. Nur wer offiziell in Zürich gemeldet ist, darf die Einrichtungen betreten und Drogen konsumieren. Suchtkranke bekommen dort sauberes Drogenbesteck, außerdem Kaffee, Tee und Kleidung. Sie erhalten eine Sozialberatung und medizinische Betreuung.
Kristina Reymann-Schneider