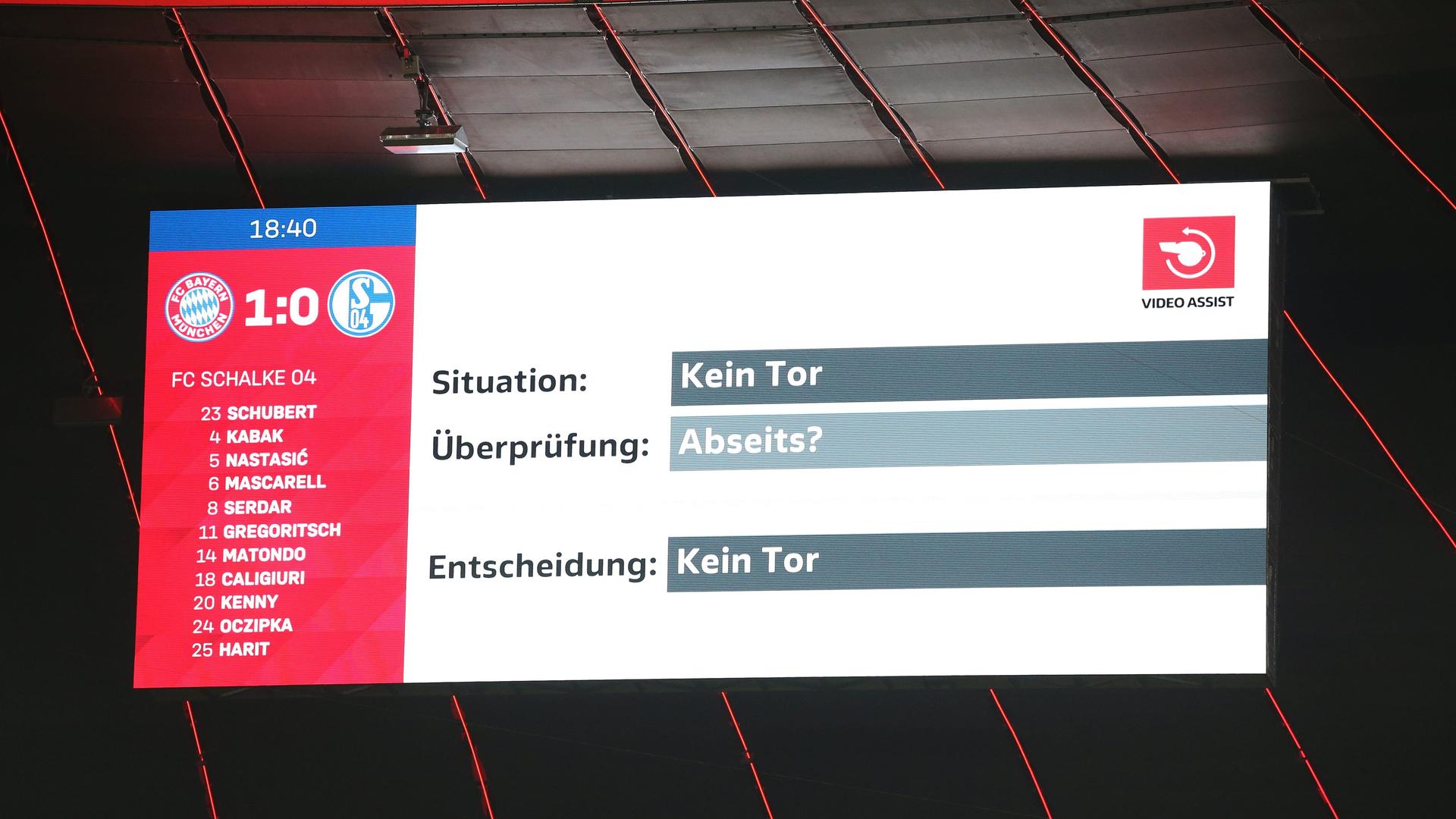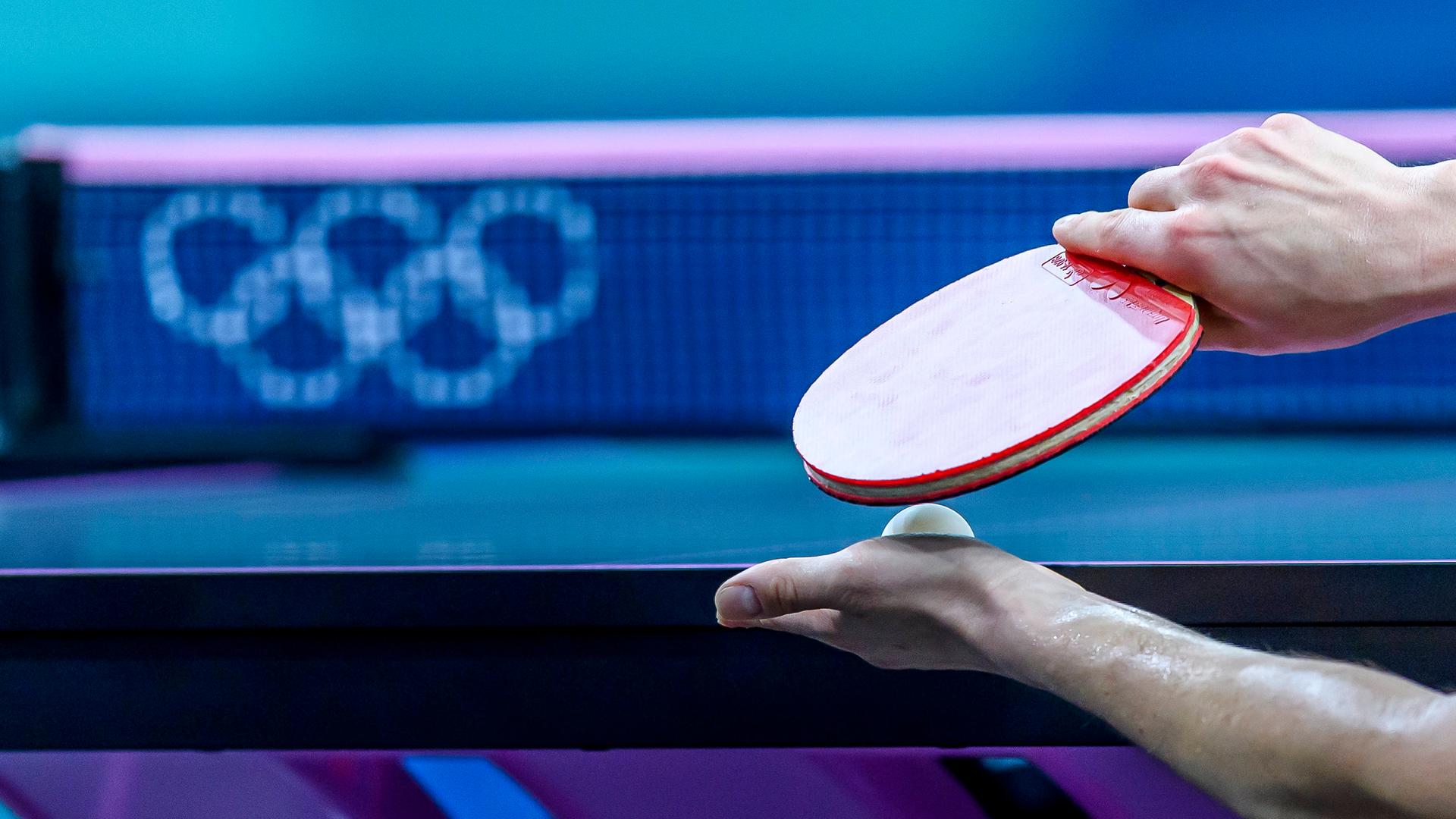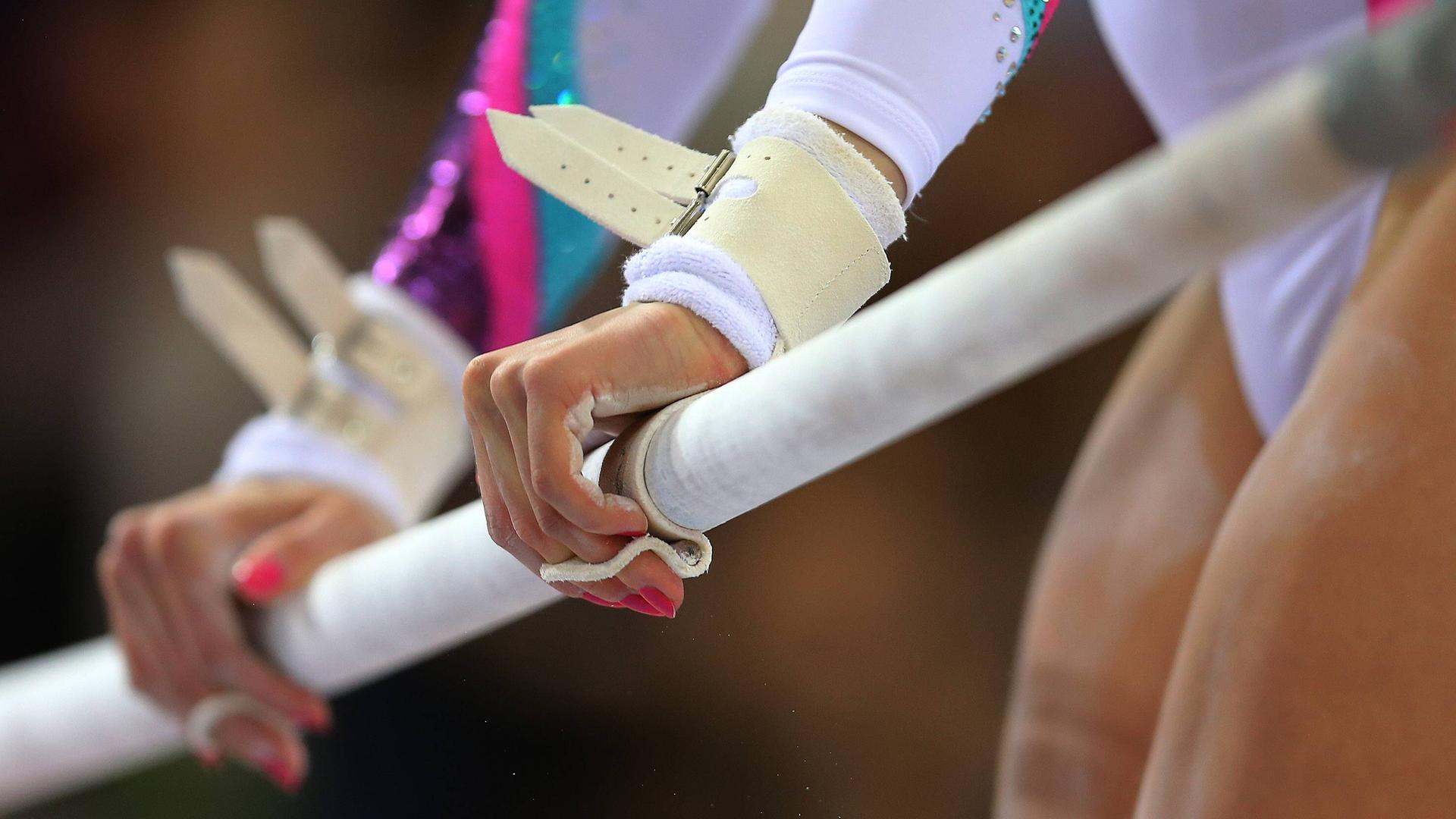Eine geringe Anzahl von Frauen in den Führungsebenen sei im Sport kein spezielles Problem des Fußballs, sagt Lara Lesch, Doktorin der Sportwissenschaft an der Universität Bielefeld. Im Durchschnitt gebe es in den Gremien von Sportbünden und Verbänden auf Bundes- oder Landesebene etwa 20 Prozent Frauen: „Das ist natürlich weder sonderlich gleichberechtigt, noch ist es irgendwo in der Nähe davon.“ Selbst in Sportarten, die historisch eher weiblich konnotiert seien, gebe es nicht zwingend mehr Frauen in den Führungsgremien.
Für ihr Projekt "Women in sport leadership: A multi-level perspective", bekam Lesch vor Kurzem den ersten Platz des Forschungspreises FeMaLe („Frauen und Mädchen im Leistungssport“) vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft in Bonn.
Warum besetzen Frauen einen so geringen Teil der Führungspositionen im Sport? Dafür gibt es für Lesch viele Faktoren:
- Gesamtgesellschaftliche Faktoren, wie herrschende Normen oder Rollenbilder: Wen sehen wir als geeignet für Führungsposition an?
- Politische und ökonomische Umgebungsfaktoren: In konservativer eingestellten Gegenden sind weniger Frauen in Führungspositionen.
- Besonders wichtig ist die Organisationskultur: Wer ist eigentlich willkommen?
- Oft herrscht genereller Mangel an Bewusstsein und Offenheit für Veränderung: Das Problem muss Führungspersonen erst einmal klar sein.
- Fehlendes Know-How für Veränderung: Was machen? Wie machen? Welche Ressourcen nutzen?
- Und dann auch noch die Ressourcen selbst, gerade in ehrenamtlichen Strukturen ist das laut Lesch wichtig: Mit welchen Mitteln erzeugt man Wandel?
Die Gewichtung dieser Faktoren sei aber in jeder Organisation unterschiedlich, erklärt Lesch.
- Gesamtgesellschaftliche Faktoren, wie herrschende Normen oder Rollenbilder: Wen sehen wir als geeignet für Führungsposition an?
- Politische und ökonomische Umgebungsfaktoren: In konservativer eingestellten Gegenden sind weniger Frauen in Führungspositionen.
- Besonders wichtig ist die Organisationskultur: Wer ist eigentlich willkommen?
- Oft herrscht genereller Mangel an Bewusstsein und Offenheit für Veränderung: Das Problem muss Führungspersonen erst einmal klar sein.
- Fehlendes Know-How für Veränderung: Was machen? Wie machen? Welche Ressourcen nutzen?
- Und dann auch noch die Ressourcen selbst, gerade in ehrenamtlichen Strukturen ist das laut Lesch wichtig: Mit welchen Mitteln erzeugt man Wandel?
Die Gewichtung dieser Faktoren sei aber in jeder Organisation unterschiedlich, erklärt Lesch.

Quoten nicht als Lösung, aber als Anstoß
Quoten sind dabei für sie nicht die nicht die alleinige Lösung des Problems. Teilweise könne es für Kandidatinnen auch unschön sein, für die Erfüllung einer Quote ausgesucht zu werden. Es gebe aber einen positiven Effekt - der erzeugte Druck: „Quoten helfen erstmal, einen Status Quo herzustellen, von dem aus man weiterarbeiten kann.“ Die Quote sei also nicht die Problemlösung, sondern der Anstoß für Veränderung. Der gesamter Änderungs-Prozess dauere dann Jahre.
Als Vorbilder laut Lesch taugen vor allem Skandinavische Länder: Dort werde Diversität mehr gelebt. Auch die Sportsysteme in Spanien oder Kanada hätten gute Ansätze– allerdings auch deutlich mehr Einfluss durch die Politik als in Deutschland. Konkrete Verbesserungen brächten in diesen Fällen oft strukturelle Änderungen. Zum Beispiel eine Änderung der Sitzungszeiten und mehr Flexibilität bei Zeit und Ort dieser Sitzungen. Oft sei das Erfüllen von Diversitätskriterien an die Verteilung von Fördergeldern gekoppelt - auch so entsteht Handlungsdruck.
Aber auch in Deutschland gebe es Verbände und Vereine, die es gut machten, sagt Lesch. Problem sei oft, dass untereinander zu wenig kommuniziert werde und damit Lösungen nicht verbreitet. Generell sei das Thema gerade für Ehrenamtler schnell überfordernd, weil es so viele Aspekte gebe und daher nur schwer ein Anfangspunkt zu finden sei.
Bisher nur kleine Veränderungen in Deutschland
Lesch legt aber den Fokus darauf, überhaupt eine Bereitschaft für Veränderung zu haben: "Das Bewusstsein ist ein wichtiger erster Schritt." Dabei gebe es bei jüngeren Führungsebenen oft auch eher ein Bewusstsein, weil jüngere Generationen schon ein anderes Rollenbild verinnerlicht haben.
In den letzten zwei Jahrzehnten habe es trotzdem nur kleine Veränderungen gegeben, sagt Lesch, weil der Fokus bisher vor allem Mentoring für einzelne Funktionärinnen und einen Fokus auf die individueller Ebene bei den Frauen lag: „Die Forschung zeigt aber, dass zum Beispiel Frauen gar nicht schlechter qualifiziert sind als Männer." Die Lösung mit individueller Förderung beziehe sich also auf ein Problem, das es eigentlich gar nicht gebe.
Eine generelle Erkenntnis, die sich durchsetze: "Das ist tatsächlich etwas, was jetzt so ein bisschen mehr rauskommt: Dieser Shift weg von der Individualebene und ‚Frauen müssen etwas tun, damit sie quasi mithalten können‘. Das ist, denke ich, wichtig, dass man eher sagt: ‚Das ist ein strukturelles Problem“ und dass man sich damit befasst."