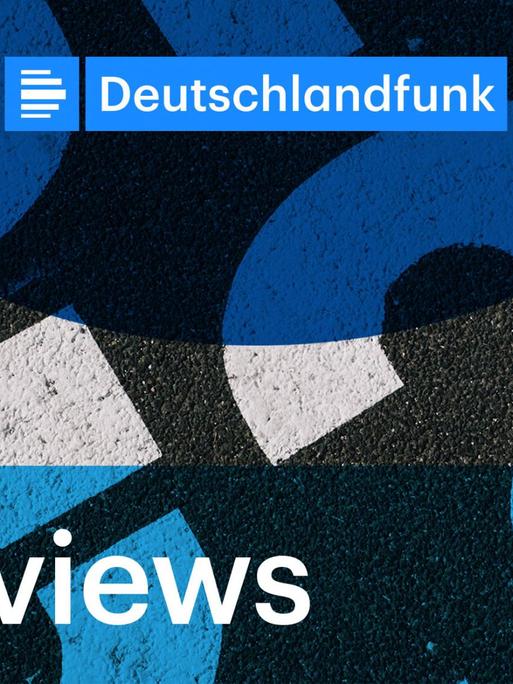In der Politik herrscht breiter Konsens darüber, dass Deutschland einen neuen Wehrdienst braucht. Doch in Bezug auf die konkrete Ausgestaltung gibt es unterschiedliche Vorstellungen und Vorschläge.
Der jüngste Vorstoß kommt von 89 grünen Parteimitgliedern, die ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle jungen Menschen bis zum 28. Lebensjahr fordern. Die Einsatzmöglichkeiten reichen dabei von der Bundeswehr über den Katastrophenschutz bis hin zu sozialen und ökologischen Projekten.
Wie sieht der Vorschlag für den verpflichtenden Dienst aus?
Der Antrag, der auf dem Bundesparteitag der Grünen im November zur Diskussion steht, richtet sich an alle Geschlechter und sieht vor, einen verpflichtenden Dienst für junge Menschen bis zum 28. Lebensjahr einzuführen. Dabei soll dieser Dienst für alle, die ihre Schule abgeschlossen haben, verpflichtend sein. Menschen, die älter als 28 sind, sollen sich aber freiwillig engagieren können.
Die Dauer des Dienstes wird auf 9 bis 12 Monate festgelegt. Ihren Einsatzbereich sollen die jungen Menschen selbst wählen können. Mögliche Einsatzfelder umfassen nicht nur die Bundeswehr, sondern auch den Zivil- und Katastrophenschutz, Tätigkeiten in sozialen Einrichtungen oder auch in ökologischen Projekten.
Befürworter dieses Vorschlags sehen darin eine breite und vielfältige Möglichkeit, sich aktiv in gesellschaftliche Prozesse einzubringen und Verantwortung zu übernehmen – unabhängig vom Geschlecht. Sie sehen in der Verpflichtung einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft und die persönliche Entwicklung.
Korbinian Brielbeck, Bezirksgeschäftsführer der Jungen Union Niederbayern und Reserveoffizier in Ausbildung, zeigt sich offen für verschiedene Modelle, drängt jedoch auf eine rasche Einführung der Wehrpflicht, um die Verteidigungskapazitäten zu stärken.
Kritik: Pflichtdienst jeder Art ein Eingriff in die Selbstbestimmung
Die schärfste Ablehnung eines allgemeinen Pflichtdienstes kommt von Jugendorganisationen und Experten, die die Freiwilligkeit als entscheidenden Qualitätsfaktor ansehen.
Luis Bobga von der Grünen Jugend kritisiert den Vorschlag als Versuch, einen „Pflichtdienst für alle jungen Menschen“ zu beschönigen. Ein solcher Eingriff stelle „krasse Einschnitte in die Selbstbestimmung“ dar, und die Jugend sei, so Bobga, „ganz klar gegen Pflichtdienste jeder Art“.
Auch Gerd Placke von der Bertelsmann Stiftung lehnt den Ansatz eines Pflichtdienstes ab. In einer freiheitlichen Gesellschaft müsstne sich „nicht alle engagieren“. Ein Zwangsdienst führe dazu, dass junge Menschen gezwungen würden, „das zu machen, was die Grünen, die CDU und andere Parteien so denken,“ anstatt das zu machen, was sie wollten.
Zudem stellt er die praktische Umsetzbarkeit infrage. Es sei zweifelhaft, ob überhaupt genügend attraktive Stellen geschaffen werden könnten – insbesondere, weil der Dienst kein Ersatz für reguläre Arbeitsplätze sein dürfe. Es bestehe die Gefahr, dass die Tätigkeiten in unqualifizierte Aufgaben abgleiten, wie es früher beim Zivildienst der Fall war, etwa bei Küchenarbeiten oder beim Bonbonverkauf in Jugendherbergen.
Hinzu kommt der Vorwurf mangelnder Akzeptanz und Beteiligung der Betroffenen. Die Debatte werde, so Kritiker wie Placke, oft über junge Menschen, aber selten mit ihnen geführt.
Generell ließe sich ein soziales Pflichtjahr, wie es auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seit Jahren befürwortet, sich nur mit einer Änderung des Grundgesetzes umsetzen, sagte Eva Maria Welskop-Deffaa von der Caritas im Dlf noch im September. Die dafür notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit gilt derzeit jedoch als „nicht in Sicht“ beziehungsweise „absehbar nicht erreichbar“.
Auch eine geplante Reform der Wehrpflicht würde eine Verfassungsänderung erfordern: Da es etwa ebenso viele junge Frauen pro Jahrgang gibt, dürften diese ohne eine solche Anpassung weder gemustert noch eingezogen werden, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz kürzlich in der ARD-Sendung „Caren Miosga“.
Statt einer Dienstpflicht plädieren Experten der Bertelsmann Stiftung und Wohlfahrtsverbände wie die Caritas für eine deutliche Stärkung der bestehenden Freiwilligendienste. Junge Menschen müssten motiviert, nicht verpflichtet werden, findet Gerd Placke.
Zu den zentralen Forderungen gehört seiner Meinung nach auch ein Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienstplatz, da es derzeit mehr Bewerber als verfügbare Plätze gibt.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den finanziellen Rahmenbedingungen. Das Taschengeld, das meist zwischen 400 und 500 Euro liegt, reiche insbesondere in Städten nicht mehr aus, um davon leben zu können. Es müsse, so schlägt Placke vor, auf die Höhe des BAföG-Bedarfssatzes angehoben werden, um auch jungen Menschen aus einkommensschwächeren Familien den Zugang zu ermöglichen. Die Caritas verweist darauf, dass Soldaten im Wehrdienst künftig über 2000 Euro im Monat erhalten sollen.
Schließlich fordert die Bertelsmann Stiftung auch eine stärkere Anerkennungskultur für geleistete Freiwilligendienste - etwa durch Zertifikate, die bei Bewerbungen oder an Universitäten angerechnet werden können, oder durch andere Formen der Wertschätzung.
dh